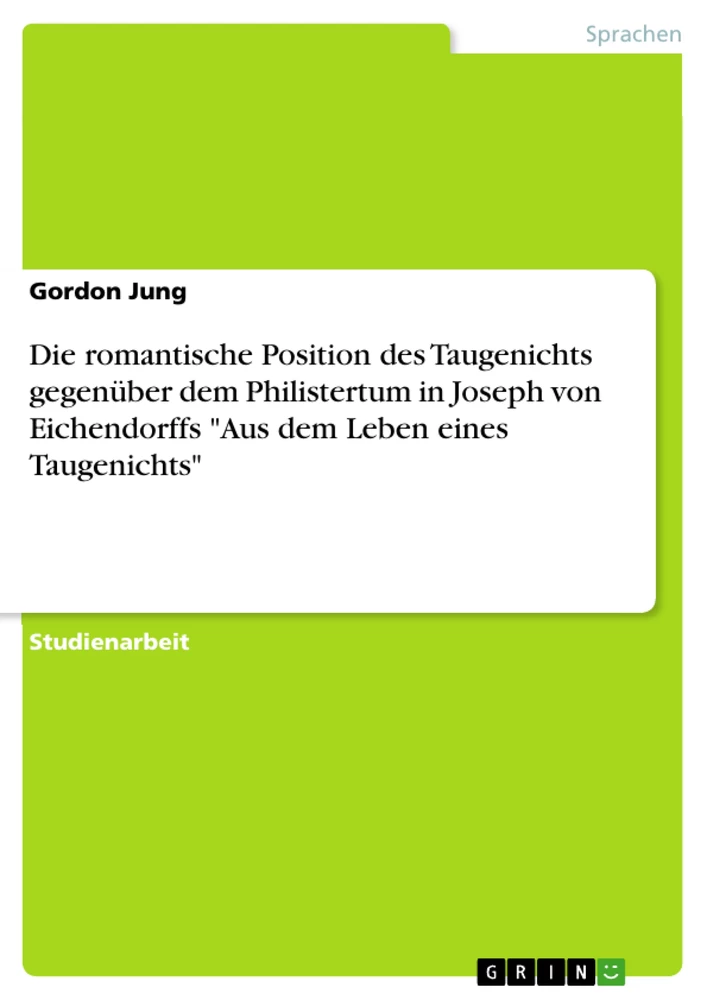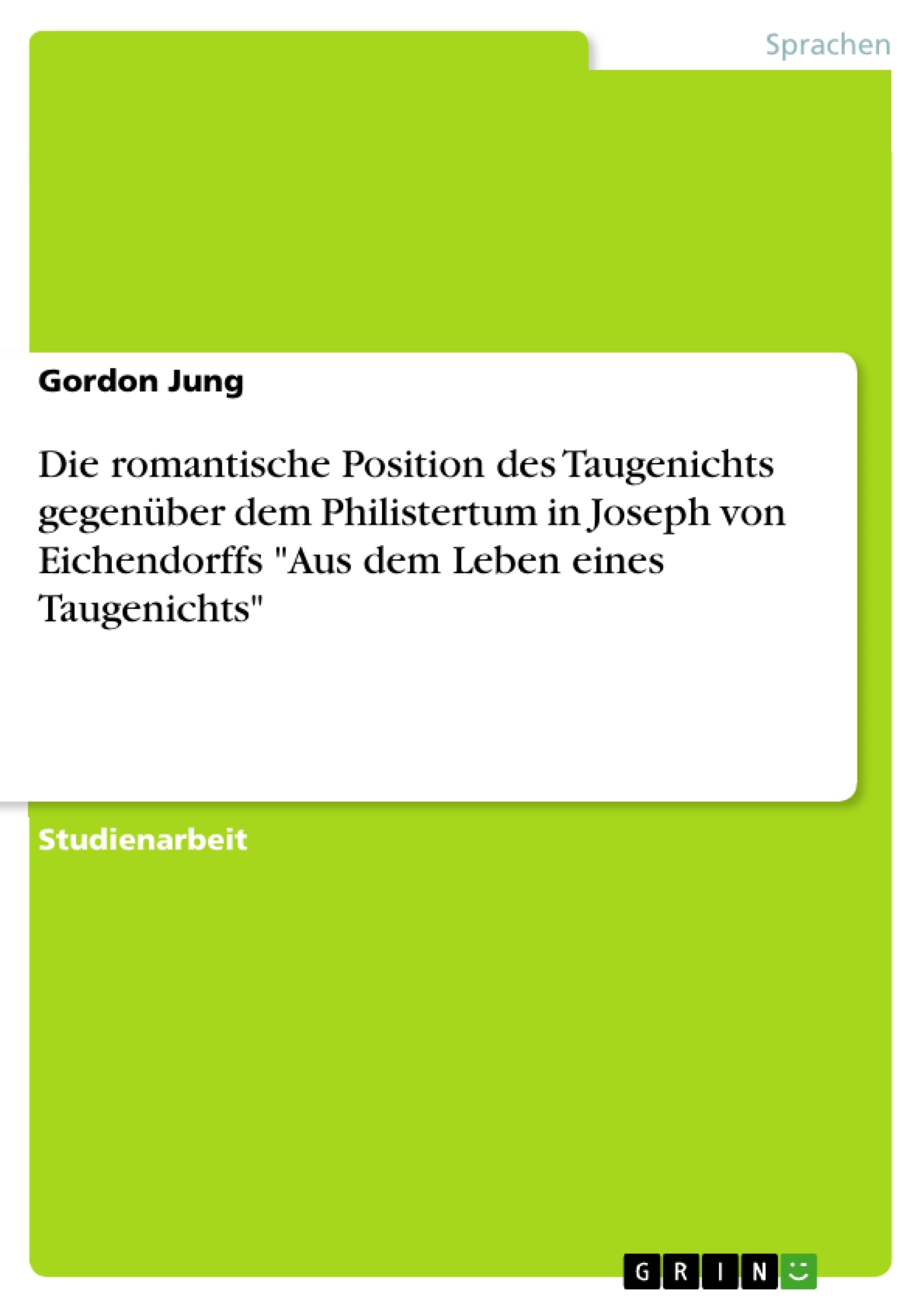Der Roman Aus dem Leben eines Taugenichts von Joseph Karl Benedikt Freiherr von Eichendorff erschien erstmals 1826 als vollständiger Buchdruck gemeinsam mit der Novelle „Marmorbild“ sowie einer Gedichtauswahl. Er beschreibt die „abenteuerliche Lebensreise“ eines als „Taugenichts“ titulierten Müllerjungen. Von seinem Vater zu Beginn von der heimischen Mühle verstoßen, vagabundiert der romantische Held über mehrere Stationen und Episoden, wobei er immer wieder in Kontakt mit dem philiströsen Bürgertum und deren Credos, Konventionen und Normen gerät. Genau jene beiden kontrastierenden, gesellschaftlichen Formen und Positionen werden in dieser Arbeit in den Fokus gerückt und thematisiert: „Hat Eichendorff […] beabsichtigt, […] im Taugenichts eine humorvolle und romantisch anziehende Kontrastfigur zu den ´seßhaften und fetten` Philistern zu schaffen?“
Im folgenden Verlauf wird dies näher durchleuchtet, um schließlich die Frage zu klären, ob die Romantik und das Philistertum einen unvereinbaren Widerspruch darstellen. Hierbei wird zuerst auf die Romantik anhand einer groben Charakteristik der Taugenichtsfigur sowie des Motivs des Reisens eingegangen und anschließend das Spießbürgertum mit Hilfe einer textimmanenten Darstellung des Portiers beschrieben. Abschließend mündet dies in eine direkte Gegenüberstellung der beiden Untersuchungsobjekte, wobei hermeneutisch operiert wird.
Nicht zuletzt die „immerwährende Aktualität der Taugenichtsthematik“ , das generelle Zusammenwirken von Individuum und Gemeinwesen sowie die daraus resultierenden Kontroversen messen diesem Thema einen besonderen Stellenwert und eine gewisse Relevanz bei.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Charakteristika eines Taugenichts
- Der Aufbruch – Der ständige Drang zum Reisen
- Das Philistertum
- Der Portier - Die Inkarnation des Spießbürgertums
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Joseph von Eichendorffs Novelle „Aus dem Leben eines Taugenichts“ und untersucht die Kontrastierung zwischen der romantischen Figur des Taugenichts und dem philiströsen Bürgertum. Ziel ist es, die Charakteristika beider gesellschaftlichen Formen zu beleuchten und zu ergründen, ob Romantik und Philistertum unvereinbar sind.
- Charakterisierung des Taugenichts als romantische Figur
- Analyse des Motivs des Reisens und der Unrast des Taugenichts
- Darstellung des Philistertums anhand des Portiers als Repräsentanten des Spießbürgertums
- Gegenüberstellung von Romantik und Philistertum
- Die Aktualität der Taugenichtsthematik und die Kontroversen zwischen Individuum und Gemeinwesen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Novelle „Aus dem Leben eines Taugenichts“ ein und stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Kontrastierung zwischen dem Taugenichts und dem philiströsen Bürgertum und die Frage nach der Vereinbarkeit von Romantik und Philistertum.
Das Kapitel „Die Charakteristika eines Taugenichts“ analysiert die Figur des Taugenichts anhand seiner Unbestimmtheit, seiner Reise- und Abenteuerlust sowie seiner musisch-poetischen Natur. Es wird deutlich, dass der Taugenichts ein Typus Mensch ist, der sich den gesellschaftlichen Normen nicht unterwirft und eine andere Lebensweise verkörpert.
Das Kapitel „Der Aufbruch – Der ständige Drang zum Reisen“ beleuchtet das Motiv des Reisens als Ausdruck der Freiheit und der Naturverbundenheit des Taugenichts. Es wird gezeigt, dass der Taugenichts durch seine ständige Bewegung und seine Suche nach dem Göttlichen eine Außenseiterposition einnimmt.
Das Kapitel „Das Philistertum“ analysiert das Spießbürgertum anhand der Definition des Philisters nach Eichendorff und zeigt die Merkmale des Materialismus, des Egoismus und der Monotonie des rationalen Besitzbürgertums auf.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Taugenichts, die Romantik, das Philistertum, das Spießbürgertum, das Reisen, die Freiheit, die Natur, die Gesellschaft, die Kontroversen zwischen Individuum und Gemeinwesen sowie die Aktualität der Taugenichtsthematik.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist der „Taugenichts“ in Eichendorffs Novelle?
Der Taugenichts ist ein Müllerbursche, der als romantischer Held die Freiheit sucht, die Welt bereist und sich den starren bürgerlichen Konventionen widersetzt.
Was versteht Eichendorff unter „Philistertum“?
Das Philistertum bezeichnet das spießbürgerliche Leben, das durch Materialismus, Ordnungsliebe, Engstirnigkeit und einen Mangel an Fantasie geprägt ist.
Welche Rolle spielt der Portier in der Erzählung?
Der Portier verkörpert die Inkarnation des Spießbürgertums. Er ist der direkte Kontrast zum Taugenichts und steht für Sesshaftigkeit und soziale Normen.
Warum ist das Motiv des Reisens für die Romantik zentral?
Reisen symbolisiert die Suche nach dem Unendlichen, die Sehnsucht nach Freiheit und die Abkehr vom zweckgebundenen Alltag der Philister.
Sind Romantik und Philistertum unvereinbare Widersprüche?
In Eichendorffs Werk stehen sie sich als gegensätzliche Lebensentwürfe gegenüber, wobei der Taugenichts durch seinen Humor und seine Musikalität eine Brücke zwischen den Welten schlägt.
- Arbeit zitieren
- Gordon Jung (Autor:in), 2013, Die romantische Position des Taugenichts gegenüber dem Philistertum in Joseph von Eichendorffs "Aus dem Leben eines Taugenichts", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281148