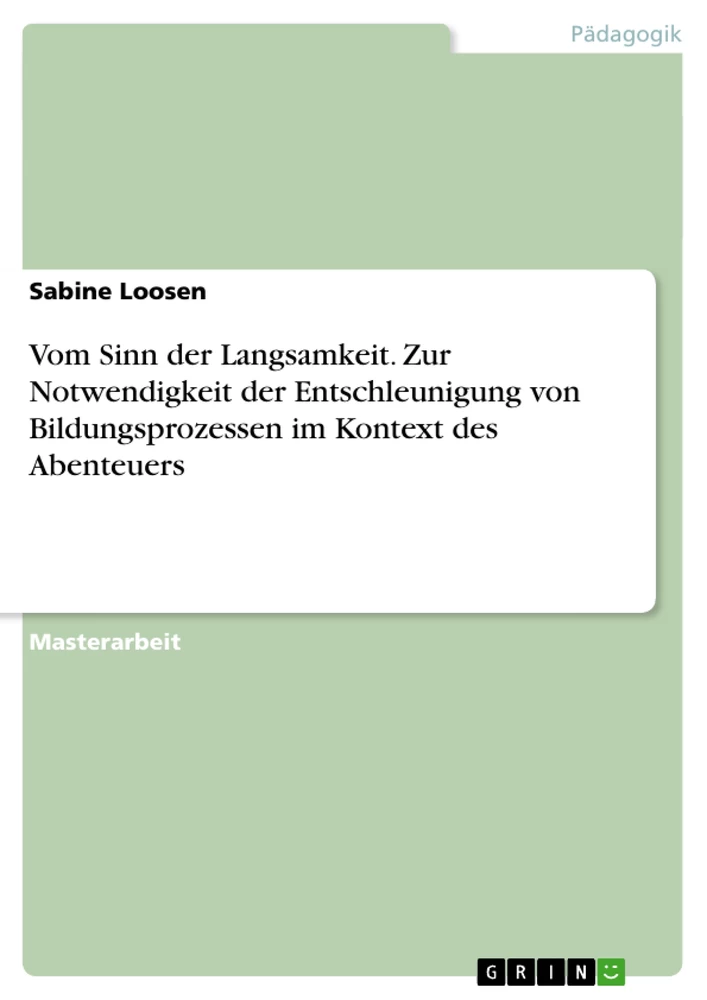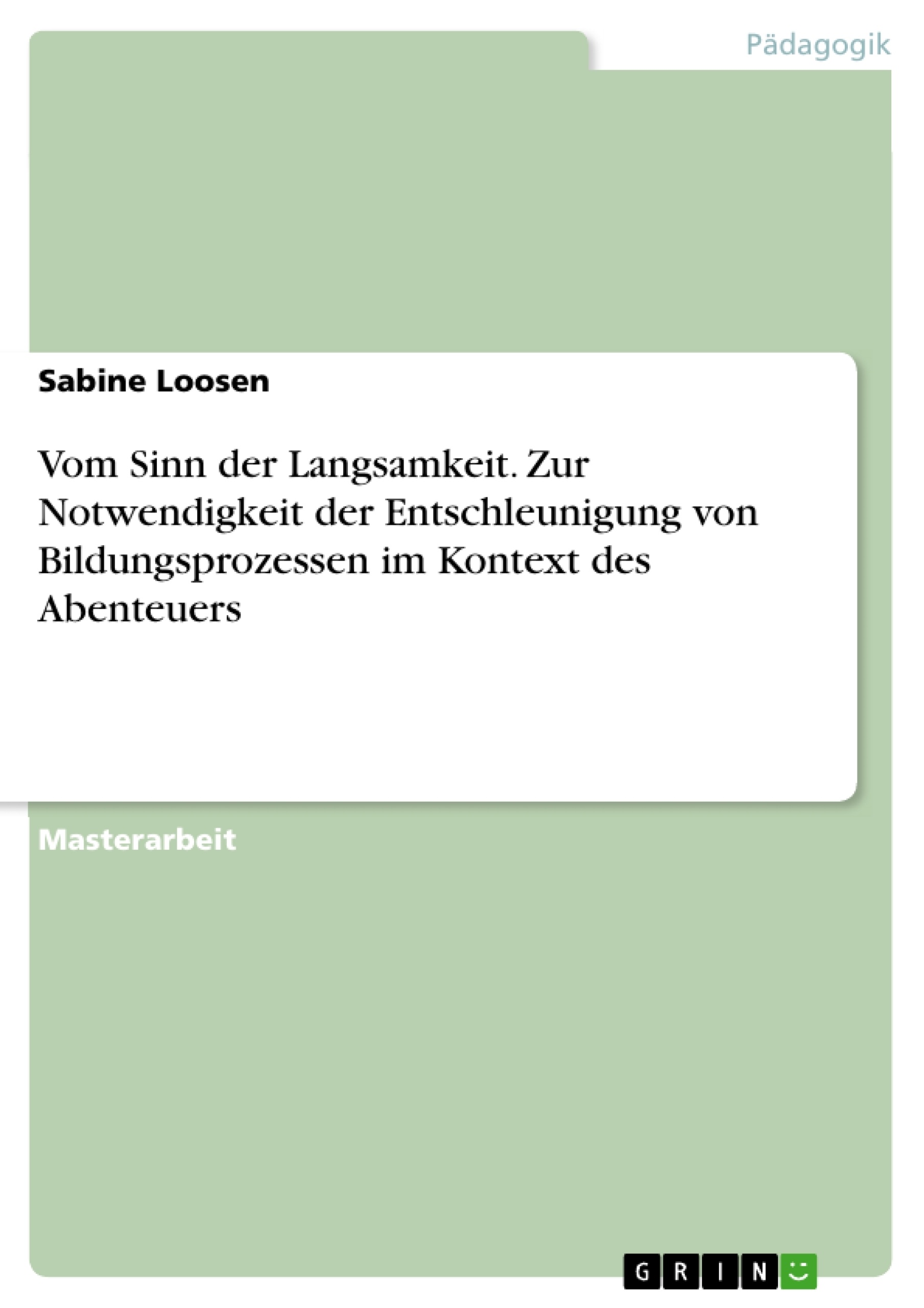Die heutige Gesellschaft zeichnet sich durch eine stetig zunehmende Komplexität und einen hohes Lebenstempo aus. Der Fortschritt treibt die Menschen als Mitglieder dieser Gesellschaft permanent voran und warnt vor dem Stehenbleiben. Immer mehr Handlungen in immer weniger Zeit quetschen, immer eine noch bessere Technik entwickeln, um noch mehr Zeit zu sparen – das ist die Prämisse. Am Ende, so die Utopie, bleibt mehr Zeit für schöne Dinge. Nur ist es paradox: Durch die Beschleunigung sämtlicher Handlungsabläufe bleibt am Ende eher das Gefühl, noch weniger geschafft zu haben und noch mehr unter Zeitdruck zu stehen. Diesen Zustand der akuten Zeitnot betiteln Kritiker spöttisch als angina temporis.
Hinter alledem steht die grundlegende Frage: Was ist Zeit eigentlich? „Gleichgültig ob Zeit nun philosophisch, psychologisch oder physikalisch betrachtet wird, sie zeigt stets das Moment von Veränderung an. Aspekte der Zeit kennzeichnen Vorgänge des Werdens und der Veränderung von Zuständen. Problem ist, daß der Mensch kein Sinnesorgan besitzt, mit welchem er Zeit wahrnehmen kann. So ist es nie möglich gewesen, zu definieren, was Zeit letztendlich ist“ (DEISEN 2002, 89).
Der Aussage Benjamin Franklins 'Zeit ist Geld' aus dem 18. Jahrhundert gilt heute mehr denn je. Denn Natur, Gesellschaft und Individuum unterliegen den Zwängen einer wirtschaftlichen Ordnung, die alles andere zu überlagern scheint und deren einziges Ziel es ist, das Wachstum voranzutreiben. Jedoch zeigt sich zunehmend, dass Natur und Individuum nicht in der Lage sind, der kapitalistischen Marktwirtschaft standzuhalten. Ressourcenschwund auf Seiten der Natur und Überforderung auf Seiten der Menschen lassen erkennen, dass sich die Gesellschaft ungehalten in eine Sackgasse manövriert, und das mit dem Befehl von ganz oben. So ist der Regierungserklärung von Angela Merkel aus dem Jahr 2009 folgendes zu entnehmen: „Wachstum zu schaffen, das ist das Ziel unserer Regierung. […] Ohne Wachstum keine Investitionen, ohne Wachstum keine Arbeitsplätze, ohne Wachstum keine Gelder für die Bildung, ohne Wachstum keine Hilfe für die Schwachen“ (DIE BUNDESREGIERUNG 2009). Die Natur ist nicht auf permanentes Wachstum angelegt, sondern funktioniert in Zyklen und braucht Zeit, sich zu regenerieren. Der Mensch braucht Zeit, individuell zu reifen. Beide verfügen über System- und Eigenzeiten, die nicht einfach aus den Angeln gehoben werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 In unserer Zeit
- 2.1 Formen sozialer Beschleunigung nach Rosa
- 2.2 Das zeitökologische Modell nach Reheis
- 2.2.1 Systemzeit, Eigenzeit, Elastizität
- 2.2.2 Ursache von Störungen in den Systemen
- 2.2.2.1 Natur
- 2.2.2.2 Gesellschaft
- 2.2.2.3 Individuum
- 3 Zeitgewinn und Selbstverlust
- 3.1 Zeiten des Körpers und der Psyche
- 3.2 Zeiten der Gesellschaft
- 3.3 Herausforderung für die Jugend
- 4 Bildung und Zeit
- 4.1 Bildung in einer sich beschleunigenden Gesellschaft – Status quo
- 4.2 Bildung in einer sich beschleunigenden Gesellschaft – Vision
- 4.3 Bildung braucht Zeit – Ein anderer Weg
- 4.3.1 Rosa
- 4.3.2 Adorno
- 4.3.3 Dörpinghaus
- 5 Zeit im Abenteuer
- 5.1 Abenteuermodell nach Becker
- 5.2 Das Abenteuer als Ort der Entschleunigung
- 5.2.1 Natur und Zeit
- 5.2.2 Raum und Zeit
- 5.2.3 Krise und Zeit
- 5.2.4 Gemeinschaft und Zeit
- 5.2.5 Alleinsein und Zeit
- 5.2.6 Fremde und Zeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Notwendigkeit der Entschleunigung von Bildungsprozessen im Kontext des Abenteuers. Sie beleuchtet die Auswirkungen der gesellschaftlichen Beschleunigung auf Individuen und insbesondere Jugendliche, und erforscht das Potential der Abenteuerpädagogik als Gegenmodell zur Beschleunigung und zur Förderung der individuellen Zeitgestaltung.
- Die Auswirkungen der sozialen Beschleunigung auf Individuum, Gesellschaft und Natur.
- Der Einfluss der Beschleunigung auf Bildungsprozesse und deren Herausforderungen.
- Das Konzept der Entschleunigung und seine Bedeutung für Bildung.
- Die Rolle der Abenteuerpädagogik als Methode zur Entschleunigung und zur Förderung der Selbstreflexion im Umgang mit Zeit.
- Die Erarbeitung eines alternativen Bildungsansatzes, der dem Wert der Langsamkeit Rechnung trägt.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der gesellschaftlichen Beschleunigung und deren Auswirkungen auf den Menschen ein. Sie stellt die zentrale Fragestellung nach einem konstruktiven Umgang mit Zeit im Kontext der Bildung vor und skizziert den Ansatz der Arbeit, Antworten im Kontext der Abenteuerpädagogik zu finden. Die Einleitung betont die paradoxe Situation, dass trotz des Strebens nach Zeitersparnis durch Beschleunigung, ein Gefühl der Zeitnot entsteht, und verweist auf die Notwendigkeit eines reflektierten Umgangs mit Zeit. Der Bezug auf Nietzsche und die Kritik an der „neuen Barbarei“ aufgrund von Ruhelosigkeit, sowie die Erwähnung des zeitökonomischen Denkens ("Zeit ist Geld") bilden den Ausgangspunkt der Auseinandersetzung.
2 In unserer Zeit: Dieses Kapitel analysiert die sozialen Formen der Beschleunigung nach Hartmut Rosa und integriert diese in das zeitökologische Modell von Reheis. Es beleuchtet die Wechselwirkungen zwischen den Systemen Natur, Gesellschaft und Individuum, und verdeutlicht deren Überforderung durch die beschleunigte Gesellschaft. Die verschiedenen Facetten der Beschleunigung werden detailliert betrachtet und die Folgen für die drei Systeme herausgestellt, um die aktuelle gesellschaftliche Situation und deren Komplexität zu verdeutlichen.
3 Zeitgewinn und Selbstverlust: Dieses Kapitel befasst sich mit den Auswirkungen der Beschleunigung auf den Einzelnen, indem es die verschiedenen Zeitaspekte im Leben des Menschen betrachtet. Es analysiert die Diskrepanz zwischen den Zeiten des Körpers und der Psyche, der Gesellschaft, und die besondere Herausforderung für die Jugend im Kontext der Beschleunigung. Die Kapitel verdeutlicht, wie der vermeintliche Zeitgewinn durch Beschleunigung zu Selbstverlust und einer zunehmenden Zeitnot führt und die daraus resultierenden Spannungsfelder zwischen den Anforderungen der Sozialisation und der Produktion beleuchtet werden.
4 Bildung und Zeit: Das Kapitel untersucht den Status quo und die Vision von Bildung in einer sich beschleunigenden Gesellschaft. Es zeigt die Herausforderungen auf, die sich aus dem Widerspruch zwischen der beschleunigten Gesellschaft und den Bedürfnissen individueller Bildungsprozesse ergeben. Anschließend werden alternative Bildungsansätze vorgestellt, die dem Wert der Langsamkeit und der Notwendigkeit von Zeit für Bildungsprozesse Rechnung tragen. Die Perspektiven von Rosa, Adorno und Dörpinghaus werden im Bezug auf Bildung und Zeit eingeordnet und diskutiert.
5 Zeit im Abenteuer: Das Kapitel erörtert die Bedeutung von Zeit im Kontext der Abenteuerpädagogik. Es integriert das Abenteuermodell nach Becker und untersucht das Abenteuer als einen Ort der Entschleunigung. Die Analyse fokussiert auf die verschiedenen Facetten der Zeitwahrnehmung im Abenteuer, u.a. in Bezug auf Natur, Raum, Krisen, Gemeinschaft, Alleinsein und Begegnungen mit Fremden. Es wird untersucht, wie das Erleben von Abenteuern den individuellen Umgang mit Zeit beeinflussen und zu einer bewussteren Zeitgestaltung beitragen kann.
Schlüsselwörter
Entschleunigung, Beschleunigung, Zeitökonomie, Bildung, Abenteuerpädagogik, Sozialisation, Produktion, Zeitwahrnehmung, Hartmut Rosa, Reheis, Jugend, Selbstreflexion, Zeitgestaltung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: [Titel der Arbeit einfügen]
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Notwendigkeit der Entschleunigung von Bildungsprozessen im Kontext des Abenteuers. Sie beleuchtet die Auswirkungen der gesellschaftlichen Beschleunigung auf Individuen, insbesondere Jugendliche, und erforscht das Potential der Abenteuerpädagogik als Gegenmodell zur Beschleunigung und zur Förderung der individuellen Zeitgestaltung.
Welche Theorien werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit bezieht sich auf die Theorien von Hartmut Rosa (soziale Beschleunigung) und Reheis (zeitökologisches Modell). Zusätzlich werden die Perspektiven von Adorno, Dörpinghaus und Becker (Abenteuermodell) in Bezug auf Bildung und Zeit eingeordnet und diskutiert.
Welche Aspekte der Beschleunigung werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der sozialen Beschleunigung auf Individuum, Gesellschaft und Natur. Sie beleuchtet den Einfluss der Beschleunigung auf Bildungsprozesse und die Herausforderungen, die sich daraus ergeben. Die verschiedenen Facetten der Beschleunigung, wie z.B. die Diskrepanz zwischen den Zeiten des Körpers und der Psyche, werden detailliert betrachtet.
Wie wird das Konzept der Entschleunigung behandelt?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Entschleunigung für Bildung und zeigt auf, wie ein alternativer Bildungsansatz entwickelt werden kann, der dem Wert der Langsamkeit Rechnung trägt. Die Rolle der Abenteuerpädagogik als Methode zur Entschleunigung und zur Förderung der Selbstreflexion im Umgang mit Zeit wird ebenfalls erörtert.
Welche Rolle spielt die Abenteuerpädagogik in der Arbeit?
Die Abenteuerpädagogik wird als Gegenmodell zur Beschleunigung und als Methode zur Förderung der individuellen Zeitgestaltung betrachtet. Die Arbeit analysiert das Abenteuer als Ort der Entschleunigung und untersucht die verschiedenen Facetten der Zeitwahrnehmung im Abenteuer (Natur, Raum, Krisen, Gemeinschaft, Alleinsein, Begegnungen mit Fremden).
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus fünf Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) führt in das Thema ein. Kapitel 2 ("In unserer Zeit") analysiert soziale Formen der Beschleunigung. Kapitel 3 ("Zeitgewinn und Selbstverlust") befasst sich mit den Auswirkungen der Beschleunigung auf den Einzelnen. Kapitel 4 ("Bildung und Zeit") untersucht Bildung in einer beschleunigten Gesellschaft und alternative Ansätze. Kapitel 5 ("Zeit im Abenteuer") erörtert die Bedeutung von Zeit im Kontext der Abenteuerpädagogik.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Entschleunigung, Beschleunigung, Zeitökonomie, Bildung, Abenteuerpädagogik, Sozialisation, Produktion, Zeitwahrnehmung, Hartmut Rosa, Reheis, Jugend, Selbstreflexion, Zeitgestaltung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit den Auswirkungen der gesellschaftlichen Beschleunigung auf Individuen und Bildungsprozesse auseinandersetzen. Sie ist insbesondere von Interesse für Pädagogen, Sozialwissenschaftler und alle, die an alternativen Bildungsansätzen interessiert sind.
- Citar trabajo
- Sabine Loosen (Autor), 2013, Vom Sinn der Langsamkeit. Zur Notwendigkeit der Entschleunigung von Bildungsprozessen im Kontext des Abenteuers, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281276