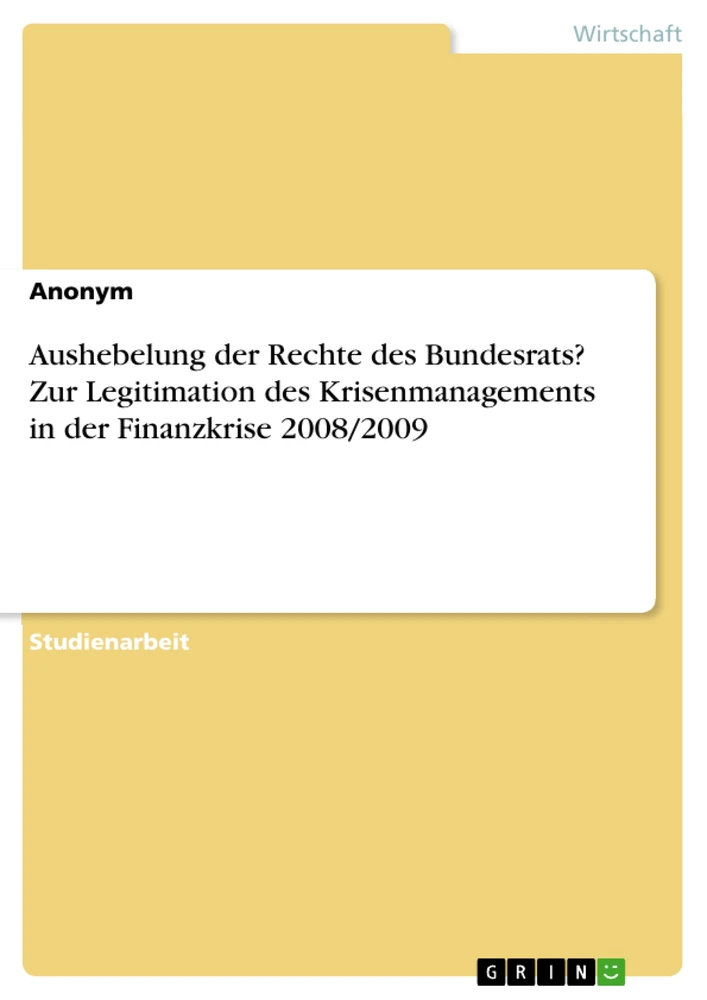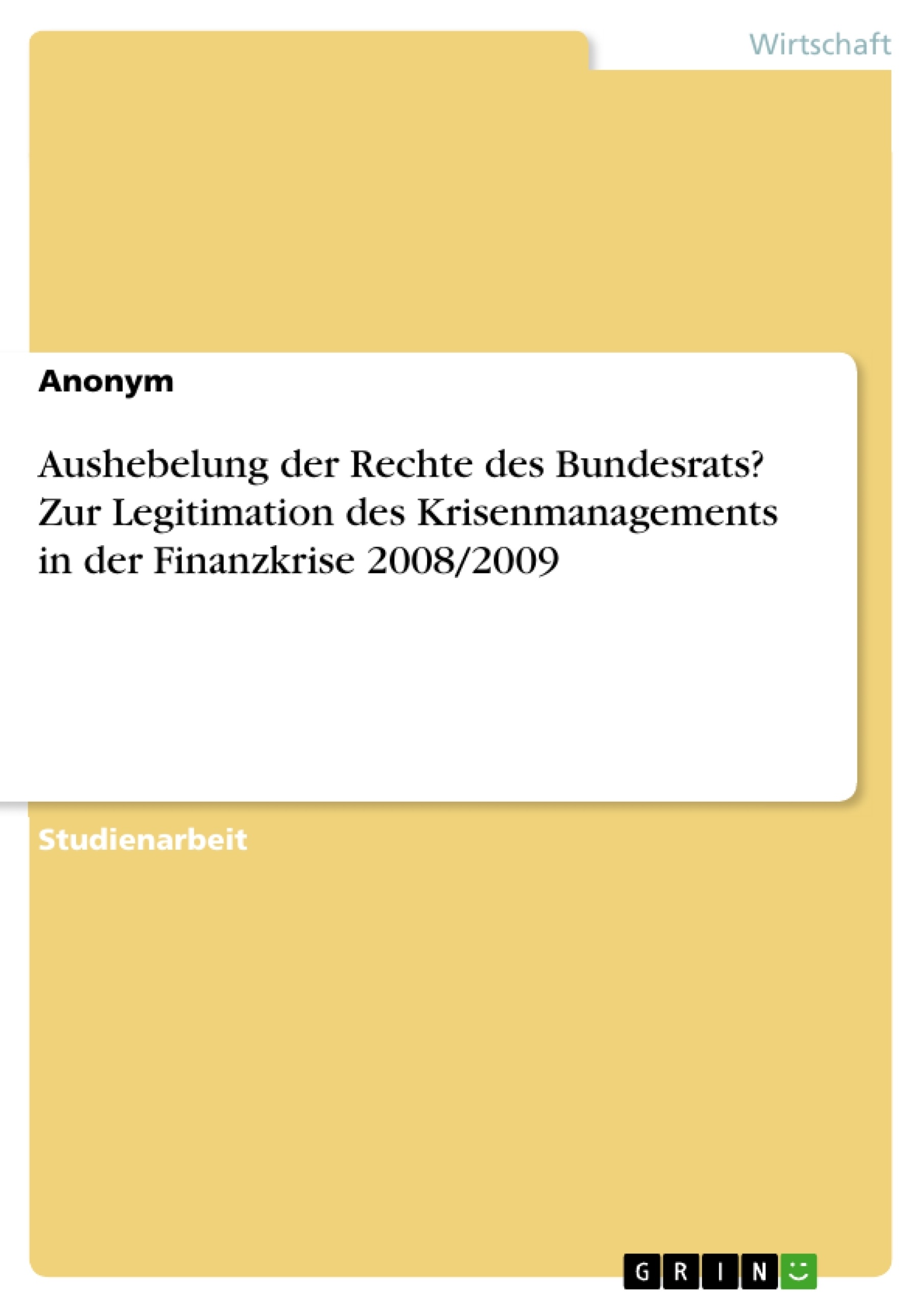Die Finanzkrise, die 2007 in den Vereinigten Staaten von Amerika ausbrach, hält die Welt noch heute in Atem. Wirtschaftseinbrüche, Bankenpleiten, Unternehmensschließungen; diese Nachrichten gehen seit nunmehr fünf Jahren täglich durch die Welt. Auch die Bundesrepublik Deutschland ist davon nicht verschont geblieben. Mit der drohenden Insolvenz der Bankenholding Hypo Real Estate ist die Krise auch in Deutschland angekommen. Fest stand: es muss gehandelt werden und zwar schnell. Die Entscheidung eine Bank zu retten, die nachweislich durch Misswirtschaft ihre Liquidität einbüßte, war keinesfalls unumstritten, doch war sie notwendig. Auch auf deutscher Mikroebene ist die Finanzwelt vernetzt, nicht nur auf dem Weltmarkt. Durch Termingeschäfte leihen sich die Banken untereinander über Nacht Geld, die die Millionenmarke sprengen können. Was passiert, wenn eines der wichtigsten Güter der Bankenwelt, das Vertrauen, einfach wegbricht (Steinbrück 2010: 173)? Die Antwort liegt nahe: gerade kleinere Banken würden sehr unter dem Umstand leiden, dass sie von einem Tag auf den anderen illiquide sein könnten. Wenn eine Bank fällt, so folgen andere. Das Bankensystem könnte einstürzen wie ein Kartenhaus, Anleger könnten ihre Spareinlagen abziehen. Bilder von hunderten, vor Bankenhäusern wartenden Menschen, wie wir sie von der Weltwirtschaftskrise aus dem Jahr 1929 kennen, waren wieder denkbar. Also entschied sich die Bundesregierung, zusammen mit der Legislative und der deutschen Finanzwirtschaft, die Hypo Real Estate mit einem Gesamtvolumen von 50 Milliarden Euro vor der Insolvenz zu bewahren. In der Bevölkerung zeichnete sich Unbehagen ab. Warum fließen Milliarden Euro in die Rettung der Schädiger der Krise und nicht zu den Geschädigten (Steinbrück 2010: 191)? Doch genau dies versuchte die Regierung mit ihren Gesetzesentwürfen zum Finanzmarktstabilisierungsgesetz und zu den Konjunkturpaketen I und II zu erreichen: das Übergreifen der Finanzkrise auf die deutsche Realwirtschaft zu vermeiden. In den Jahren 2008 und 2009 wurden Gesetzespakete geschnürt, die Politik und Wirtschaftswissenschaftler gespannt beobachteten, denn sie wurden in nicht bekannter Verfahrenskürze erlassen.
Das Ziel dieser Abhandlung besteht darin zu überprüfen ob die Beteiligung des Bundesrats an dem parlamentarischen Gesetzgebungsverfahren während der Finanzkrise 2008/2009 rein formaler Natur war und im Laufe dieser Entwicklungen die Rechte des Bundesrats ausgehebelt wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Legitimationslogik nach Jürgen Habermas
- Formale Mitwirkungsrechte des Bundesrats im Gesetzgebungsprozess
- Finanzmarktstabilisierungsgesetz
- Konjunkturpakete I und II
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abhandlung analysiert die Rolle des Bundesrats im parlamentarischen Gesetzgebungsprozess während der Finanzkrise 2008/2009. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Rechte des Bundesrats bei der Ausarbeitung des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes und der Konjunkturpakete I und II ausgehebelt wurden oder ob eine substantielle Mitwirkung stattfand. Die Analyse stützt sich auf die Legitimationslogik von Jürgen Habermas.
- Die Mitwirkungsrechte des Bundesrats im Gesetzgebungsprozess
- Die Legitimationslogik von Jürgen Habermas
- Die Ausgestaltung des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes
- Die Inhalte der Konjunkturpakete I und II
- Die Legitimität der Gesetzgebungsprozesse während der Finanzkrise
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz der Finanzkrise 2008/2009 und ihre Auswirkungen auf Deutschland dar. Sie führt die Rettungsaktionen der Bundesregierung ein, insbesondere die Rettung der Hypo Real Estate, und beleuchtet die damit verbundenen Herausforderungen und Kontroversen.
Legitimationslogik nach Jürgen Habermas
Dieses Kapitel präsentiert die Legitimationslogik von Jürgen Habermas und ihre Bedeutung für die Beurteilung des Gesetzgebungsprozesses während der Finanzkrise. Es erläutert die Grundannahmen der Habermas'schen Theorie, wie die Kraft der Argumentation, die "Grundnorm der vernünftigen Rede" und die Prinzipien des vernünftigen Diskurses.
Formale Mitwirkungsrechte des Bundesrats im Gesetzgebungsprozess
Dieses Kapitel untersucht die formalen Mitwirkungsrechte des Bundesrats im deutschen Gesetzgebungssystem. Es differenziert zwischen Grundgesetzänderungen, Zustimmungsgesetzen und Einspruchsgesetzen und erklärt die jeweiligen Mehrheitsverhältnisse und Entscheidungsmechanismen. Zudem werden die zeitlichen Rahmenbedingungen für die Verhandlungen, wie z. B. die Frist von sechs Wochen für Stellungnahmen des Bundesrats, erläutert.
Schlüsselwörter
Finanzkrise, Gesetzgebungsprozess, Legitimationslogik, Jürgen Habermas, Bundesrat, Bundestag, Finanzmarktstabilisierungsgesetz, Konjunkturpakete, Mitwirkungsrechte, Grundgesetz, Gewaltenteilung, Argumentation, Kommunikation, Verfahrenskürze, Substantielle Mitwirkung, Formale Mitwirkung
Häufig gestellte Fragen
Wurden die Rechte des Bundesrats in der Finanzkrise 2008/2009 ausgehebelt?
Die Arbeit untersucht, ob die Mitwirkung des Bundesrats bei Gesetzen wie dem Finanzmarktstabilisierungsgesetz aufgrund der extremen Eilbedürftigkeit nur formaler Natur war oder ob eine substantielle Beteiligung stattfand.
Was besagt die Legitimationslogik von Jürgen Habermas?
Habermas betont die Kraft der Argumentation und den vernünftigen Diskurs. Ein Gesetz ist dann legitim, wenn es in einem Verfahren zustande kommt, das auf rationaler Debatte und nicht nur auf Zeitdruck basiert.
Was war das Ziel der Konjunkturpakete I und II?
Diese Gesetzespakete sollten verhindern, dass die globale Finanzkrise auf die deutsche Realwirtschaft übergreift, indem sie Investitionen förderten und die Binnennachfrage stabilisierten.
Warum musste die Hypo Real Estate gerettet werden?
Wegen der engen Vernetzung der Bankenwelt hätte eine Insolvenz einen Dominoeffekt („Kartenhaus“) auslösen können, der das gesamte Bankensystem und die Ersparnisse der Bürger gefährdet hätte.
Welche Fristen gelten normalerweise für den Bundesrat?
Im regulären Gesetzgebungsverfahren hat der Bundesrat eine Frist von sechs Wochen für Stellungnahmen. Während der Krise wurden diese Fristen durch Verfahrenskürzungen massiv unterschritten.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2012, Aushebelung der Rechte des Bundesrats? Zur Legitimation des Krisenmanagements in der Finanzkrise 2008/2009, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281293