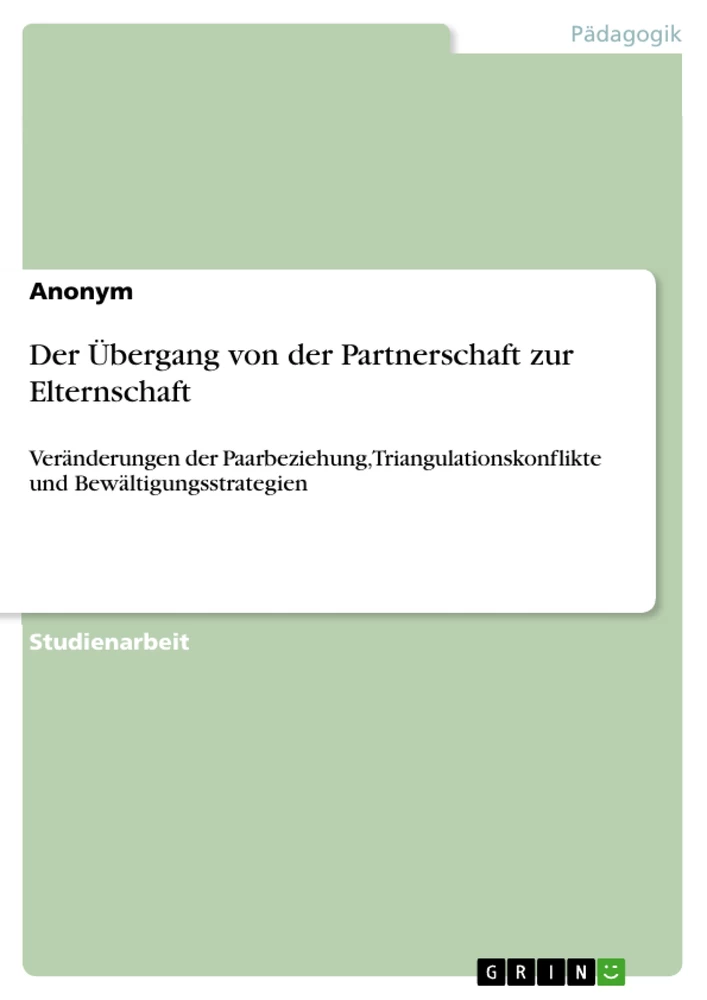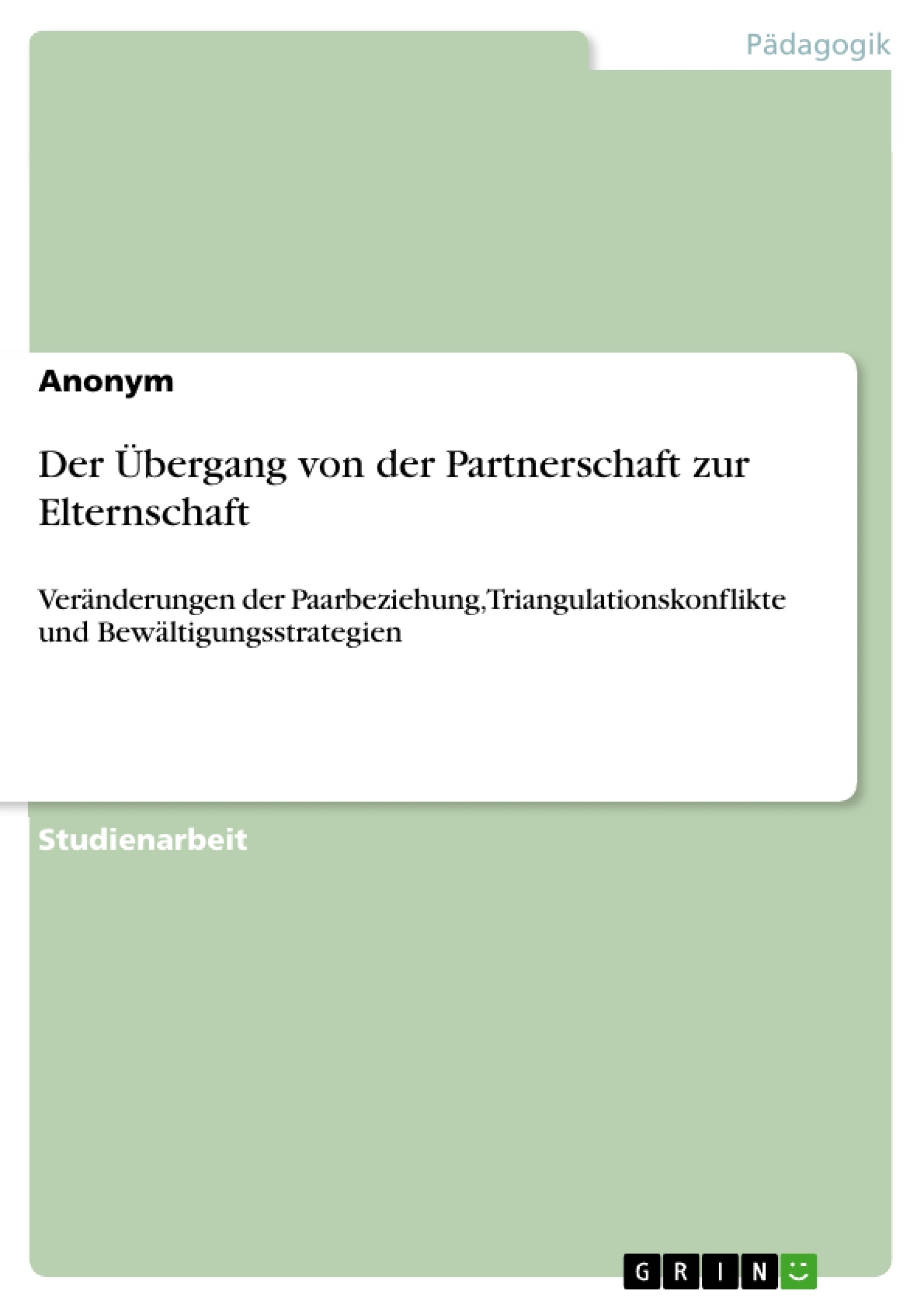Die meisten Paare erwarten sich durch die Geburt ihres ersten Kindes in erster Linie einen persönlichen Gewinn, große Freunde und Selbstverwirklichung. Empirische Befunde belegen jedoch, dass der Übergang von der Partnerschaft zur Elternschaft mit einer starken Umstellung des gewohnten Alltags einhergeht und eine enorme Anpassungsleistung der Eltern erfordert.
Die vorliegende Arbeit beabsichtigt Probleme und Veränderungen aufzuzeigen, welche sich bei der Geburt eines Kindes innerhalb einer Partnerschaft ergeben können. Darüber hinaus werden Erklärungsversuche dieser Veränderungen dargestellt und Bewältigungsstrategien angeboten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Veränderungen der Partnerschaft nach der Erstkindgeburt
- Phasenmodell nach Gloger Tippelt (1988)
- Modell der Partnerschaftsentwicklung nach Kalicki u.a.
- Belastungen und Triangulationskonflikte im Übergang zur Elternschaft
- Bedingungen für Triangulationskonflikte
- Veränderungen der Partnerschaftsqualität
- Bewältigung von Triangulationskonflikten
- Dyadisches Coping
- Kommunikation
- Das Abgrenzungsprinzip
- Progressives und regressives Abwehrverhalten
- Partnerschaftliche Ressourcen
- Implikation für die Praxis
- Fazit
- Abbildungsverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen und Veränderungen, die der Übergang von der Partnerschaft zur Elternschaft mit sich bringt. Sie analysiert die Auswirkungen der Geburt eines Kindes auf die Paarbeziehung, insbesondere die Entstehung von Triangulationskonflikten und die Entwicklung von Bewältigungsstrategien. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tieferes Verständnis für die komplexen Prozesse im Übergang zur Elternschaft zu entwickeln und praktische Handlungsempfehlungen für Paare in dieser Lebensphase zu geben.
- Phasen der Elternschaftsentwicklung
- Triangulationskonflikte in der Paarbeziehung
- Bewältigungsstrategien für Triangulationskonflikte
- Partnerschaftliche Ressourcen im Übergang zur Elternschaft
- Implikationen für die Praxis der Familienberatung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik des Übergangs von der Partnerschaft zur Elternschaft vor und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Sie beleuchtet die Bedeutung des Themas und die Notwendigkeit, die Herausforderungen und Veränderungen in dieser Lebensphase zu verstehen.
Das Kapitel "Veränderungen der Partnerschaft nach der Erstkindgeburt" analysiert die Auswirkungen der Geburt eines Kindes auf die Paarbeziehung. Es werden verschiedene Modelle zur Beschreibung der Phasen der Elternschaftsentwicklung vorgestellt, darunter das Phasenmodell nach Gloger-Tippelt (1988) und das Modell der Partnerschaftsentwicklung nach Kalicki u.a. Diese Modelle bieten einen Rahmen, um die Veränderungen in der Paarbeziehung im Kontext der Elternschaft zu verstehen.
Das Kapitel "Belastungen und Triangulationskonflikte im Übergang zur Elternschaft" befasst sich mit den Herausforderungen, die die Eltern in dieser Phase bewältigen müssen. Es werden die Bedingungen für Triangulationskonflikte in der Paarbeziehung analysiert und die Auswirkungen dieser Konflikte auf die Partnerschaftsqualität untersucht.
Das Kapitel "Bewältigung von Triangulationskonflikten" stellt verschiedene Strategien vor, die Paare zur Bewältigung von Konflikten im Übergang zur Elternschaft nutzen können. Es werden dyadisches Coping, Kommunikation, das Abgrenzungsprinzip, progressives und regressives Abwehrverhalten sowie partnerschaftliche Ressourcen als wichtige Faktoren für die Bewältigung von Triangulationskonflikten betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Übergang von der Partnerschaft zur Elternschaft, die Veränderungen der Paarbeziehung, Triangulationskonflikte, Bewältigungsstrategien, dyadisches Coping, Kommunikation, Abgrenzungsprinzip, partnerschaftliche Ressourcen und Implikationen für die Praxis der Familienberatung. Der Text beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sich für Paare im Übergang zur Elternschaft ergeben, und bietet praktische Handlungsempfehlungen für die Bewältigung von Konflikten und die Stärkung der Partnerschaft.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Der Übergang von der Partnerschaft zur Elternschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281458