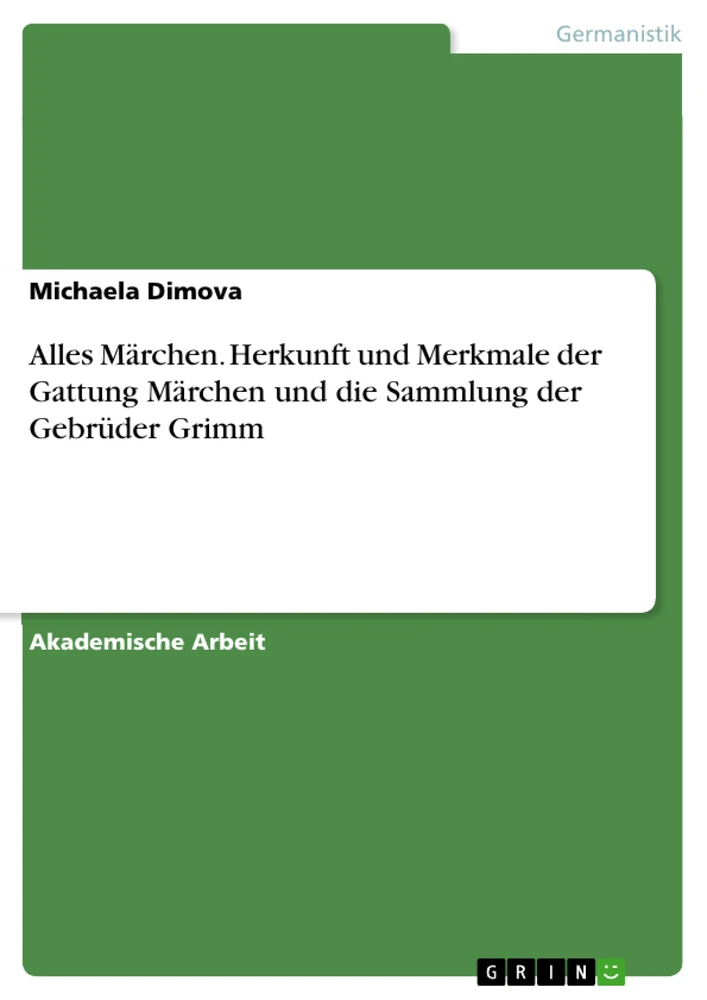Das Wort ʺMärchenʺ ist eine Verkleinerungsform des mittelhochdeutschen Begriffs maere und bedeutet so viel wie Gerücht, Erzählung oder Bericht. Unter maere wurden ursprünglich gesprochene, vorgetragene Erzähltexte unterschiedlicher Art verstanden. Im Spätmittelalter wurde das Wort enger gefasst. Seit Herder und den Brüdern Grimm verstehen wir darunter eine mit dichterischer Phantasie entworfene Erzählung besonders aus der Zauberwelt, eine nicht an die Bedingungen des wirklichen Lebens geknüpfte wunderbare Geschichte, die hoch und niedrig mit Vergnügen anhören, auch wenn sie diese unglaublich finden.
Aus dem Inhalt:
- Ursprung des Märchens
- Volksmärchen
- Märchensammlung der Gebrüder Grimm
- Einflüsse auf die Kinder- und Hausmärchen
- die Märchenbeiträgerinnen
Inhaltsverzeichnis
- Zum Begriff "Märchen"
- Ursprung des Märchens
- Merkmale der Gattung Märchen
- Über,,Kinder- und Hausmärchen“
- Das Volksmärchen
- Die Märchensammlung der Brüder Grimm
- Einflüsse auf die Entstehung der KHM
- Überzeugungssystem
- Die Märchenbeiträgerinnen
- Grimms Märchen
- Die Märchensammlung als Erziehungsbuch
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Gattung des Märchens, insbesondere mit seiner Herkunft, seinen charakteristischen Merkmalen und der Bedeutung der Sammlung der Brüder Grimm. Die Untersuchung zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis für das Märchen als literarische Gattung zu entwickeln und seinen Einfluss auf die deutsche Kulturgeschichte zu beleuchten.
- Die Entwicklung des Begriffs "Märchen" und seine unterschiedlichen Definitionen
- Die Ursprünge des Märchens und seine Verbindung zu Mythos und Epos
- Die spezifischen Merkmale der Gattung Märchen und ihre Abgrenzung zu anderen Erzählformen
- Die Entstehung und Bedeutung der Märchensammlung der Brüder Grimm
- Die Rolle des Märchens als kulturelles und pädagogisches Element
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des Begriffs "Märchen" und seinen verschiedenen Definitionen im Laufe der Zeit. Es beleuchtet die unterschiedlichen Konnotationen des Wortes und stellt verschiedene Ansätze der Märchenforschung vor.
Kapitel zwei untersucht die Ursprünge des Märchens und seine Verbindung zu anderen Formen der mündlichen Überlieferung. Es analysiert die verschiedenen Quellen des Märchens, wie z. B. Mythos, Epos und Volkslied, und zeigt die Herausforderungen bei der Bestimmung seines genauen Alters.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den spezifischen Merkmalen der Gattung Märchen. Es definiert die gattungsspezifischen Elemente des Märchens und grenzt es von anderen Erzählformen ab. Die Analyse konzentriert sich auf das Wunderhafte, die Typisierung und die symbolische Bedeutung von Märchen.
Das vierte Kapitel analysiert die Entstehung und Bedeutung der Märchensammlung der Brüder Grimm. Es beleuchtet die Einflüsse auf die Entstehung der Sammlung, die Überzeugungssysteme der Brüder Grimm sowie die Rolle der Märchenbeiträgerinnen.
Schlüsselwörter
Märchen, Volksmärchen, Brüder Grimm, Kinder- und Hausmärchen, Gattung, Merkmale, Herkunft, Ursprung, Mythos, Epos, Überlieferung, Symbolik, Zauber, Wunder, Übernatürliches, Erziehungsbuch, Kulturgeschichte.
- Quote paper
- Michaela Dimova (Author), 2008, Alles Märchen. Herkunft und Merkmale der Gattung Märchen und die Sammlung der Gebrüder Grimm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281567