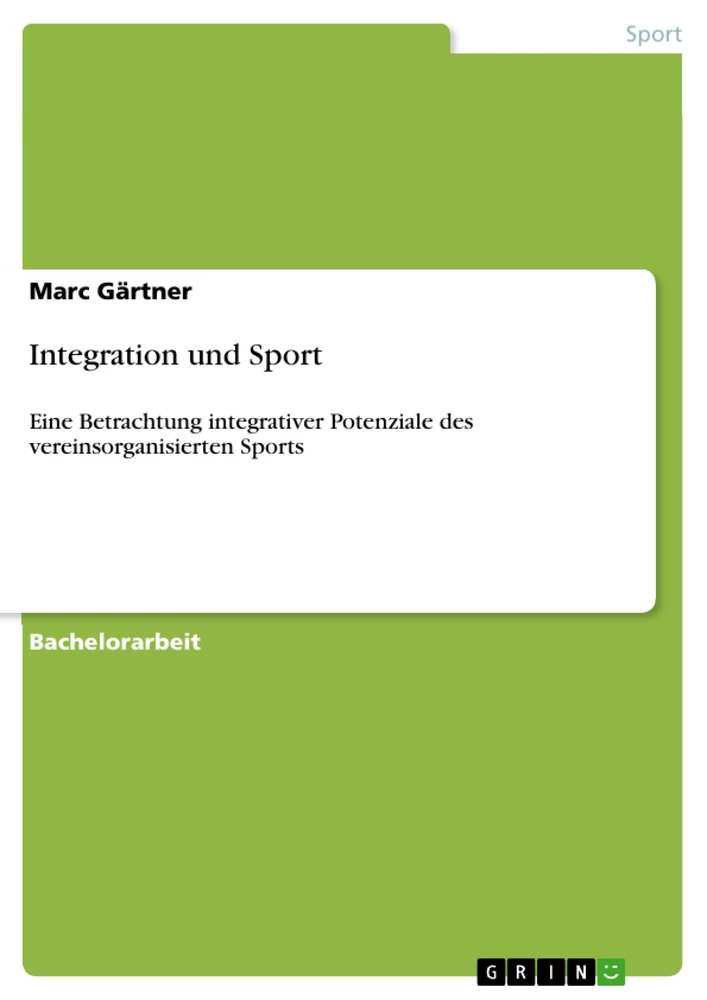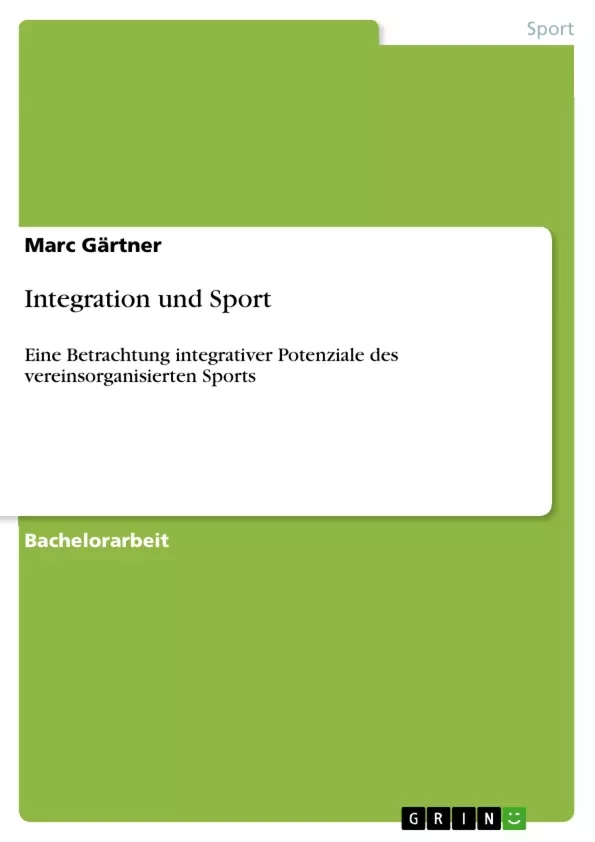Die olympische Idee und die hier implizierte Vorstellung von Sport versinnbildlichen die gesellschaftsrelevanten Potenziale, die mit sportlichem Miteinander in Zusammenhang stehen und gebracht werden. Sport gilt dabei auch über den Rahmen der olympischen Bewegung hinaus gemeinhin als verbindendes Moment, dadurch, dass er als Raum begriffen wird, in dem Begegnungen möglich sind und Brücken zwischen Menschen gebaut werden können, ohne dass individuelle sprachliche, kulturelle und soziale Hintergründe auf den ersten Blick eine Rolle spielen. Ausgehend von dieser Erwartungshaltung wird Sport mit einer besonderen integrativen Wirkung verbunden, die es ermöglicht, ein gleichberechtigtes gesellschaftliches Zusammenleben zu fördern.
Allerdings kommt es im sportpolitischen Diskurs um Vorteile, die Sport für Integrationsprozesse mit sich bringen kann, nicht selten zu einer Verklärung (vgl. Braun/Nobis, 2011, 13). Die in diesem Zusammenhang zum Teil kommunizierte These einer uneingeschränkten, integrativen Wirkung des Vereinssports ist undifferenziert und idealisierend. Auf Einschränkungen solcher integrativer Möglichkeiten wird auch im wissenschaftlichen Diskurs in den letzten Jahren mit zunehmender Deutlichkeit hingewiesen (vgl. Braun/Finke, 2010, 7).
Im Zuge dieser Erkenntnis will die vorliegende Arbeit sich mit der Fragestellung auseinandersetzen, unter welchen Bedingungen der Sport in Vereinen Potenziale der Integration eröffnen kann.Es soll untersucht werden, unter welchen Voraussetzungen in Sportvereinen eine gleichberechtigte integrative Teilhabe stattfinden kann, wodurch wiederum Möglichkeiten einer weiterführenden Integration über den Vereinssport hinaus initiiert werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- 1 Einleitung und Formulierung der Fragestellung
- 2 Integration und Sport - Theoretische Hinführung
- 2.1 Integration - Begriffsklärung
- 2.1.1 Der Integrationsbegriff nach Hartmut Esser
- 2.1.1.1 Allgemeine Definition
- 2.1.1.2 Sozialintegration
- 2.1.2 Diskussion des Integrationsbegriffs
- 2.1.2.1 Kritik am Integrationsbegriff verstanden als Integrationsimperativ im Bezugsrahmen des Nationalstaats
- 2.1.2.2 Kritische Auseinandersetzung im Zusammenhang mit der sportbezogenen Integrationsforschung
- 2.1.1 Der Integrationsbegriff nach Hartmut Esser
- 2.2 Der vereinsorganisierte Sport als mögliche Plattform der Integration
- 2.2.1 Analytische Ausdifferenzierung integrativer Potenziale des Vereinssports
- 2.2.1.1 Binnen- und außenintegrative Wirkungsweisen des Vereinssports
- 2.2.1.2 Betrachtung entlang der Formen der Sozialintegration nach Esser
- 2.2.2 Der Vereinssport als Möglichkeit, nicht als Garantie, der Integration
- 2.2.2.1 Kulturelle Unterschiede im Umgang mit Körperlichkeit
- 2.2.2.2 Fehlende Vertrautheit mit dem deutschen Vereinswesen
- 2.2.1 Analytische Ausdifferenzierung integrativer Potenziale des Vereinssports
- 2.1 Integration - Begriffsklärung
- 3 Forschungsstand der sportbezogenen Integrationsforschung
- 3.1 Überblick
- 3.2 Forschungsstand hinsichtlich der interkulturellen Öffnung von Sportvereinen
- 4 Interviewauswertung
- 4.1 Darstellung des Hintergrunds und Rahmens der geführten Interviews
- 4.2 Methodischer Teil
- 4.3 Ergebnisdarstellung und -analyse
- 4.4 Zusammenfassung
- 4.5 Fazit
- Literatur
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Frage, unter welchen Bedingungen der vereinsorganisierte Sport Potenziale der Integration eröffnen kann. Ziel ist es, die Voraussetzungen für eine gleichberechtigte integrative Teilhabe in Sportvereinen zu untersuchen und aufzuzeigen, wie diese Möglichkeiten einer weiterführenden Integration über den Vereinssport hinaus initiieren können.
- Der Integrationsbegriff nach Hartmut Esser als theoretischer Rahmen
- Der vereinsorganisierte Sport als Plattform der Integration
- Analytische Ausdifferenzierung integrativer Potenziale des Vereinssports
- Herausforderungen und Einschränkungen integrativer Prozesse im Vereinssport
- Forschungsstand der sportbezogenen Integrationsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2.1 erläutert den Integrationsbegriff nach Hartmut Esser, der als theoretischer Rahmen für die Arbeit dient. Es werden die allgemeine Definition und die verschiedenen Formen der Sozialintegration nach Esser dargestellt. Anschließend wird der Integrationsbegriff kritisch diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Kritik am Integrationsimperativ im Bezugsrahmen des Nationalstaats und die spezifischen Herausforderungen im Kontext der sportbezogenen Integrationsforschung.
Kapitel 2.2 untersucht den vereinsorganisierten Sport als mögliche Plattform der Integration. Es werden die analytischen Ausdifferenzierungen integrativer Potenziale des Vereinssports, sowohl in Bezug auf binnen- als auch außenintegrative Wirkungsweisen, dargestellt. Die Betrachtung erfolgt entlang der Formen der Sozialintegration nach Esser. Darüber hinaus werden die Grenzen und Herausforderungen des Vereinssports als Integrationsinstrument beleuchtet, insbesondere im Hinblick auf kulturelle Unterschiede im Umgang mit Körperlichkeit und die fehlende Vertrautheit mit dem deutschen Vereinswesen.
Kapitel 3 bietet einen Überblick über den Forschungsstand der sportbezogenen Integrationsforschung, insbesondere im Hinblick auf die interkulturelle Öffnung von Sportvereinen.
Kapitel 4 präsentiert die Auswertung von Interviews mit einer Mitarbeiterin des Programms „Integration durch Sport“ und einem Vertreter eines Hamburger Sportvereins, der in dieses Programm eingebunden ist. Die Interviews beleuchten die praktische Umsetzung von Integrationsmaßnahmen im Sport und die Herausforderungen, die sich dabei stellen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Integration, Sport, Vereinssport, Integrationsforschung, interkulturelle Öffnung, Migrationshintergrund, Sozialintegration, Hartmut Esser, Inklusion, Partizipation, Gleichberechtigung, Sportvereine, Sportpolitik, Integrationsmaßnahmen, interkulturelle Kompetenz, kulturelle Unterschiede, Vereinswesen, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Wie fördert Sport die soziale Integration?
Sport gilt als Raum für Begegnungen, in dem sprachliche und kulturelle Hintergründe oft in den Hintergrund treten und Brücken gebaut werden können.
Was besagt der Integrationsbegriff nach Hartmut Esser?
Esser unterscheidet verschiedene Formen der Sozialintegration, die als theoretischer Rahmen für die Analyse integrativer Potenziale im Sport dienen.
Warum ist Vereinssport keine Garantie für Integration?
Kulturelle Unterschiede im Umgang mit Körperlichkeit und mangelnde Vertrautheit mit dem deutschen Vereinswesen können Hürden für Migranten darstellen.
Was versteht man unter "interkultureller Öffnung" von Sportvereinen?
Es bezeichnet den Prozess, Vereine strukturell und personell so auszurichten, dass sie für Menschen mit Migrationshintergrund attraktiver und zugänglicher werden.
Welche Rolle spielt das Programm "Integration durch Sport"?
Das Programm unterstützt Vereine bei der praktischen Umsetzung von Integrationsmaßnahmen, was in der Arbeit durch Experteninterviews beleuchtet wird.
- Citar trabajo
- Marc Gärtner (Autor), 2014, Integration und Sport, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281797