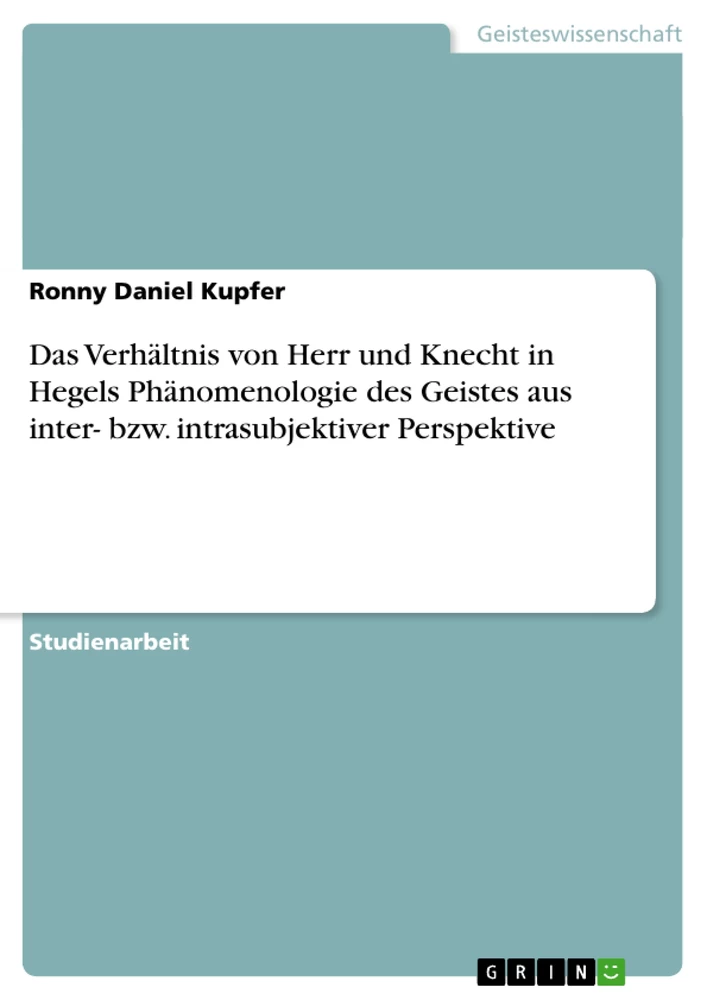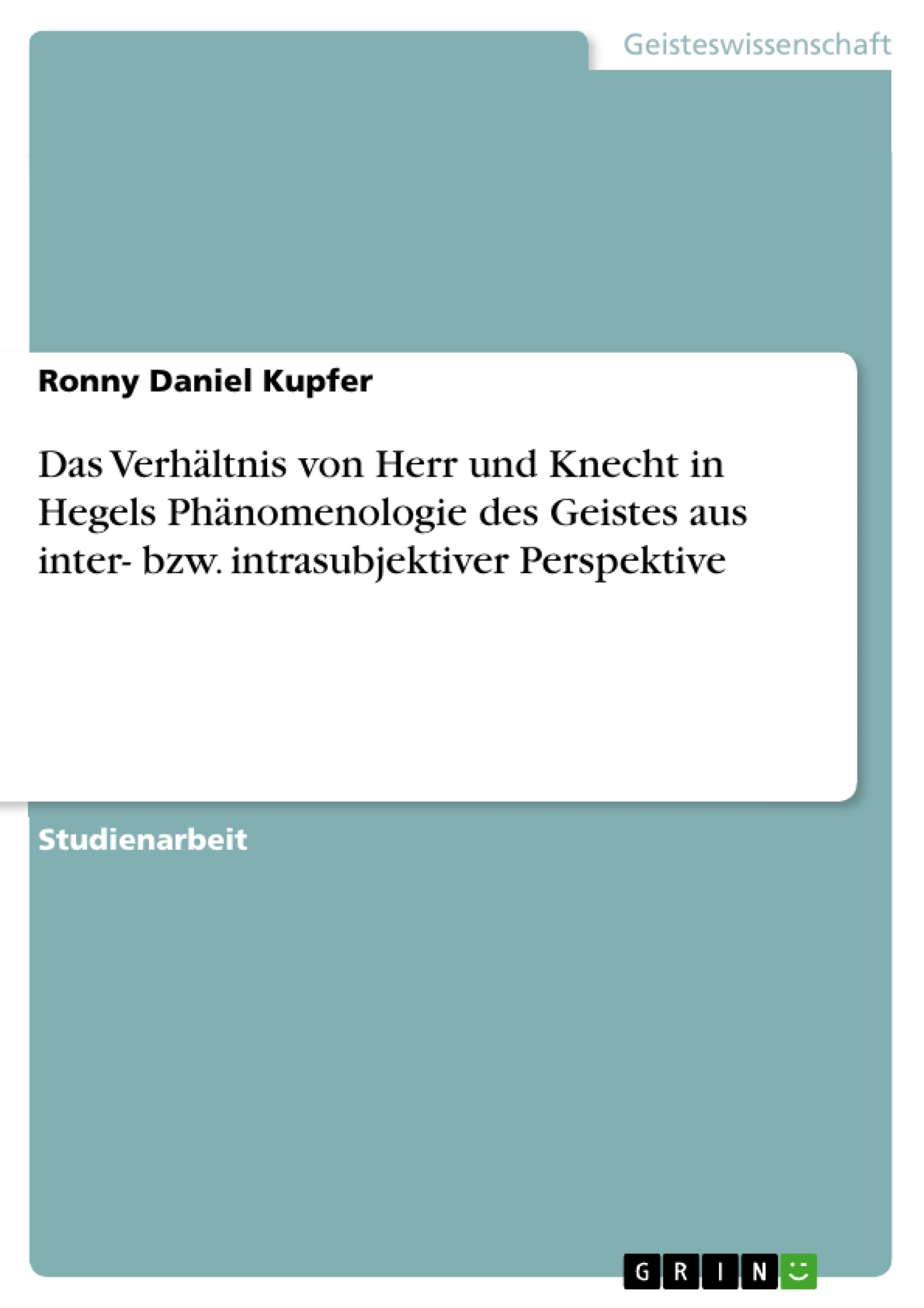In dieser Arbeit wird der Versuch unternommen, das als sehr schwer lesbar geltende vierte Kapitel aus Hegels Phänomenologie des Geistes (kurz: PdG), genauer die Passagen zur Selbstständigkeit und Unselbstständigkeit des Selbstbewusstseins, speziell und explizit entlang der Begriffe von Herrschaft und Knechtschaft, mithilfe zweier Lesarten zu erschließen. Freilich kann der Originaltext Hegels hier nicht im Detail interpretiert werden, auch wenn die Absicht dazu (im Sinne einer Kritik der zu vergleichenden Lesarten) zunächst angedacht war, würde dieser Ansatz den Rahmen der Arbeit um ein vielfaches übersteigen. Darum wird eine Betrachtung der Problematik von Herrschaft und Knechtschaft überwiegend durch die zu verwendenden Sekundärtexte erfolgen, wobei der Primärtext (die PdG; speziell das oben genannte Kapitel) vorausgesetzt und an Schlüsselstellen auch entsprechend eingearbeitet wird.
Die beiden Lesarten, die vorzustellen das primäre Ziel dieser Arbeit ist, stehen in einem gewissen Spannungsverhältnis zueinander. Es handelt sich bei den beiden Deutungen/ Lesarten zum einen um eine „intersubjektive“ und zum anderen um eine „intrasubjektive“ Perspektive auf das Verhältnis von Herr (bzw. Herrschaft) und Knecht (bzw. Knechtschaft). Das heißt, dass der Kampf um Anerkennung respektive das Verhältnis der beiden näher zu bestimmenden Größen von Herr und Knecht, den Hegel beschreibt, als Kampf verschiedener Subjekte mit- und gegeneinander (intersubjektive Lesart/ Perspektive) oder als Kampf innerhalb eines Subjektes bzw. einer Person (intrasubjektive Lesart/ Perspektive) gedeutet wird.
Die beiden Perspektiven werden hier exemplarisch vertreten bzw. im Sinne dieser Arbeit vergleichend zunächst gegeneinander positioniert; von Axel Honneth mit seinem Werk Kampf um Anerkennung1 und Pirmin Stekeler-Weithofer mit seinem Werk Philosophie des Selbstbewusstseins2. Ziel dieser Gegenüberstellung ist die Herausarbeitung der systematischen Differenzen beider Ansätze und die Bewertung/ Beurteilung des eventuell auffindbaren (zu explizierenden) philosophischen Gewinns bzw. Verlusts, welcher durch die jeweilige perspektivische Verkürzung oder Erweiterung zu erwarten ist. Wobei zu erwähnen bleibt, dass auch andere Philosophen (gerade für den Fall der intersubjektiven Deutung/ Lesart) für diese Zwecke hätten herangezogen werden können – hier wurde eine repräsentative, zumindest aber eine für die Zwecke dieser Arbeit dienliche Auswahl getroffen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Das Verhältnis von Herr und Knecht aus intersubjektiver Perspektive
- 1.1. Der Kampf um Anerkennung bei Axel Honneth
- 1.2. Das intersubjektive Verhältnis von Herr und Knecht
- 2. Das Verhältnis von Herr und Knecht aus intrasubjektiver Perspektive
- 2.1. Philosophie des Selbstbewusstseins von Pirmin Stekeler-Weithofer
- 2.2. Das intrasubjektive Verhältnis von Herr und Knecht
- 3. Kritik beider Lesarten und Versuch einer Synthese
- Zusammenfassung und Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Verhältnis von Herr und Knecht in Hegels Phänomenologie des Geistes aus zwei Perspektiven: der intersubjektiven und der intrasubjektiven. Ziel ist es, die systematischen Differenzen beider Ansätze herauszuarbeiten und den philosophischen Gewinn bzw. Verlust zu bewerten, der durch die jeweilige perspektivische Verkürzung oder Erweiterung entsteht.
- Intersubjektive Perspektive: Kampf um Anerkennung zwischen verschiedenen Subjekten
- Intrasubjektive Perspektive: Kampf innerhalb eines Subjektes
- Vergleich der beiden Lesarten
- Kritik und Synthese beider Ansätze
- Philosophische Bedeutung des Verhältnisses von Herr und Knecht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik des Verhältnisses von Herr und Knecht in Hegels Phänomenologie des Geistes vor und erläutert die beiden zu vergleichenden Lesarten: die intersubjektive und die intrasubjektive Perspektive.
Das erste Kapitel behandelt die intersubjektive Perspektive, die von Axel Honneth in seinem Werk „Kampf um Anerkennung“ vertreten wird. Honneth argumentiert, dass der Kampf um Anerkennung zwischen verschiedenen Subjekten stattfindet und die Grundlage für eine normativ gehaltvolle Gesellschaftstheorie bildet.
Das zweite Kapitel widmet sich der intrasubjektiven Perspektive, die von Pirmin Stekeler-Weithofer in seinem Werk „Philosophie des Selbstbewusstseins“ vertreten wird. Stekeler-Weithofer argumentiert, dass der Kampf um Anerkennung innerhalb eines Subjektes stattfindet und die Grundlage für die Entwicklung des Selbstbewusstseins bildet.
Das dritte Kapitel analysiert die Kritik beider Lesarten und versucht, eine Synthese zu entwickeln, die die Stärken beider Perspektiven vereint.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Verhältnis von Herr und Knecht, die Phänomenologie des Geistes, die intersubjektive und intrasubjektive Perspektive, Axel Honneth, Pirmin Stekeler-Weithofer, Kampf um Anerkennung, Philosophie des Selbstbewusstseins, Selbstbewusstsein, Anerkennung, Herrschaft, Knechtschaft, Kritik, Synthese.
- Citation du texte
- Ronny Daniel Kupfer (Auteur), 2014, Das Verhältnis von Herr und Knecht in Hegels Phänomenologie des Geistes aus inter- bzw. intrasubjektiver Perspektive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281801