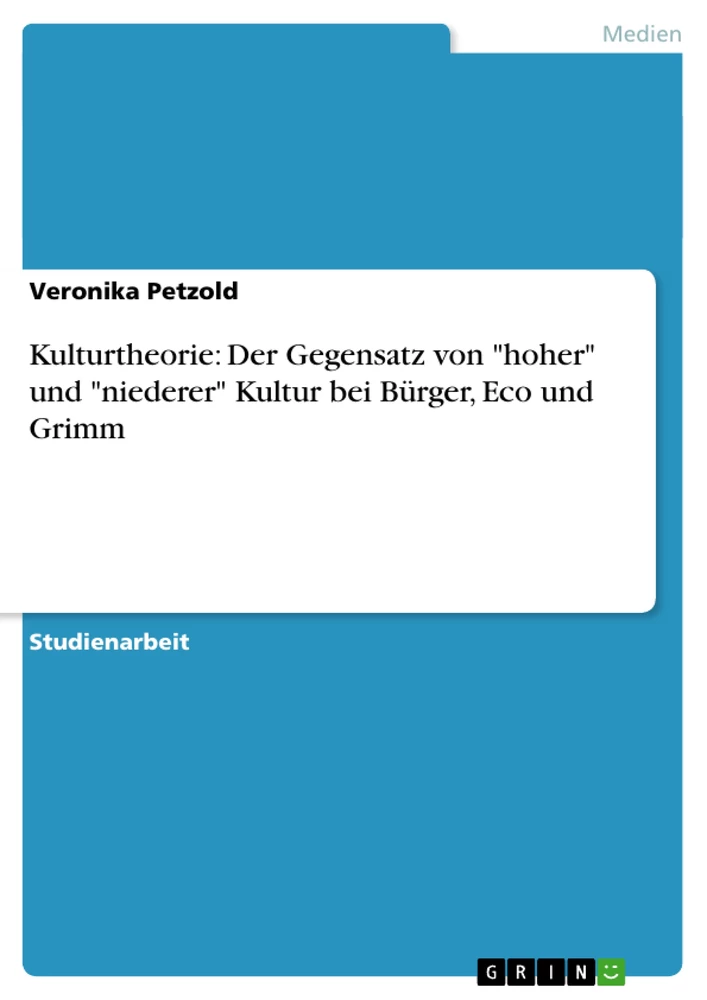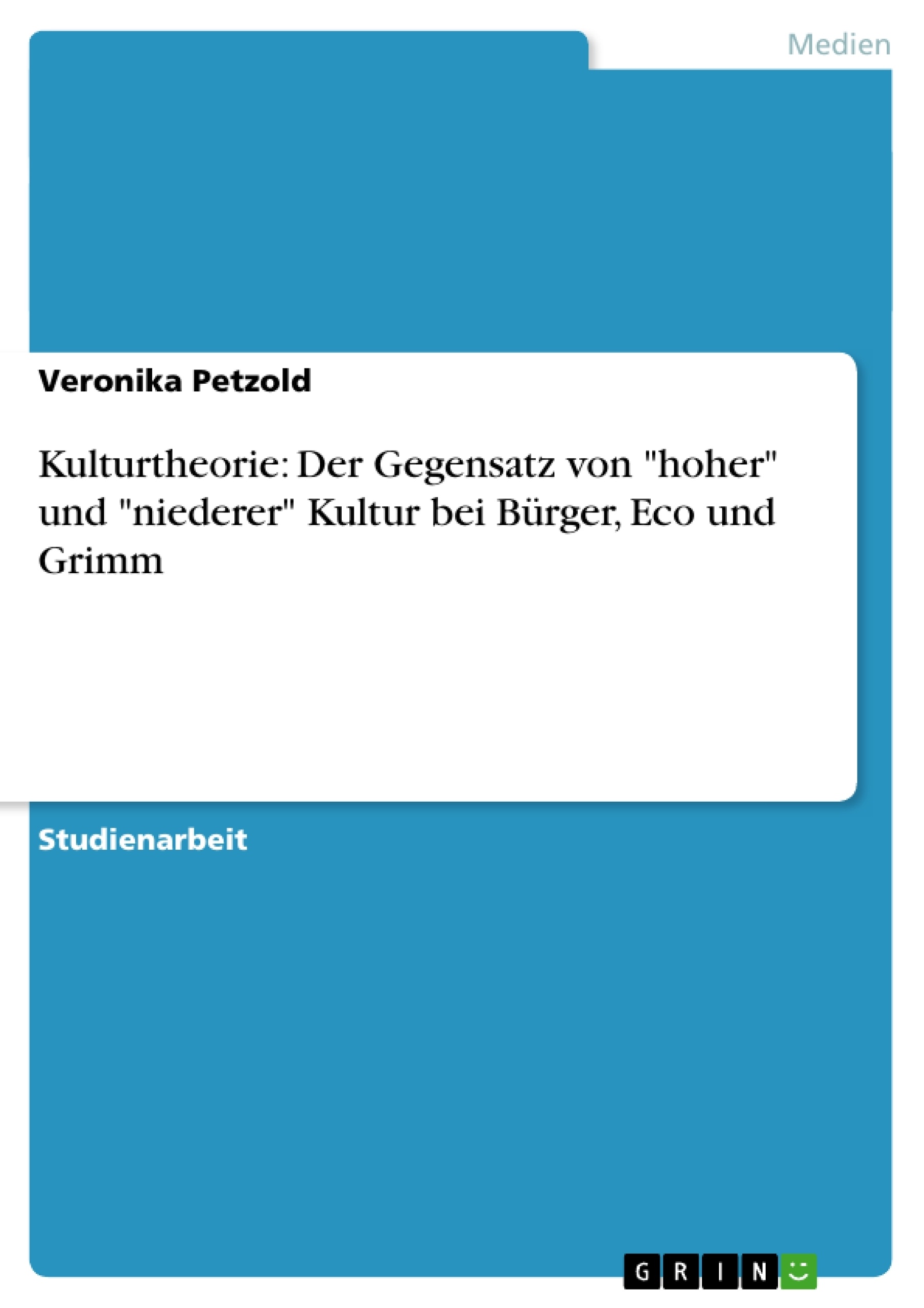Dichotomisierungsprozesse, die zur Trennung von hoher und niederer Literatur führen, spiegeln gesellschaftliche Widersprüche und Ausgrenzungen wider. Während ein Teil der Kunst oder Literatur von einer bestimmten Elite anerkannt und als geltende Norm kanonisiert wird, werden die übrigen Kunst- oder Literaturwerke als niedere oder Nicht-Kultur1 ausgegrenzt und somit gleichzeitig die Rezipienten dieser Werke, die häufig den größten Teil der Gesellschaft darstellen. Die Entstehung kultureller Teilungsprozesse, deren gesellschaftliche Voraussetzungen und Konsequenzen sowie mögliche neue Betrachtungsweisen des Wertungsproblems sollen im Folgenden anhand der Texte „Die Dichotomisierung hoher und niederer Literatur“ (Christa Bürger), „Massenkultur und Kultur-Niveaus“ (Umberto Eco) und „Medienkitsch als Wertungs- und Rezeptionsphänomen“ (Jürgen Grimm) untersucht werden. Zunächst werden historische Entwicklungsprozesse dargestellt, die an Umbruchstellen der Literaturgeschichte zu einer Dichotomie von hoher und niederer Literatur geführt haben, wobei vor allem auf die gesellschaftlichen bzw. politischen Hintergründe und Konsequenzen der Entwicklung in Deutschland im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert eingegangen wird. Damit verbunden sind unterschiedliche Forschungs- und Lösungsansätze, welche die Autorin nutzt, um zu einem eigenen Ansatz im Wertungsproblem von hoher und niederer Kultur zu kommen und Forderungen bezüglich künftiger Aufgaben und Wertmaßstäbe in der Literatur zu stellen. Auch Umberto Eco setzt sich mit dem Wertungsproblem innerhalb der Kultur auseinander; sein Ansatzpunkt sind jedoch die durch Massenmedien vermittelten kulturellen Beiträge. Anhand seines Textes „Massenkultur und Kultur-Niveaus“ sollen Ecos wichtigste Ziele und Forderungen bei der Nutzung der Massenmedien zur Vermittlung kultureller Werte herausgearbeitet werden. Außerdem wird seine dialektische Vorgehensweise bei der Analyse der Massenkultur vorgestellt. An Ecos Ergebnisse und Forschungsvorschläge knüpft der Text „Medienkitsch als Wertungs- und Rezeptionsphänomen“ an, indem hier der gesellschaftliche Umgang mit Medienkitsch als einem Teil der Unterhaltungskultur untersucht und mit einer Analyse der in diesem Zusammenhang entstandenen Echtheitsdebatte verknüpft wird. Neben den Thesen zum Medienkitsch sollen hier vor allem die Neudefinition, neue Perspektivierungsansätze sowie sich dadurch ergebende gesellschaftliche Möglichkeiten und Anforderungen vorgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Dichotomisierung hoher und niederer Literatur
- 2.1 Umbruchstellen innerhalb der Literaturgeschichte
- 2.2 Folgen der Dichotomie hoher und niederer Literatur
- 2.3 Thesen und Lösungsvorschläge
- 3. Massenkultur und Kultur-Niveaus
- 3.1 Die Massenkultur unter Anklage
- 3.2 Die Verteidigung der Massenkultur
- 3.3 Forschungs- und Lösungsansätze
- 4. Medienkitsch als Wertungs- und Rezeptionsphänomen
- 4.1 Ausgangspunkt und Ziele
- 4.2 Thesen zum Kitsch
- 4.3 Kultivierungsbedarf
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Referat untersucht die Dichotomie von „hoher“ und „niederer“ Kultur anhand der Texte von Christa Bürger, Umberto Eco und Jürgen Grimm. Es beleuchtet historische Entwicklungsprozesse, die zu dieser Trennung führten, analysiert die gesellschaftlichen Konsequenzen und präsentiert verschiedene Forschungsansätze zur Bewertung des Problems. Der Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit den jeweiligen Argumentationen und dem Herausarbeiten von Lösungsvorschlägen.
- Historische Entwicklung der Dichotomie „hoher“ und „niederer“ Literatur
- Gesellschaftliche und politische Hintergründe der kulturellen Teilung
- Analyse der Massenkultur und deren Bewertung
- Medienkitsch als Wertungs- und Rezeptionsphänomen
- Forschungsansätze und Lösungsvorschläge zur Überwindung der kulturellen Kluft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Dichotomisierung von hoher und niederer Literatur ein und beschreibt den gesellschaftlichen Hintergrund dieser Trennung. Sie skizziert die Forschungsfrage und benennt die zentralen Texte von Bürger, Eco und Grimm, die im weiteren Verlauf analysiert werden. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Entstehung kultureller Teilungsprozesse, deren gesellschaftlichen Voraussetzungen und Konsequenzen sowie möglichen neuen Betrachtungsweisen des Wertungsproblems.
2. Die Dichotomisierung hoher und niederer Literatur: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Entwicklungsprozesse, die zur Dichotomie von hoher und niederer Literatur führten. Es analysiert Umbruchstellen in der Literaturgeschichte, wie die Institutionalisierung der klassischen Regelpoetik im französischen Absolutismus, und die Gegenbewegung der Frühaufklärer mit ihrer Forderung nach allgemeiner Kunstzugänglichkeit. Besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung in Deutschland im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert, wo der Aufstieg des modernen Romans mit einem Trivialisierungsprozess der Unterhaltungsliteratur einherging. Die Autorin verknüpft diese Entwicklungen mit dem gesellschaftlichen Modernisierungsprozess und dem zunehmenden Rationalisierungsdruck.
3. Massenkultur und Kultur-Niveaus: Dieses Kapitel befasst sich mit Umberto Ecos Analyse der Massenkultur. Es untersucht Ecos wichtigste Ziele und Forderungen bei der Nutzung von Massenmedien zur Vermittlung kultureller Werte und präsentiert seine dialektische Vorgehensweise bei der Analyse der Massenkultur. Der Fokus liegt auf der Auseinandersetzung mit der Kritik an der Massenkultur und deren Verteidigung. Die Zusammenfassung berücksichtigt die Forschungs- und Lösungsansätze, die Eco vorschlägt.
4. Medienkitsch als Wertungs- und Rezeptionsphänomen: Das Kapitel analysiert den gesellschaftlichen Umgang mit Medienkitsch als Teil der Unterhaltungskultur und untersucht die damit verbundene Echtheitsdebatte. Es werden die Thesen zum Medienkitsch vorgestellt, sowie neue Perspektivierungsansätze und sich daraus ergebende gesellschaftliche Möglichkeiten und Anforderungen. Die Zusammenfassung fasst die im Kapitel diskutierten Neudefinitionen und Perspektiven zusammen.
Schlüsselwörter
Hohe und niedere Kultur, Literaturgeschichte, Dichotomisierung, Massenkultur, Medienkitsch, Kanonisierung, Trivialisierung, Umbruchstellen, Forschungsansätze, Wertungsproblem, gesellschaftliche Konsequenzen, Ecos dialektische Vorgehensweise, Echtheitsdebatte.
Häufig gestellte Fragen zum Referat: Hohe und niedere Kultur
Was ist der Hauptgegenstand dieses Referats?
Das Referat untersucht die Dichotomie von „hoher“ und „niederer“ Kultur, analysiert die historischen Entwicklungsprozesse, die zu dieser Trennung führten, und beleuchtet die gesellschaftlichen Konsequenzen. Es basiert auf den Texten von Christa Bürger, Umberto Eco und Jürgen Grimm und konzentriert sich auf die jeweiligen Argumentationen und Lösungsvorschläge.
Welche Themen werden im Referat behandelt?
Das Referat behandelt die historische Entwicklung der Dichotomie „hoher“ und „niederer“ Literatur, die gesellschaftlichen und politischen Hintergründe dieser kulturellen Teilung, die Analyse der Massenkultur und deren Bewertung, Medienkitsch als Wertungs- und Rezeptionsphänomen sowie Forschungsansätze und Lösungsvorschläge zur Überwindung der kulturellen Kluft.
Welche Autoren werden im Referat analysiert?
Die Analyse stützt sich auf die Texte von Christa Bürger, Umberto Eco und Jürgen Grimm.
Wie ist das Referat strukturiert?
Das Referat beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zur Dichotomisierung hoher und niederer Literatur, zur Massenkultur und Kultur-Niveaus, zu Medienkitsch als Wertungs- und Rezeptionsphänomen und ein Fazit. Jedes Kapitel bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte.
Was wird in Kapitel 2 ("Die Dichotomisierung hoher und niederer Literatur") behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Entwicklungen, die zur Dichotomie führten, analysiert Umbruchstellen in der Literaturgeschichte (z.B. die klassische Regelpoetik und die Gegenbewegung der Frühaufklärer) und den Aufstieg des modernen Romans im 18. und 19. Jahrhundert in Deutschland. Die Verknüpfung dieser Entwicklungen mit dem gesellschaftlichen Modernisierungsprozess und dem Rationalisierungsdruck steht im Mittelpunkt.
Was ist der Fokus in Kapitel 3 ("Massenkultur und Kultur-Niveaus")?
Kapitel 3 konzentriert sich auf Umberto Ecos Analyse der Massenkultur, seine Ziele und Forderungen bei der Nutzung von Massenmedien, die Kritik an der Massenkultur und deren Verteidigung sowie Ecos Forschungs- und Lösungsansätze.
Worum geht es in Kapitel 4 ("Medienkitsch als Wertungs- und Rezeptionsphänomen")?
Dieses Kapitel analysiert den gesellschaftlichen Umgang mit Medienkitsch, die damit verbundene Echtheitsdebatte, Thesen zum Medienkitsch, neue Perspektivierungsansätze und daraus resultierende gesellschaftliche Möglichkeiten und Anforderungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Referat?
Schlüsselwörter sind: Hohe und niedere Kultur, Literaturgeschichte, Dichotomisierung, Massenkultur, Medienkitsch, Kanonisierung, Trivialisierung, Umbruchstellen, Forschungsansätze, Wertungsproblem, gesellschaftliche Konsequenzen, Ecos dialektische Vorgehensweise, Echtheitsdebatte.
Welche Forschungsfrage wird im Referat behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage befasst sich mit der Entstehung kultureller Teilungsprozesse, deren gesellschaftlichen Voraussetzungen und Konsequenzen sowie möglichen neuen Betrachtungsweisen des Wertungsproblems von "hoher" und "niederer" Kultur.
- Quote paper
- Veronika Petzold (Author), 2002, Kulturtheorie: Der Gegensatz von "hoher" und "niederer" Kultur bei Bürger, Eco und Grimm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28189