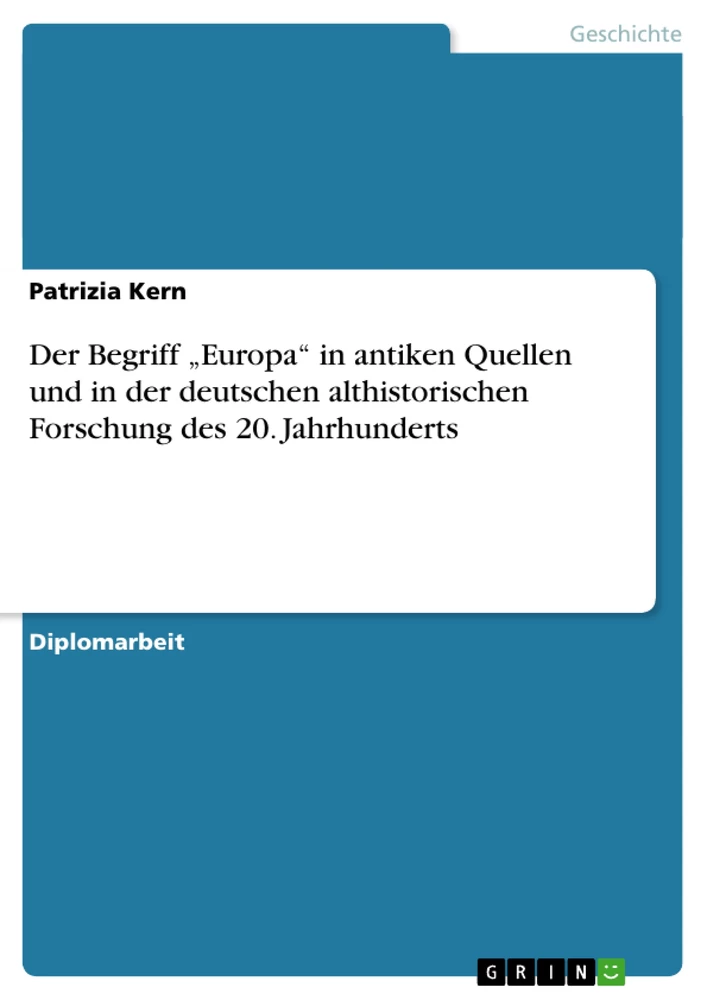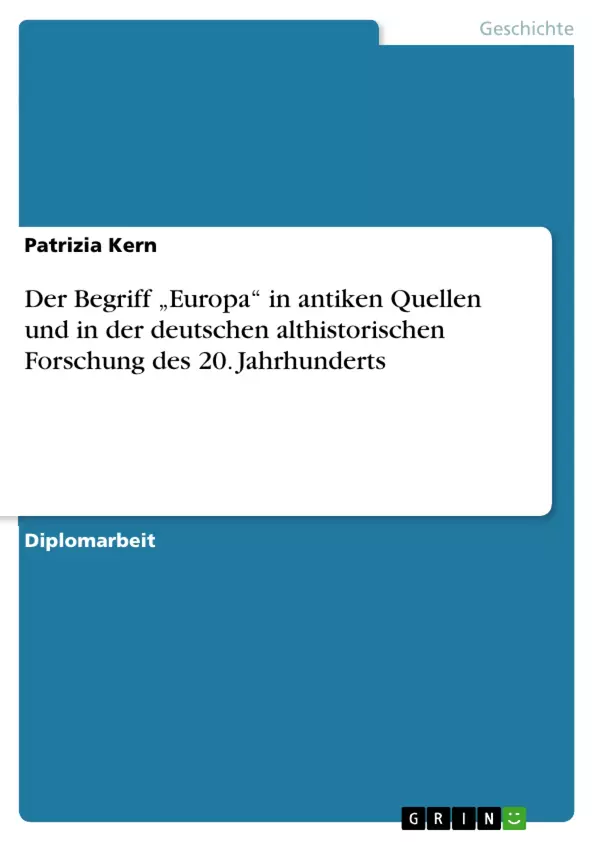Bereits 1933 deutete der italienische Historiker Arnaldo Momigliano an, dass der antike Begriff „Europa“ zu Rückbezügen hinsichtlich zeitgenössischer politischer Vorstellungen und Ideale einlade. Ein Dreivierteljahrhundert später zeigt der Blick auf die deutsch(sprachige) Wissenschaftslandschaft, dass vor allem seit Mitte/Ende der 1980er Jahre die Beschäftigung mit dem Begriff „Europa“ und seinen Wurzeln, bzw. der Frage nach der Existenz eines „politisch-kulturellen Europagedankens“ in der Antike zugenommen hat – ebenso wie die Zahl von Arbeiten, die aus einem Vergleich mit der Antike Lehren für das heutige politische Europa zu ziehen versuchen.
Zwar reichen die antiken Zeugnisse und Vorstellungen zum geographischen und mythischen Inhalt des Begriffs bis ins 7. Jahrhundert v. Chr. zurück. Die Frage, ob es bereits in der Antike eine politisch-kulturelle Idee von Europa gegeben hat, gilt in der Forschung aber als umstritten. Der Grund hierfür liege in der unterschiedlichen Interpretation bestimmter antiker Quellen.
In der vorliegenden Arbeit soll erstens versucht werden zu klären, welche Bedeutung der Begriff „Europa“, insbesondere in Abgrenzung zu „Asien“ in den antiken Zeugnissen hat, zweitens, welche Schwierigkeiten sich bei der Interpretation der Quellen ergeben, und drittens, welche Charakteristika, Themen und Motive in den Quellen auftauchen, die es für die moderne Wissenschaft interessant machen, einen Bezug zwischen antiken und zeitgenössischen Gegebenheiten herzustellen, wie zum Beispiel der Begriff des „Barbaren“ oder ein von griechischen wie römischen Autoren konstruierter Gegensatz zwischen Osten und Westen.
In einem ersten Kapitel werden die antiken Quellen, die von der modernen Forschung zur Begründung (oder Zurückweisung) der Existenz eines „politisch-kulturellen Europagedankens“ in der Antike herangezogen werden, dargestellt und interpretiert. Es wird versucht zu klären, welche Bedeutung der Begriff „Europa“ im jeweiligen politischen und kulturellen Kontext der antiken Autoren hatte – und was jeder Autor aus den Vorgaben seiner Zeit gemacht hat. In einem zweiten Teil wird ein Überblick über Forschungsstand sowie aktuelle Kontroversen in der deutschen Altertumswissenschaft des 20. Jahrhunderts gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. „Europa" als Begriff in antiken Quellen
- 1. Das 5. Jahrhundert: Die Rezeption der Perserkriege
- 1.1. Vorbemerkungen: Geographische Vorstellungen, Selbstwahrnehmung und Situierung in der Oikumene
- 1.2. Aischylos' „Perser"
- 1.2.1. Der „, Traum der Atossa“: „Europa“ und sein Gegenteil „Asien“?
- 1.2.2.,,Griechen“ vs. „Perser"?
- 1.2.3. Die Rolle Athens und der „Athenocentrism“ in den „Persern"
- 1.3. Der Europa-Asien-Gegensatz in der Umweltschrift
- 1.3.1. Klimatheorie und Europa-Asien-Gegensatz
- 1.3.2. Der Einfluss der Verfassung
- 1.3.3. Reflexion der Perserkriege
- 1.4. Das Europabild bei Herodot
- 1.4.1. Klimatheorie in den „Historien"
- 1.4.2. Die Darstellung der Erde bzw. der Oikumene
- 1.4.3. Die Einteilung der Erdteile
- 1.4.4. Europa und Asien
- 1.5. Zusammenfassung
- 2. Vom Peloponnesischen Krieg zu Alexander
- 2.1. Isokrates
- 2.1.1. Historisch-politischer Hintergrund
- 2.1.2. Geographische Bedeutung von Europa bei Isokrates
- 2.1.3. Die Funktionalisierung des Europa-Begriffs bei Isokrates
- 2.1.3.1. Funktionalisierung am Beispiel des „Panegyrikos"
- 2.1.3.2. Funktionalisierung am Beispiel des „Philippos“
- 2.1.4. Isokrates' Rezeption des Hellenen-Barbaren-Gegensatzes
- 2.2. Ephoros und Theopomp
- 2.3. Aristoteles
- 2.1. Isokrates
- 3. Die Römer und der Europabegriff
- 3.1. Die Römer und der Europabegriff im 2. Jahrhundert v. Chr.
- 3.2. Livius
- 3.3. Der Europabegriff im 1. Jahrhundert n. Chr.
- 3.3.1. Strabon
- 3.3.2. Manilius
- 3.3.3. Plinius
- 3.4. Die Spätantike
- 4. Zusammenfassung: Der Befund der Quellen
- 1. Das 5. Jahrhundert: Die Rezeption der Perserkriege
- III. „Europa in der Antike“ und „Das Europa der Deutschen"
- 1. Europaideen und „Europa“ in der deutschen Altertumswissenschaft vor 1989
- 1.1. Vom Kaiserreich zum Nationalsozialismus: Orient-Okzident, Abendland und Reichsgedanke
- 1.2. Abendland oder Westeuropa? - Vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zu den Umbrüchen 1989/90
- 1.2.1. Berve: Europa, das Abendland und seine Feinde aus dem Osten
- 1.2.2. Orient Okzident und Abendland
- 2. „Europa“ nach 1989: Neue Feinde aus dem Osten?
- 2.1. Die Antike als Ursprung der „Kulturgemeinschaft“?
- 2.1.1. Europa und Asien - Griechen und Barbaren – Osten und Westen
- 2.1.2. „Europa" in der Antike - Rückprojektion der modernen Forschung?
- 2.2. Überlegungen zur Verwendbarkeit von Geschichte
- 2.3. Europa und seine – neuen? - Barbaren
- 2.4. Das Imperium Romanum als Vorbild supranationaler Ordnungen?
- 2.1. Die Antike als Ursprung der „Kulturgemeinschaft“?
- 1. Europaideen und „Europa“ in der deutschen Altertumswissenschaft vor 1989
- IV. Zusammenfassung
- V. Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Entwicklung des Begriffs „Europa“ in antiken Quellen und seiner Rezeption in der deutschen althistorischen Forschung des 20. Jahrhunderts. Ziel ist es, die unterschiedlichen Interpretationen des Begriffs „Europa“ in der Antike zu beleuchten und die Frage nach der Existenz eines „politisch-kulturellen Europagedankens“ in der Antike zu untersuchen.
- Die Bedeutung des Begriffs „Europa“ in antiken Quellen, insbesondere in Abgrenzung zu „Asien“
- Die Schwierigkeiten bei der Interpretation der Quellen
- Die Charakteristika, Themen und Motive in den Quellen, die für die Rezeption des Begriffs „Europa“ in der deutschen althistorischen Forschung relevant sind
- Die Rezeption des Begriffs „Europa“ in der deutschen althistorischen Forschung des 20. Jahrhunderts
- Die Frage nach der Existenz eines „politisch-kulturellen Europagedankens“ in der Antike
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Begriffs „Europa“ in der heutigen Zeit dar und beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen des Begriffs in der althistorischen Literatur. Sie führt die zentralen Quellen und die wichtigsten Autoren der Forschungsliteratur ein, die in der Arbeit behandelt werden.
Kapitel II analysiert die Verwendung des Begriffs „Europa“ in antiken Quellen, beginnend mit dem 5. Jahrhundert v. Chr. und der Rezeption der Perserkriege. Es werden die Werke von Aischylos, Herodot, Isokrates, Ephoros, Theopomp und Aristoteles untersucht, um die Bedeutung des Begriffs „Europa“ in der griechischen Antike zu beleuchten. Das Kapitel beleuchtet auch die Verwendung des Begriffs „Europa“ bei den Römern, insbesondere im 2. Jahrhundert v. Chr. und im 1. Jahrhundert n. Chr., anhand der Werke von Livius, Strabon und Manilius.
Kapitel III widmet sich der Rezeption des Begriffs „Europa“ in der deutschen althistorischen Forschung des 20. Jahrhunderts. Es werden die unterschiedlichen Interpretationen des Begriffs in der Zeit vom Kaiserreich bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs und in der Zeit nach 1989 untersucht. Das Kapitel beleuchtet die Rolle des Begriffs „Europa“ in der deutschen Geschichtswissenschaft und die Frage nach der Existenz eines „politisch-kulturellen Europagedankens“ in der Antike.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Begriff „Europa“, die antiken Quellen, die deutsche althistorische Forschung des 20. Jahrhunderts, die Perserkriege, die Rezeption des Begriffs „Europa“ in der Antike, die Existenz eines „politisch-kulturellen Europagedankens“ in der Antike, die Interpretation der Quellen, die Bedeutung des Begriffs „Europa“ in Abgrenzung zu „Asien“, die Rolle des Begriffs „Europa“ in der deutschen Geschichtswissenschaft, die Rezeption des Begriffs „Europa“ in der Zeit vom Kaiserreich bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs und in der Zeit nach 1989.
Häufig gestellte Fragen
Gab es in der Antike bereits einen Europagedanken?
Dies ist in der Forschung umstritten. Während geographische Begriffe existierten, wird debattiert, ob es eine echte politisch-kulturelle Identität „Europa“ im Gegensatz zu „Asien“ gab.
Welche Rolle spielten die Perserkriege für das Europabild?
In Quellen wie Aischylos' „Die Perser“ wurde erstmals ein Gegensatz zwischen dem griechischen Europa (Freiheit) und dem persischen Asien (Despotie) konstruiert.
Was besagt die antike Klimatheorie über Europa?
Autoren wie Herodot oder Aristoteles versuchten, kulturelle Unterschiede durch klimatische Bedingungen zu erklären, wobei Europa oft als Region der Tapferkeit und Freiheit dargestellt wurde.
Wie sahen die Römer den Begriff Europa?
Für die Römer war Europa oft eher ein geographischer Teil ihres Weltreiches (Imperium Romanum), wobei die Unterscheidung zwischen „zivilisiert“ und „barbarisch“ zentraler war.
Wie wurde das antike Europabild in der deutschen Forschung des 20. Jahrhunderts rezipiert?
Die Forschung spiegelte oft zeitgenössische Ideale wider, von der Idee des „christlichen Abendlandes“ bis hin zur Suche nach Wurzeln für das moderne politische Europa nach 1989.
- Quote paper
- Patrizia Kern (Author), 2008, Der Begriff „Europa“ in antiken Quellen und in der deutschen althistorischen Forschung des 20. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281901