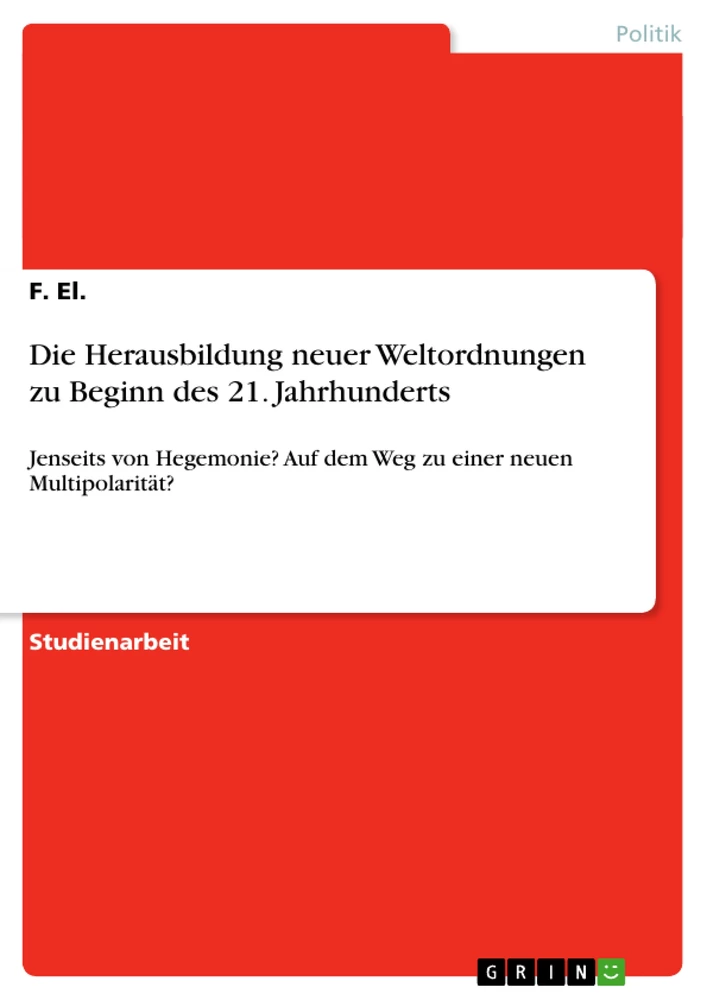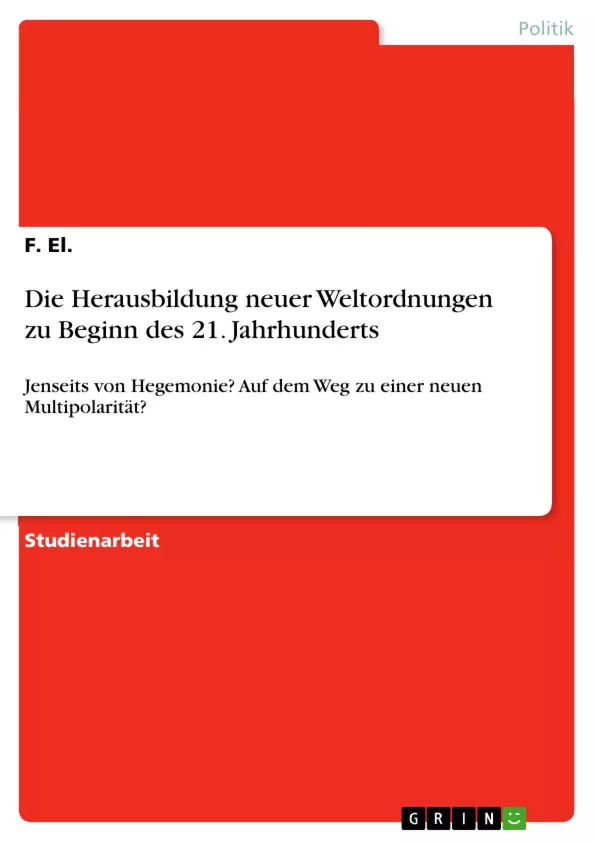Die Frage nach der Ordnung ist ein wichtiges, wenn nicht das wichtigste Anliegen eines Gemeinwesens. Als normative Vorstellung über die Art, wie ein Gemeinwesen intern strukturiert ist, spiegeln Ordnung und Stabilität dessen Stärke sowohl nach innen als auch nach außen wider. Auf dieselbe Weise lassen sich die Beziehungen zwischen Staaten gestalten, die unter dem Begriff der „Weltordnung“ gefasst werden können. Vier Arten der Weltordnung sind uns bekannt. Während Anarchie und Weltstaat bisher nur theoretische Modelle blieben, haben Hegemonie und Multipluralität praktische Bedeutung erlangt. Aus der Antike kennen wir die Balance of Power zwischen Athen und Sparta. Aber die Realität der letzten Jahrhunderte kann ein dauerhaft auf Machtausgleich zielendes internationales politisches System nicht bestätigen. Stattdessen gingen die USA zu Beginn des 21. Jahrhunderts als Sieger des Kalten Krieges gegen die Sowjetunion hervor und galten seitdem als einzig gebliebene Supermacht. Diesem Konzept der unipolaren Weltordnung widersetzten sich jedoch bald einige Regionalmächte. So sprach der amerikanische Politikwissenschaftler Peter Katzenstein 2005 von einer „Welt von Regionen“. In enger Anlehnung stellt uns sein britischer Kollege Bary Buzan „eine [friedliche] Weltordnung ohne Supermächte“ (Buzan, 2013) vor.
Wie wird sich die Welt des 21. Jahrhunderts ordnen? Und wie sind die beiden Gegenmodelle Hegemonie und Multipolarität in diesem Kontext einzuordnen, wenn es um die zentrale Frage der internationalen Politik geht, der Frage nach Krieg und Frieden?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bary Buzan: Der „dezentrierte Globalismus“
- Ein Blick in die Welt des 21. Jahrhunderts:
- Von alten und neuen Mächten
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay analysiert die These von Barry Buzan, die von einem „dezentrierten Globalismus“ ausgeht und die Frage nach der Zukunft der Weltordnung im 21. Jahrhundert aufwirft. Der Text setzt sich mit der Frage auseinander, ob die USA ihre hegemoniale Stellung behalten werden oder ob eine neue multipolare Weltordnung entsteht.
- Die Entwicklung der Weltordnung im 21. Jahrhundert
- Die Rolle der USA als Hegemon
- Die Herausforderungen der unipolaren Weltordnung
- Die Entstehung neuer Machtzentren
- Die Bedeutung regionaler Machtstrukturen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Weltordnung ein und stellt die verschiedenen Modelle der Weltordnung vor, darunter Anarchie, Weltstaat, Hegemonie und Multipolarität. Der Essay konzentriert sich auf die beiden letzteren Modelle und untersucht, wie sie sich im Kontext der Frage nach Krieg und Frieden im 21. Jahrhundert einordnen lassen.
Im zweiten Kapitel wird die These von Barry Buzan vom „dezentrierten Globalismus“ vorgestellt. Buzan argumentiert, dass die USA ihren Supermachtstatus verlieren werden und dass eine multipolare Weltordnung mit mehreren Machtzentren entstehen wird. Er kritisiert den „american exceptionalism“ und die gescheiterte Politik des „Demokratieexports“ und des „Krieges gegen den Terrorismus“ der USA.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Weltordnung im 21. Jahrhundert. Es wird argumentiert, dass die USA ihre hegemoniale Stellung verlieren und dass eine multipolare Weltordnung mit mehreren Machtzentren entsteht. Die USA versuchen, ihre hegemoniale Stellung zu wahren, indem sie die Entstehung neuer Großmächte in geostrategisch wichtigen Regionen verhindern. Der Essay analysiert die Strategien der USA in der MENA-Region und in Asien.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Weltordnung, Hegemonie, Multipolarität, „dezentrierter Globalismus“, die USA, China, die EU, regionale Machtstrukturen, Krieg und Frieden, „american exceptionalism“, „Demokratieexport“, „Krieg gegen den Terrorismus“ und die BRICS-Staaten.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Barry Buzan unter dem „dezentrierten Globalismus“?
Buzan beschreibt damit eine Weltordnung ohne Supermächte, in der die USA ihren Status als einzige Weltmacht verlieren und eine multipolare Struktur mit mehreren regionalen Machtzentren entsteht.
Welche Modelle der Weltordnung werden im Text unterschieden?
Es werden vier Modelle genannt: Anarchie, Weltstaat, Hegemonie (Unipolarität) und Multipolarität (Multipluralität).
Warum wird der „American Exceptionalism“ kritisiert?
Die Kritik richtet sich gegen die gescheiterte Politik des Demokratieexports und den „Krieg gegen den Terrorismus“, die zur Schwächung der US-Hegemonie beigetragen haben.
Welche Rolle spielen die BRICS-Staaten in der neuen Weltordnung?
Sie fungieren als neue Machtzentren, die das Konzept einer unipolaren, US-geführten Weltordnung herausfordern und regionale Strukturen stärken.
Wie reagieren die USA auf das Entstehen neuer Großmächte?
Die USA versuchen ihre Stellung zu wahren, indem sie die Entstehung neuer Mächte in geostrategisch wichtigen Regionen wie Asien oder der MENA-Region zu verhindern suchen.
- Quote paper
- F. El. (Author), 2014, Die Herausbildung neuer Weltordnungen zu Beginn des 21. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281906