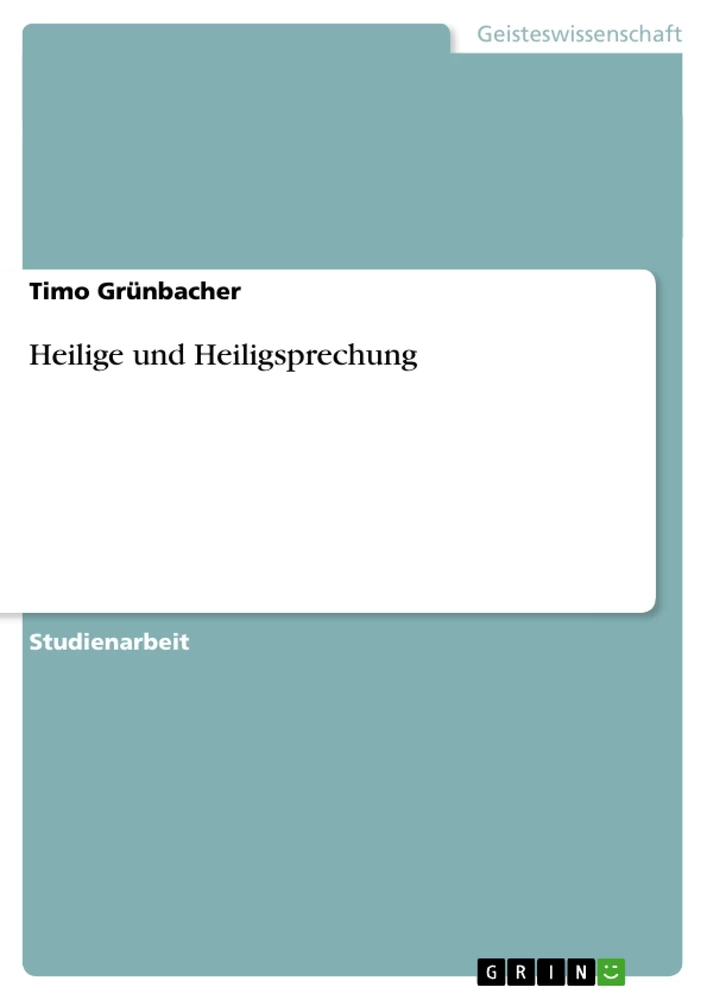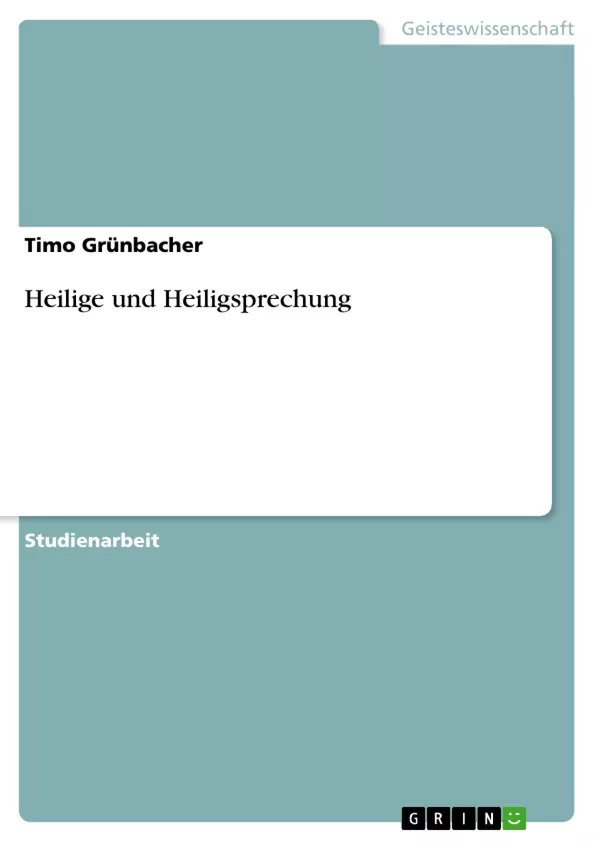Die Lektüre eines Heiligenlexikons provoziert beim religiösen Leser ein zwiespältiges Gefühl. Einerseits ein bewunderndes Erstaunen über eine Spezies Mensch, die der des Lesers kaum mehr gleicht; andererseits die schmerzliche Erkenntnis, dass das eigene Leben so weit vom Ideal entfernt ist. Der Heilige stellt also mit seinem vorbildlichen Leben alles andere in den Schatten. In genau diese Zwiespältigkeit formulierte im Jahr 2000 Papst Johannes Paul II. seine Botschaft zum 15. Weltjugendtag in Rom: „Jugendliche aller Kontinente, habt keine Angst, die Heiligen des neuen Jahrtausends zu sein!“ Der Papst weiß um die Schwierigkeit, diese Aussage ernst zu nehmen: „Ist es heute überhaupt möglich, heilig zu sein? Wenn man nur auf die menschlichen Fähigkeiten zählen wollte, würde diese Aufgabe zu Recht unmöglich erscheinen. Eure Erfolge und Niederlagen sind euch ja bekannt. Ihr wisst, welche Bürden auf dem Menschen lasten, welche Gefahren ihm drohen und welche Folgen seine Sünden haben. Manchmal könnte man den Mut verlieren und meinen, es sei unmöglich, in der Welt oder bei sich selbst etwas zu verändern.“
Und trotzdem schenkt dieser Papst den Jugendlichen der Welt das Vertrauen, dass gerade sie, in dieser modernen, schwierigen Welt heilig werden können. Der Begriff „Heilige“ ist vielfältig. Wenn Papst Johannes Paul II. dazu auffordert, Heilige zu werden, dann erwartet er von den Jugendlichen nicht, dass sie ein so legendäres Leben führen, wie uns von den Heiligen berichtet wird. Vielmehr geht es um das Streben nach Heiligkeit in den ganz alltäglichen und kleinen Dingen, denn zur Heiligmäßigkeit ist jeder berufen, wie es im ersten Petrusbrief heißt: „Wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes Leben heilig werden.“ (1. Petr 1,15) In dieser Seminararbeit möchte ich Einblick geben in das Leben der Heiligen, über die uns das Heiligenlexikon berichtet. Ich möchte herausstellen, wie sich der Begriff „Heilige“ und deren Heiligsprechung im Laufe der Jahrhunderte verändert hat, und wie die Heiligsprechung, also die Kanonisation, heute vollzogen wird.
Am Ende stehen die Biographien des Pfarrers von Ars und des Bruders Klaus von der Flüe. Sie sollen trotz ihrer Legendenhaftigkeit aufzeigen, dass diese Heilige trotzdem Menschen wie wir waren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Heilige und Heiligsprechung im Wandel der Geschichte
- Die ersten Anfänge
- Fehlentwicklungen der Heiligenverehrung
- Der Prozess der Heiligsprechung
- Zwei ausgewählte Biographien
- Johannes Maria Vianney, der Pfarrer von Ars
- Bruder Klaus von der Flüe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit beleuchtet den Wandel des Begriffs „Heilige“ und des Prozesses der Heiligsprechung im Laufe der Geschichte. Ziel ist es, Einblicke in das Leben von Heiligen zu geben und aufzuzeigen, wie sich das Verständnis von Heiligkeit verändert hat. Die Arbeit untersucht die frühen Anfänge der Heiligenverehrung, kritische Entwicklungen und die heutige Praxis der Kanonisation.
- Der Wandel des Begriffs „Heilige“ im Laufe der Geschichte
- Die Entwicklung der Heiligsprechungsprozesse
- Die Verbindung von Heiligkeit und Martyrium
- Kritik an der Heiligenverehrung
- Die Lebensgeschichten ausgewählter Heiliger als Beispiel
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung diskutiert die ambivalente Reaktion auf Heilige, die sowohl Bewunderung als auch die schmerzliche Erkenntnis der eigenen Unzulänglichkeit hervorruft. Papst Johannes Paul II.'s Aufforderung an Jugendliche, Heilige des neuen Jahrtausends zu sein, wird als Ausgangspunkt für die Reflexion über die Möglichkeit von Heiligkeit im modernen Kontext genutzt. Die Arbeit kündigt die Erforschung des Wandels im Verständnis von „Heiligen“ und des Heiligsprechungsprozesses an, mit abschließenden Biografien des Pfarrers von Ars und Bruders Klaus von der Flüe als Beispiel.
Heilige und Heiligsprechung im Wandel der Geschichte: Dieses Kapitel untersucht die historische Entwicklung des Begriffs „Heilige“. Es beginnt mit den frühen Anfängen im Neuen Testament, wo Heiligkeit eng mit Martyrium verbunden war, wie im Beispiel des Stephanus illustriert. Der Übergang vom Martyrium als Hauptkriterium hin zum enthaltsamen Leben im Kontext des wachsenden Mönchtums wird analysiert. Das Kapitel beleuchtet den Wandel des Heiligenideals von der Selbstaufopferung im Märtyrertum zum „weißen Martyrium“ der Askese.
Die ersten Anfänge: Dieser Abschnitt beschreibt die Anfänge der Heiligenverehrung im frühen Christentum, wobei der Märtyrertod als zentraler Aspekt hervorgehoben wird. Stephanus wird als Beispiel für die frühen Heiligen angeführt, dessen Tod als analog zum Tod Jesu dargestellt wurde. Das spontane Entstehen der Heiligenverehrung in den Gemeinden wird im Gegensatz zum institutionalisierten Prozess der späteren Jahrhunderte erläutert. Die Ausnahmen von der Regel des Märtyrertodes, die „überlebenden Bekenner“, werden auch erwähnt.
Fehlentwicklungen der Heiligenverehrung: Dieses Kapitel thematisiert die problematischen Aspekte der Heiligenverehrung in der Kirchengeschichte. Es werden Beispiele von exzessivem Kult um Reliquien angeführt und die Kritik daran durch Figuren wie Kaiser Julian Apostata beleuchtet. Der feine Unterschied zwischen Anbetung und Verehrung wird thematisiert, sowie die Paradoxie, dass der Körper, der zu Lebzeiten gering geschätzt wurde, nach dem Tod als wertvoll verehrt wurde.
Schlüsselwörter
Heilige, Heiligsprechung, Kanonisation, Martyrium, Askese, Heiligenverehrung, Kirchengeschichte, Johannes Maria Vianney, Bruder Klaus von der Flüe, Papst Johannes Paul II.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Heilige und Heiligsprechung
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Wandel des Begriffs „Heilige“ und des Prozesses der Heiligsprechung im Laufe der Geschichte. Sie beleuchtet die frühen Anfänge der Heiligenverehrung, kritische Entwicklungen und die heutige Praxis der Kanonisation. Im Mittelpunkt stehen die Veränderungen im Verständnis von Heiligkeit und die Entwicklung der Heiligsprechungsprozesse. Die Arbeit analysiert auch die Verbindung von Heiligkeit und Martyrium und die Kritik an der Heiligenverehrung, ergänzt durch die Lebensgeschichten ausgewählter Heiliger als Beispiel.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung des Begriffs „Heilige“, beginnend mit den frühen Anfängen im Neuen Testament, wo Heiligkeit eng mit Martyrium verbunden war. Sie analysiert den Übergang vom Martyrium als Hauptkriterium zum enthaltsamen Leben im Kontext des wachsenden Mönchtums und den Wandel des Heiligenideals von der Selbstaufopferung im Märtyrertum zum „weißen Martyrium“ der Askese. Weiterhin werden die problematischen Aspekte der Heiligenverehrung, wie der exzessive Kult um Reliquien und die damit verbundene Kritik, erörtert. Der feine Unterschied zwischen Anbetung und Verehrung sowie die Paradoxie der Verehrung des Körpers nach dem Tod werden thematisiert.
Welche Heiligen werden als Beispiele vorgestellt?
Die Seminararbeit präsentiert die Lebensgeschichten von Johannes Maria Vianney (Pfarrer von Ars) und Bruder Klaus von der Flüe als exemplarische Beispiele für den Wandel des Heiligenverständnisses und der Heiligsprechungsprozesse.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, die die ambivalente Reaktion auf Heilige und die Möglichkeit von Heiligkeit im modernen Kontext diskutiert. Es folgen Kapitel zur historischen Entwicklung der Heiligenverehrung und des Heiligsprechungsprozesses, inklusive einer detaillierten Betrachtung der frühen Anfänge und kritischer Entwicklungen. Abschließend werden die ausgewählten Biografien präsentiert und Schlüsselbegriffe zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Heilige, Heiligsprechung, Kanonisation, Martyrium, Askese, Heiligenverehrung, Kirchengeschichte, Johannes Maria Vianney, Bruder Klaus von der Flüe, Papst Johannes Paul II.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Ziel der Arbeit ist es, Einblicke in das Leben von Heiligen zu geben und aufzuzeigen, wie sich das Verständnis von Heiligkeit im Laufe der Geschichte verändert hat. Sie soll ein umfassendes Verständnis des Wandels des Begriffs „Heilige“ und des Prozesses der Heiligsprechung vermitteln.
- Quote paper
- Timo Grünbacher (Author), 2004, Heilige und Heiligsprechung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28192