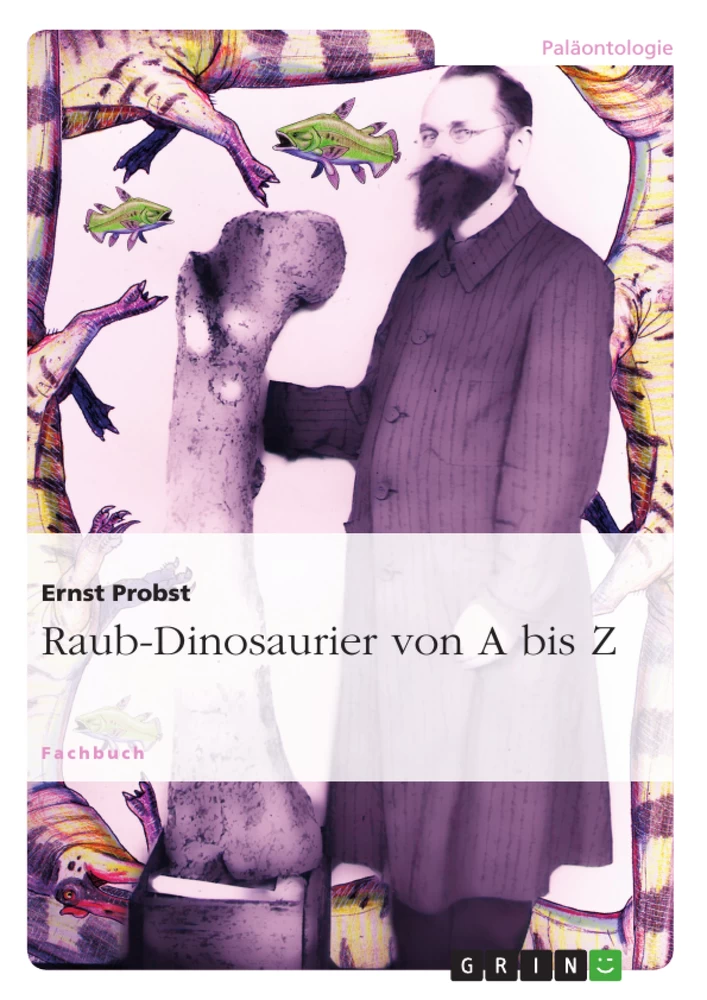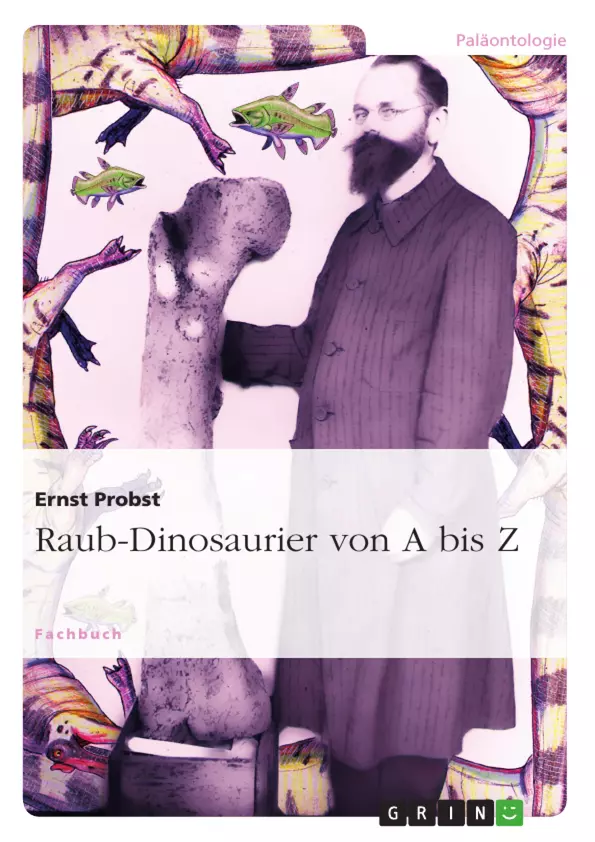Raub-Dinosaurier von A bis Z werden in dem gleichnamigen Taschenbuch des Wiesbadener Wissenschaftsautors Ernst Probst vorgestellt. Bei jeder Raub-Dinosaurier-Gattung erfährt man, worauf deren wissenschaftlicher Name beruht. Es folgen Angaben über die Größe, das zeitliche und geographische Vorkommen, die systematische Stellung und über die wissenschaftliche Erstbeschreibung. „Raub-Dinosaurier von A bis Z“ beschreibt mehr als 170 fleischfressende Gattungen der „schrecklichen Echsen“ von Abelisaurus bis zu Zupaysaurus. Ernst Probst hat sich durch zahlreiche populärwissenschaftliche Bücher einen Namen gemacht. Bekannte Werke aus seiner Feder sind: „Deutschland in der Urzeit“, „Rekorde der Urzeit. Landschaften, Pflanzen und Tiere“, „Dinosaurier in Deutschland. Von Efraasia bis Stenopelix“, „Dinosaurier von A bis K“, „Dinosaurier von L bis Z“, „Der Ur-Rhein“, „Der Rhein-Elefant“, „Deutschland im Eiszeitalter“, „Das Mammut“, „Der Mosbacher Löwe“ „Höhlenlöwen“, „Säbelzahnkatzen“, „Der Höhlenbär“, „Monstern auf der Spur“, „Nessie. Das Monsterbuch“, „Affenmenschen“ und „Seeungeheuer“.
Inhalt
Vorwort
Abelisaurus
Achillesaurus
Achillobator
Acrocanthosaurus
Adasaurus
Afrovenator
Ajancingenia
Albertonykus
Albertosaurus
Alectrosaurus
Alioramus
Allosaurus
Alvarezsaurus
Alxasaurus
Anchiornis
Anserimimus
Archaeornithoides
Archaeornithomimus
Aristosuchus
Atrociraptor
Aucasaurus
Austroraptor
Avimimus
Bagaraatan
Bahariasaurus
Bambiraptor
Banji
Baryonyx
Becklespinax
Beipiaosaurus
Beishanlong
Borogovia
Buitreraptor
Byronosaurus
Caenagnathasia
Carcharodontosaurus
Carnotaurus
Caudipteryx
Ceratosaurus
Chilantaisaurus
Chirostenotes
Citipati
Coelophysis
Coelurus
Compsognathus
Conchoraptor
Cryolophosaurus
Daspletosaurus
Deinocheirus
Deinonychus
Deltadromeus
Dilophosaurus
Dracovenator
Dromaeosaurus
Dromiceiomimus
Dryptosaurus
Elaphrosaurus
Elmisaurus
Enigmosaurus
Eocarcharia
Eoraptor
Eotyrannus
Erecotopus
Erliansaurus
Erlikosaurus
Eustreptospondylus
Falcarius
Fukuiraptor
Gallimimus
Garudimimus
Gasosaurus
Genyodectes
Giganotosaurus
Graciliraptor
Guanlong
Hagryphus
Halticosaurus
Haplocheirus
Harpymimus
Herrerasaurus
Hesperonychus
Heyunnia
Hulsanpes
Iliosuchus
Incisivosaurus
Indosaurus
ndosuchus
Ingenia (heute Ajancingenia)
Irritator
Itemirus
Juravenator
Kakuru 215 Khaan
Labocania
Liliensternus
Linheraptor
Lourinhanosaurus
Lukousaurus
Luoyanggia
Majungasaurus
Marshosaurus
Masiakasaurus
Megalosaurus
Megapnosaurus
Mei
Metriacanthosaurus
Microraptor
Microvenator
Monolophosaurus
Mononykus
Nanotyrannus
Nanshiungosaurus
Nedcolbertia
Neimongosaurus
Nemegtomaia
Neovenator
Neuquenraptor
Noasaurus
Nothronychus
Nqwebasaurus
Ornitholestes
Ornithomimus
Oviraptor
Ozraptor
Parvicursor
Patagonykus
Pelecanimimus
Piatnitzkysaurus
Piveteausaurus
Poekipleuron
Proceratosaurus
Procompsognathus
Quilmesaurus
Rahonavis
Richardoestesia
Rinchenia
Santanaraptor
Saurornithoides
Saurornitholestes
Segisaurus
Segnosaurus
Shanag
Shanyangosaurus
Shenzhousaurus
Shixinggia
Shuvuuia
Siamotyrannos
Similicaudipteryx
Sinornithoides
Sinornithomimus
Sinornithosaurus
Sinosauropteryx
Sinovenator
Spinosaurus
Staurikosaurus
Stokeosaurus
Struthiomimus
Suchomimus
Suzhousaurus
Szechuanosaurus
Tarbosaurus
Therizinosaurus
Torvosaurus
Troodon
Tsaagan
Tyrannosaurus
Unenlagia
Utahraptor
Velociraptor
Xenotarsosaurus
Xuanhanosaurus
Yangchuanosaurus
Zupaysaurus
Was ist ein Dinosaurier?
Wie die Dinosaurier zu ihrem Namen kamen
Der Autor
Literatur
Bildquellen
Bücher von Ernst Probst
Vorwort
Raub-Dinosaurier von A bis Z werden in dem rgleichnamigen Taschenbuch des Wiesbadener
Wissenschaftsautors Ernst Probst vorgestellt. Bei jeder Raub-Dinosaurier-Gattung erfährt man, worauf deren wissenschaftlicher Name beruht. Es folgen Angaben über die Größe, das zeitliche und geographische Vor- kommen, die systematische Stellung und über die wissenschaftliche Erstbeschreibung. „Raub-Dinosaurier von A bis Z“ beschreibt mehr als 170 fleischfressende Gattungen der „schrecklichen Echsen“ von Abelisaurus bis zu Zupaysaurus.
Ernst Probst hat sich durch zahlreiche populärwissen- schaftliche Bücher einen Namen gemacht. Bekannte Werke aus seiner Feder sind: „Deutschland in der Urzeit“, „Rekorde der Urzeit. Landschaften, Pflanzen und Tiere“, „Dinosaurier in Deutschland. Von Efraasia bis Stenopelix“, „Dinosaurier von A bis K“, „Dino- saurier von L bis Z“, „Der Ur-Rhein“, „Der Rhein- Elefant“, „Deutschland im Eiszeitalter“, „Das Mam- mut“, „Der Mosbacher Löwe“ „Höhlenlöwen“, „Säbel- zahnkatzen“, „Der Höhlenbär“, „Monstern auf der Spur“, „Nessie. Das Monsterbuch“, „Affenmenschen“, „Seeungeheuer“ und „Tiere der Urwelt“.
Abelisaurus
Name: Abel-Echse
Größe: etwa 6,50 bis 8 Meter lang Vorkommen: Obere Kreidezeit Funde: Argentinien (Südamerika)
Systematik: Saurischia (Echsenbecken-Dinosaurier), Theropoda, Ceratosauria, Abelisauroidea, Abelisauridae
Erstbeschreibung: Bonaparte und Novas 1985
Vom Raub-Dinosaurier Abelisaurus aus der Oberen Kreidezeit vor etwa 71 bis 65 Millionen Jahren wurde in der Provinz Rio Negro (Argentinien) nur ein etwa 85 Zentimeter langer Schädel gefunden. Dieser große Schädel mit rundlicher Schnauze ist locker gebaut. Die Nasenknochen sind groß und verdickt, die Zähne relativ klein. Das Lebendgewicht des bis zu acht Meter langen und zwei Meter hohen Dinosauriers wird auf weniger als 1,5 Tonnen geschätzt. Die wissenschaftliche Erstbeschreibung erfolgte 1985 durch die argentinischen Paläontologen José F. Bonaparte und Fernando E. Novas. Der Gattungsname Abelisaurus ehrt Professor Roberto Abel, den Entdecker eines Schädels und Direktor des „Argentinian Museum of Natural Science“. Die einzige Art heißt Abelisaurus comahuensis. Abelisaurus stand mit keinen anderen theropoden Raub-Dinosaurier der Kreidezeit in engerer stammesgeschichtlicher Beziehung. Deswegen hat man ihn zusammen mit anderen Gattungen einer eigenen Familie namens Abelisauridae zugeordnet. Da man das Skelett von Abelisaurus nicht kennt, beruhen Rekonstruktionen auf der Anatomie anderer Abelisauriden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Lebensbild von Abelisaurus comahuensis.
Zeichnung von Jordan Mallon bei „Wikipedia“
Achillesaurus
Name: Achilleus-Echse
Größe: etwa 2,70 Meter lang und 1,50 Meter hoch Vorkommen: Obere Kreidezeit
Funde: Argentinien (Südamerika)
Systematik: Saurischia, Theropoda, Coelurosauria, Maniraptora, Alvarezsauridae
Erstbeschreibung: Martinelli und Vera 2007
Der vogelähnliche Dinosaurier Achillesaurus lebte in der Oberen Kreidezeit vor etwa 85 bis 83 Millionen Jahren in Argentinien (Südamerika). Von ihm hat man ein Teilskelett aus der Bajo-de-la-Carpa-Formation in Argentinien geborgen, in der auch Reste des Dinosauriers Alvarezsaurus zum Vorschein kamen. Achillesaurus wurde 2007 durch die Paläontologen Agustín Martinelli und Ezequiel I. Vera erstmals wissenschaftlich beschrieben. Der Gattungsname Achillesaurus bezieht sich auf den griechischen Helden Achilleus (Achilles) und deutet auf die Achillesferse hin, die einzige Stelle, an der Achilleus verwundbar war. Die Erstbeschreiber wählten diesen Gattungsnamen, weil sie an der Fersenregion des Skeletts typische Merkmale entdeckten. Die einzige Art Achillesaurus manazzonei ist zu Ehren von Professor Rafael Manazzone benannt, der den Forschern Daten über Fossilfundstellen in Patagonien bereitstellte und mehrere paläontologische Exkursionen unterstützte. Achillesaurus wird zu den Alvarezsauridae gerechnet. Dabei handelt es sich um vogelähnliche, zweibeinige Dinosaurier. Auffallend an Achillesaurus waren dessen sehr kurze Arme.
Achillobator
Name: Achilles-Held
Größe: knapp 5 Meter lang
Vorkommen: Obere Kreidezeit Funde: Mongolei (Asien)
Systematik: Saurischia, Theropoda, Deinonychosauria, Dromaeosauridae, Dromaeosaurinae
Erstbeschreibung: Perle, Norell und Clark 1999
Der Raub-Dinosaurier Achillobator lebte in der Oberen Kreidezeit vor etwa 85 bis 70 Millionen Jahren in der Mongolei (Asien). 1989 entdeckte der Amateur- Paläontologe Namsarai des „Mongolischen Natur- historischen Museums“ während einer russisch- mongolischen Expedition südwestlich des Dorfes Dzun in der Mongolei das erste und einzige bisher bekannte Skelett dieses Tieres. Der Fundort Burkhant gehört zur Bayan-Shireh-Formation. Von anderen Fundstellen die- ser Formation kennt man fossile Reste von Enten- schnabel-Dinosauriern, Panzer-Dinosauriern, Ele- fantenfuß-Dinosauriern und Krokodilen. Geborgen wurden ein linker Oberkieferknochen, neun Zähne, einige Hals-, Rücken- und Schwanzwirbel, Rippen- fragmente, einige Hand- und Fußknochen, das rechte Darmbein, Schambein, Sitzbein, der linke Oberschen- kelknochen, das Schienbein und der linke Mittelfuß- knochen. Die wissenschaftliche Erstbeschreibung erfolgte 1999 durch die Paläontologen Altangerel Perle, Mark Norell und James Clark in einem mongolischen Journal. Laut Online-Lexikon „Wikipedia“ basierte die Beschreibung auf einem vorläufigen Manuskript und wurde ohne Wissen von Clark und Norell veröffentlicht. Der Gattungsname Achillobator setzt sich aus dem Namen des griechischen Helden Achilles und dem Wort bator (Held) zusammen. Die einzige Art heißt Achillobator giganticus („gigantischer Achilles-Held“) und bezieht sich auf eine vermutete sehr starke Sehne, die am zweiten Zeh saß und kräftige Bewegungen der Sichelkralle ermöglichte. Mit einer Länge von knapp fünf Metern und einem Lebendgewicht von schätzungs- weise 350 Kilogramm gehörte Achillobator nach Utahraptor aus Nordamerika zu den größten Dromaeo- sauridae. Als Dromaeosauridae bezeichnet man eine Gruppe von Raub-Dinosauriern innerhalb der Deiny- chosauria. Dabei handelte es sich um kleine bis mittel- große, zweibeinig laufenden Fleischfresser, die ver- mutlich mit den Vögeln (Aves) nahe verwandt waren. Der geborgene Oberkiefer stammt von einem großen Kopf. Jede Hälfte des Oberkiefers trug elf Zähne. Unbekannt ist die Gesamtzahl der Zähne. Die vordere und die hintere Schneidekante der Zähne waren gesägt. Auf der vorderen Schneidekante waren die Säge- zähnchen größer als auf der hinteren. Achillobator ging zweibeinig auf seinen relativ kurzen und gedrungenen Hinterbeinen. Der Oberschenkelknochen war im Gegensatz zu anderen Dromaeosauriden länger als das Schienbein. Die Arme waren lang. Achillobator war vermutlich mit Utahraptor und Dromaeosaurus am nächsten verwandt. Aus diesen drei Gattungen besteht die Untergruppe der Dromaeosaurinae. Die Palä- ontologen David A. Burnham, Kraig L. Derstler, Philip J. Currie, Robert T. Bakker, Zhonghe Zhou und John H. Ostrom vermuteten 2000, beim Skelett von Achillo- bator handle es sich um eine Chimäre aus Knochen von mehr als einer Art. Sie verwiesen darauf, dass der Oberkiefer, das Sitzbein, das Schambein und die Schwanzwirbel keine gemeinsamen Merkmale mit anderen Dromaeosauriden hätten und somit vermutlich von einem anderen Tier stammten. Dagegen würden die Fußkrallen tatsächlich zu einem Dromaeosauriden gehören. Die Paläontologen Mark A. Norell und Peter Mackovicky verwiesen 2004 darauf, dass die Knochen von Achillobator teilweise miteinander verbunden gefunden wurden, was darauf hindeute, dass sie vom selben Tier stammten. Das vertikal ausgerichtete Schambein und dessen stark verbreitertes unteres Ende dagegen hielten sie für sehr untypisch für Dromaeo- sauriden.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Lebensbild von Achillobator.
Zeichnung von Matt Martyniuk bei „Wikipedia“
Acrocanthosaurus
Name: Hochdornen-Echse
Größe: etwa 11,50 Meter lang
Vorkommen: Untere Kreidezeit
Funde: Oklahoma, Texas, Utah (USA)
Systematik: Saurischia, Carnosauria, Allosauroidea
Erstbeschreibung: Stovall und Langston 1950
Der große Raub-Dinosaurier Acrocanthosaurus lebte in der Unteren Kreidezeit vor etwa 125 bis 112 Millionen Jahren in Nordamerika. Der Paläontologe Wann Langston hat dieses Tier 1947 als Acrocanthus bezeichnet. 1950 wurde dieser Dinosaurier von den Paläontologen
J. Willis Stovall und Wann Langston wissenschaftlich beschrieben und Acrocanthosaurus genannt. Bei der Untersuchung haben ihnen zwei Teilskelette aus der Antlers-Formation im Atoka Country in Oklahoma (USA) vorgelegen. Der Gattungsname Acrocanthosaurus beruht auf den Wirbelstacheln dieses Tieres (griechisch: akro = hoch, akantha = Stachel). Die einzige Art heißt Acrocanthosaurus atokensis und ist nach dem erwähnten Atoka Country benannt. Später wurden zwei weitere vollständige Skelette bekannt. Das erste stammt aus der Twin-Mountain-Formation in Texas, das zweite mit dem Spitznamen „Fran“ aus der Antlers-Formation in Oklahoma.. Einzelknochen hat man auch in Texas, Oklahoma und in der Cedar-Mountain-Formation in Utah gefunden. Der Dinosaurier „Fran“ erreichte eine Länge von etwa 11,50 Metern und trug einen fast 1,30 Meter langen Schädel. Sein Lebendgewicht wird auf zwei bis drei Tonnen geschätzt. Acrocanthosaurus hatte an jeder Hand drei Finger und besaß fast 30 Zentimeter lange Dornfortsätze der Rückenwirbel, zwischen denen sich ein niedriges Hautsegel spannte. Acrocanthosaurus gilt als der einzige Spinosaurier (Dornenechse) aus den USA. Alle Spinosaurier besaßen auf dem Rücken ein Hautsegel. In Nordamerika schreibt man Acrocantho- saurus viele Dinosaurierspuren zu. Darunter sind die berühmten Glen-Rose-Spuren im „Dinosaur Valley State Park“ im Norden von Texas. Einige der mut- maßlichen Fährten von Acrocanthosaurus fand man in Nähe einer Herde von Elefantenfuß-Dinosauriern. Sie zeigen in dieselbe Richtung. Deswegen vermutet man, dass die fleischfressenden Acrocanthosaurier den großen pflanzenfressenden Elefantenfuß-Dinosauriern bei ihren Wanderungen folgten und auf kranke und schwache Tiere lauerten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Skelett des Acrocanthosaurus „Fran“
im „North Carolina Museum of Natural Sciences“
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Lebensbild von Acrocanthosaurus.
Lebensbild von Dmitry Bogdanov bei „Wikipedia“
Dmitry V. Bogdanov, geboren 1971 in Chelyabinsk (Russland), ist ein russischer Paläoartist, lebt in seinem Geburtsort und arbeitet an der „Staatlichen Medizinischen Akademie“ in Chelyabinsk (PhD, MD).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bogdanov hat im Online- Lexikon „Wikipedia“ zahlreiche Zeichnungen von Dinosauriern veröffentlicht, von denen in diesem Buch mit seiner freundlichen Genehmigung eine Auswahl abgedruckt wird. Weitere Werke von Dmitry V. Bogdanov findet man im Internet unter der Adresse http://dibgd.deviantart.com
Adasaurus
Name: Ada-Echse
Größe: etwa 1,80 Meter lang
Vorkommen: Obere Kreidezeit Funde: Mongolei (Asien)
Systematik: Saurischia, Theropoda, Coelurosauria, Deinonychosauria, Dromaeosauridae
Erstbeschreibung: Barsbold 1983
Der Raub-Dinosaurier Adasaurus lebte in der Oberen Kreidezeit vor etwa 70 bis 68 Millionen Jahren in der Mongolei (Asien). Die wissenschaftliche Erstbe- schreibung erfolgte 1983 durch den mongolischen Paläontologen Rinchen Barsbold. Der Gattungsname besteht aus dem Wort Ada, einem bösen Geist aus mongolischen Mythologie, und dem griechischen Begriff sauros (Echse). Die einzige Art heißt Adasaurus mongoliensis. Adasaurus ist ein wenig bekannter Dromaeosaurier. Der etwa 1,80 Meter lange Dinosaurier unterscheidet sich durch die geringe Größe des Endgliedes der zweiten Zehe mit der für Dromaeo- sauriden typischen sichelförmigen Klaue.
Afrovenator
Name: Jäger aus Afrika
Größe: etwa 9 Meter lang
Vorkommen: Untere Kreidezeit Funde: Niger (Afrika)
Systematik: Saurischia, Theropoda, Spinosauroidea, Megalosauridae, Eustreptospondylinae
Erstbeschreibung: Sereno, Wilson, Larsson, Dutheil und Sues 1994
Der zweibeinig gehende Raub-Dinosaurier Afrovenator lebte in der Unteren Kreidezeit vor etwa 130 bis 125 Millionen Jahren im Niger (Afrika). Fossile Reste dieses Tieres hat man 1993 in der Tiouarén-Formation in der Ténére-Wüste bei Agadez im Niger (Afrika) entdeckt. Dabei handelte es sich um einen teilweise erhaltenen Schädel, das fast komplette Becken, Vorderbeine, Hinterbeine sowie Teile von Hals-, Rumpf- und Schwanzwirbelsäule. Der Fund gilt als einer der vollständigsten Theropoden aus der Kreidezeit in Afrika. Afrovenator wurde 1994 von den Paläontologen Paul C. Sereno, J. A. Wilson, Hans Larsson, Didier Dutheil und Hans-Dieter Sues erstmals wissenschaftlich beschrieben. Man betrachtete ihn zunächst als frühen Tetanurae, dann als primitiven Allosauridae und schließlich als Megalosauridae.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Lebensbild von Afrovenator,
Zeichnung von Mariana Ruiz Villarreal (LadyofHats) bei „Wikipedia“
Nobumichi (Nobu)Tamura, geboren 1966, ist ein Paläoartist. Er lebt derzeit in Concord (Kalifornien). Bis heute hat er insgesamt rund 1.000 Bilder von prähistorischen Tieren angefertigt. Allein für das Online-Lexikon „Wikipedia“ erstellte er seit 2007
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
etwa 700 Zeichnungen. Außerdem schuf er Bilder für Ausstellungen in Museen, Bücher, und TV-Dokumentationen. Tamura ist der Gründer und Webmaster der Internetseite www.palaeocritti.com. In diesem Buch wird mit freundlicher Genehmigung von Nobu Tamura eine Auswahl seiner Werke bei „Wikipedia“ abgedruckt.
Albertonykus
Name: Kralle von Alberta
Größe: etwa 75 Zentimeter lang Vorkommen: Obere Kreidezeit Funde: Nordamerika
Systematik: Saurischia, Theropoda, Coelurosauria, Maniraptora, Alvarezsauridae
Erstbeschreibung: Ryan 2007
Albertonykus aus der Oberen Kreidezeit vor etwa 70 Millionen Jahren gilt als der kleinste Dinosaurier aus Nordamerika. Er hatte etwa die Größe eines Haushuhns und erreichte mit Schwanz nur eine Gesamtlänge von rund 75 Zentimetern. Bisher gelang lediglich ein Fund von Albertonykus aus der Horseshoe-Canyon-Formation nahe der Stadt Red Deer in der kanadischen Provinz Alberta. Dabei handelt es sich um die Vorder- und Hintergliedmaßen von mindestens zwei Dinosauriern aus dem „Albertosaurus-Bonebed“. Letztere ist ein Knochenlager im „Dry Island Buffalo Jump Provincial Park“, in dem Fossilien von mehr als 20 Tieren des Tyrannosauriers Albertosaurus sarcophagus überwiegen. An Fundstellen in der Nähe barg man zudem einige Zehenknochen. Die fossilen Reste von Albertonykus wurden während einer Grabung zwischen 2000 und 2003 unter Leitung von Philip J. Currie gefunden und im „Royal Tyrell Museum of Palaeontology“ bei Drumheller aufbewahrt. Dort wurden sie 2006 von Nicholas R. Longrich identifiziert. Die wissenschaftliche Erstbeschreibung erfolgte 2008 durch die Paläontologen Nicholas R. Longrich und Philip J. Currie. Der Name der einzigen Art Albertonykus borealis bezieht sich auf das lateinische Wort boreus (nördlich). Albertonykus wird zu den Alvarezsauridea, einer Gruppe insektenfres- sender Dinosaurier, gestellt, die bisher nur aus der kana- dischen Provinz Alberta nachgewiesen ist. Mit den kur- zen und kräftigen Vordergliedmaßen konnte Alberto- nykus in Insektennestern, die sich in Holz befanden, graben. In verkieseltem Holz aus der Horseshoe-Can- yon-Formation fand man oft Gangsysteme, die denen einer heutigen Termitenfamilie ähneln.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Lebensbild von Albertonykus borealis.
Zeichnung von „Karkemish“ bei „Wikipedia“
Albertosaurus
Name: Alberta-Echse
Größe: etwa 9 Meter lang
Vorkommen: Obere Kreidezeit
Funde: Alberta (Kanada), Montana (USA)
Systematik: Saurischia, Theropoda, Tyrannosauroidea, Tyrannosauridae, Albertosaurinae
Erstbeschreibung: Osborn 1905
Der Raub-Dinosaurier Albertosaurus lebte in der Oberen Kreidezeit vor etwa 73 bis 70 Millionen Jahren in Nordamerika. 1884 entdeckte man in der Horseshoe- Canyon-Formation am Red Deer River in der kanadischen Provinz Alberta den ersten teilweise erhaltenen Schädel dieses Tieres. Dieser sowie ein kleinerer Schädel und einige Skelettknochen wurden bei Expeditionen der „Geological Survey of Canada“ unter Leitung des kanadischen Geologen Joseph Tyrell (1858- 1957) gefunden. Der amerikanische Paläontologe Edward Drinker Cope (1840-1897) ordnete die beiden Schädel 1892 der bereits bekannten Art Laelaps incrassatus zu, obwohl der Name Laelaps bereits für eine Milbe vergeben war und deswegen geändert werden musste. 1877 taufte der amerikanische Paläontologe Othniel Charles Marsh (1831-1899) Laelaps in Dryptosaurus um, was sein Erzrivale Cope nicht anerkannte. Der kanadische Paläontologe Lawrence Morris Lambe (1863-1919) schrieb Laelaps incrassatus dem Dryptosaurus incrassatus zu, als er die Funde 1904 beschrieb. Wenig später fiel dem amerikanischen Paläontologen Henry Fairfield Osborn (1857-1935) auf, dass der Typ von Dryptosaurus incrassatus auf einem typischen, nicht weiter zuzuordnenden Tyrannosauriden-Zahn basierte, wes- halb er die beiden Schädel aus Alberta nicht zuverlässig dieser Gattung zuordnen konnte. 1905 prägte Osborn den neuen Namen Albertosaurus sarcophagus. Der Gat- tungsname Albertosaurus beruht auf dem Fundort Alberta und dem griechischen Wort sauros (Echse). Der Begriff sarcophagus besteht aus dem altgriechischischen sarx (Fleisch) und phagein (fressen), und bedeutet demnach Fleischfresser. Albertosaurus und Gorgosaurus bilden die Unterfamilie Albertosaurinae. Einige Ex- perten glauben sogar, die 1914 von Charles Hazelius Sternberg (1850-1943) wissenschaftlich beschriebene Art Gorgosaurus libratus sei mit Albertosaurus sarcophagus identisch. Albertosaurus gehörte zu den Tyrannen-Echsen (Tyrannosaurier), die massiv gebaut waren sowie einen großen Kopf mit Dutzenden großen, scharfen Zähnen und einen kurzen Rumpf hatten. Der Schädel von Albertosaurus erreichte eine Länge bis zu einem Meter und saß auf einem kurzen, S-förmigen Hals. Über den Augen befanden sich kurz knöcherne Kämme, die vielleicht zur Brautwerbung leuchtend bunt gefärbt waren. In den langen Kiefern saßen mehr als 60 bananen- förmige Zähne, die je nach Position unterschiedlich groß und geformt waren. Die kurzen Arme trugen nur zwei Finger und reichten nicht bis zum Maul. Alberto- saurus wog zu Lebzeiten schätzungsweise etwa 1,3 bis 1,7 Tonnen. Erwachsene Tiere jagten vermutlich die zahlreich vorhandenen Entenschnabel-Dinosaurier (Anatosaurier). Bisher sind fossile Reste von mehr als 30 Tieren der Gattung Albertosaurus in der Horseshoe- Canyon-Formation in Kanada gefunden worden. Die Entdeckung von 22 Tieren in einem Steinbruch entlang des Red Deer River in Alberta wird als Hinweis auf ein eventuelles Leben im Rudel gedeutet. Auf diese Fundstelle war 1910 der amerikanische „Dinosaurier- Jäger“ Barnum Brown (1873-1963) gestoßen. Anschlie- ßend wurden dort fossile Reste von neun Alberto- sauriern geborgen. 1997 spürte das „Royal Tyrell Muse- um of Palaeontology“ jene Fundstelle wieder auf und legte bis 2005 Fossilien von weiteren 13 Albertosauriern frei.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Skelettrekonstruktion des Raub-Dinosauriers Albertosaurus im „Royal Tyrell Museum of Palaeontology“ bei Drumheller
Alectrosaurus
Name: Alleinstehende Echse
Größe: etwa 5 Meter lang und 2,50 Meter hoch Vorkommen: Obere Kreidezeit
Funde: China, Mongolei (Asien)
Systematik: Tetanurae, Avetheropoda, Coelurosauria, Theropoda, Tyrannosauroidea
Erstbeschreibung: Gilmore 1933
Der schlank gebaute Raub-Dinosaurier Alectrosaurus existierte in der Oberen Kreidezeit vor etwa 99 bis 83 Millionen Jahren. Weil von ihm nur spärliche Reste vorliegen, ist ungewiss, ob er zu den Tyrannen-Echsen (Tyrannosaurier) gehört. Experten schätzen das Le- bendgewicht von Alectrosaurus auf etwa 500 Kilogramm bis 1,5 Tonnen. Alectrosaurus wurde 1933 von dem amerikanischen Paläontologen Charles W. Gilmore (1874-1945) erstmals wissenschaftlich beschrieben. Ihm hatten fossile Reste aus der Iren-Dabasu-Formation in der nordchinesischen autonomen Region Innere Mon- golei zur Untersuchung vorgelegen. Weil die Knochen von Alectrosaurus am Fundort zusammen mit den Armknochen eines anderen Dinosauriers entdeckt wurden, kam es zu einer falschen Rekonstruktion mit ungewöhnlich langen Armen. Man identifizierte später die Armknochen als diejenigen eines Segnosauriers.
Alioramus
Name: Anderer Zweig
Größe: etwa 5 bis 6 Meter lang Vorkommen: Obere Kreidezeit Funde: Mongolei (Asien)
Systematik: Saurischia, Theropoda, Tyrannosauroidea, Tyrannosauridae, Tyrannosaurinae
Erstbeschreibung: Kurzanov 1976
Der Raub-Dinosaurier Alioramus lebte in der Oberen Kreidezeit vor etwa 70 bis 65 Millionen Jahren in der Mongolei (Asien). Er wird zu den Tyrannen-Echsen (Tyrannosaurier) gerechnet. Im Gegensatz zu anderen Tyrannosauriern hatte er aber einen niedrigen Schädel und eine relativ lange Schnauze. Zwischen seinen Augen und der Schnauzenspitze befanden sich fünf Knochenhöcker, die vielleicht bei den Männchen deutlicher ausgeprägt waren als bei den Weibchen. Mit insgesamt 76 bis 78 Zähnen besaß Alioramus mehr Zähne als jeder andere Tyrannosaurier. Alioramus wurde 1976 von dem russischen Paläontologen Sergei Kur- zanov erstmals wissenschaftlich beschrieben. Der Gattungsname Alioramus besteht aus den lateinischen Wörtern alius (anders) und ramus (Zweig). Bisher liegen zwei Skelettfunde aus der Mongolei vor, die zwei verschiedenen Arten zugeordnet werden: Alioramus remotus (1976) und Alioramus altai (2009). Manche
Experten glauben, Alioramus sei eng mit seinem Zeitgenossen Tarbosaurus („Furchteinflößende Echse“) verwandt oder sogar ein Jungtier dieser Gattung.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Lebensbild von Alioramus.
Zeichnung von Nobu Tamura bei „Wikipedia“
Allosaurus
Name: Andersartige Echse
Größe: etwa bis zu 12 Meter lang Vorkommen: Obere Jurazeit
Funde: Colorado, Wyoming, Utah (USA), Europa Systematik: Saurischia, Theropoda, Carnosauria, Allosauridae
Erstbeschreibung: Marsh 1877
Der Raub-Dinosaurier Allosaurus aus der Oberen Jura- zeit vor etwa 155 bis 145 Millionen Jahren wurde 1877 von dem amerikanischen Paläontologen Othniel Charles Marsh (1831-1899) erstmals wissenschaftlich beschrie- ben. Der Name „Andersartige Echse“ beruht darauf, dass die Wirbelknochen anders als bei den bis dahin bekannten Dinosaurier-Wirbeln gestaltet waren. Allosaurus gilt als gefährlichster Raub-Dinosaurier der Jurazeit in Nordamerika. In der Morrison-Formation kamen 44 Exemplare dieser Gattung zum Vorschein, darunter Jungtiere von etwa drei Meter Länge. Die Morrison-Formation, eine Schichtenfolge aus der Oberen Jurazeit, ist nach einem Ort in Colorado benannt und erstreckt sich von Montana südwärts bis New Mexico. Erwachsene Allosaurier wogen mehrere Tonnen und hatten einen etwa 90 Zentimeter langen Kopf mit zwei großen Augenhöckern. Der Hals war kurz, dick, kräftig und sehr beweglich. Die relativ kurzen und ebenfalls kräftigen Arme endeten mit einer drei- fingrigen Hand mit scharfen Krallen. Allosaurus ging zweibeinig auf den langen, mächtigen, bekrallten Hinterbeinen. Sein langer Schwanz diente vermutlich zum Balancieren. Über die Lebensweise von Allosaurus sind sich die Experten uneins. Man hält ihn entweder für einen erfolgreichen Aasfresser oder für einen gewandten Jäger, der im Rudel sogar große Elefantenfuß- Dinosaurier zur Strecke bringen konnte. Die leichte Bauweise mit kräftigen Hinterbeinen deutet eher auf einen Jäger hin. Der Schädel konnte sehr hohe Belastungen aushalten, wie sie beim reinen Zerkauen eines Kadavers nicht auftreten, wohl aber bei der Jagd auf ein lebendes Beutetier. An den Schwanzknochen eines Elefantenfuß-Dinosauriers der Gattung Apato- saurus verraten Bissspuren von Allosaurus, dass dieser sich an Kadavern solcher großen Tiere gütlich tat. Nach Ansicht von amerikanischen Forschern konnten sich große Dinosaurier wie Allosaurus bereits im Alter von zehn Jahren fortpflanzen. Zeitgenossen von Allosaurus waren die pflanzenfressenden Dinosaurier Stegosaurus, Brachiosaurus und Diplodocus. Als Nahrungskonkurrenten gelten die Raub-Dinosaurier Torvosaurus und Ceratosaurus. Kleinere Raub-Dinosaurier wie Ornitholestes oder Coelurus konkurrierten höchstens mit Jungtieren von Allosaurus und waren bei erwachsenen Tieren eher Beutetiere.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Skelett (oben) und Schädel (unten links) von Allosaurus fragilis im „San Diego Natural History Museum“. Unten rechts der amerikanische Paläontologe Othniel Charles Marsh (1831- 1899), der Allosaurus 1877 wissenschaftlich beschrieb.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
- Quote paper
- Ernst Probst (Author), 2010, Raub-Dinosaurier von A bis Z, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281928