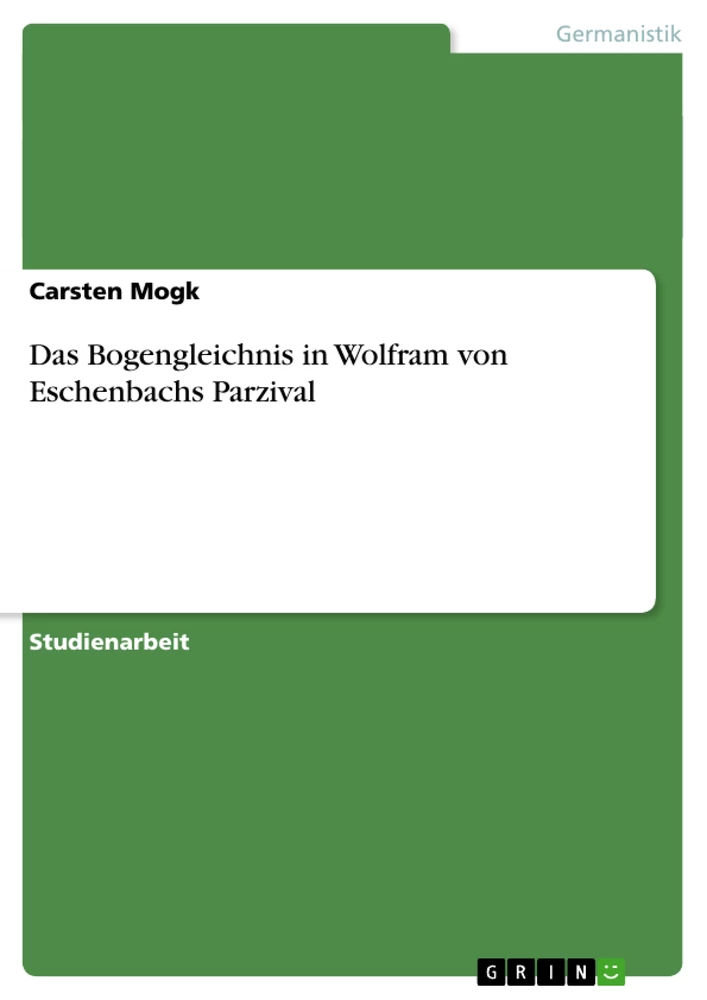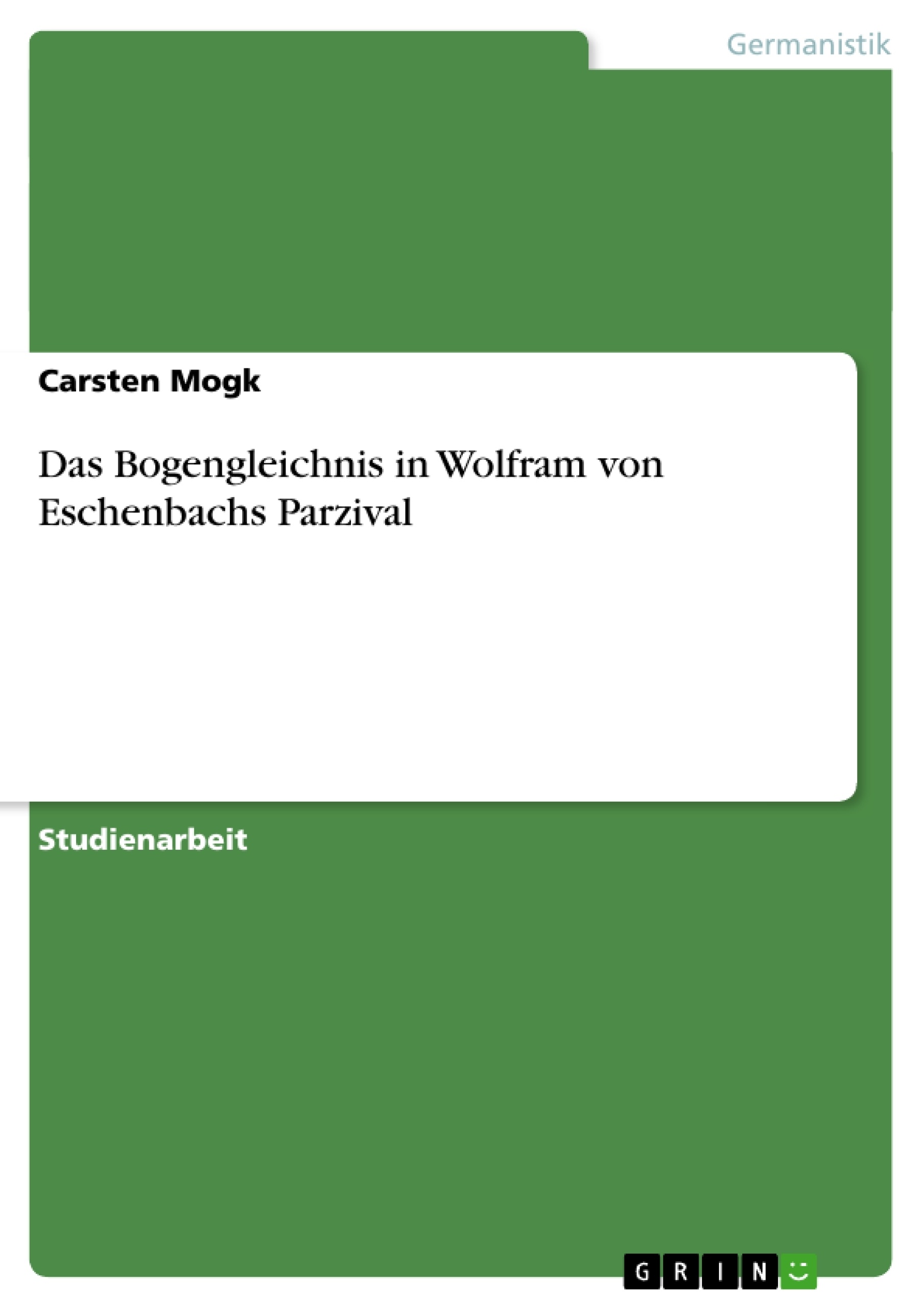Wolfram von Eschenbachs Parzival stellt innerhalb der mittelalterlichen Epen eines der herausragensten literarischen Werke dar. Voller mehrdeutiger Sinngehalte erschließt sich die Erzählung, auch auf Grund des anspruchsvollen sprachlichen Stils des Autors, nicht auf den ersten Blick. Innerhalb dieses Kunstwerks fallen immer wieder Passagen auf, wie der Prolog, die die Germanisten seit jeher zu verschiedensten Interpretationen anregen. Die meistdiskutierte Textstelle findet sich jedoch im Bogengleichnis wieder, zu dem unzählige Interpretationen erschienen sind. Die vorliegende Hausarbeit soll einen Überblick über die wichtigsten Interpretationsansätze geben und die verschiedenen Deutungen vergleichen. Dabei ist es mir ein besonderes Anliegen die Argumentationsstruktur innerhalb der ausgewählten Aufsätze nachzuvollziehen und die Ausführungen auf Schlüssigkeit zu überprüfen. Dabei soll immer wieder das Augenmerk auf dem mittelhochdeutschen Text liegen, wobei mir als Grundlage die Übersetzung nach Karl Lachmann diente. Die wichtigste Aufgabe bestand zunächst in der Auswahl der wichtigsten Interpretationsansätze. Ich habe mich dabei von zwei Kriterien leiten lassen. Als erstes war es mir wichtig diejenigen Interpretationen herauszustellen, die am „extremsten“ divergieren, zum Anderen spielte natürlich auch die Verfügbarkeit der Texte eine, wenn auch geringe Rolle, da zumindest in Berlin der größte Teil der Aufsätze verfügbar war.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einordnung des „Bogengleichnisses“ in das Gesamtwerk des Parzival
- Interpretationsansätze der neueren Forschung
- Die Unmöglichkeit des slehten Erzählens ohne krümbe
- Die naturgemäße slehte der Erzählung
- Das Bogengleichnis als Zäsur
- Die biuge als Voraussetzung der slehte
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit soll die Interpretation des „Bogengleichnisses“ in Wolframs Parzival im Diskurs der neueren Forschung analysieren und vergleichen. Dabei wird die Argumentationsstruktur der ausgewählten Aufsätze untersucht, die Schlüssigkeit ihrer Ausführungen geprüft und der mittelhochdeutsche Text als Grundlage herangezogen. Die Arbeit konzentriert sich auf die wichtigsten Interpretationsansätze, die sich stark unterscheiden und im Bereich der Verfügbarkeit in Berlin zugänglich waren.
- Das „Bogengleichnis“ als Metapher für Wolframs Erzähltechnik
- Die Beziehung zwischen „krumm“ und „sleht“ als zentrale Interpretationsfolie
- Die Rolle des Bogengleichnisses im Kontext der gesamten Parzival-Handlung
- Die Auseinandersetzung mit konkurrierenden Autoren der Zeit
- Die Interpretation des Bogengleichnisses als Ausdruck der mittelalterlichen Weltanschauung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Kontext der Hausarbeit dar und hebt die Bedeutung des „Bogengleichnisses“ innerhalb der Parzival-Forschung hervor. Die Arbeit zielt auf die Analyse und den Vergleich der wichtigsten Interpretationsansätze sowie auf die Überprüfung ihrer Schlüssigkeit.
Einordnung des Bogengleichnisses in das Gesamtwerk des Parzival
Dieser Abschnitt beschreibt die Position des „Bogengleichnisses“ innerhalb des Gesamtwerks des Parzival in Bezug auf numerische Einteilung und inhaltlichen Kontext. Es wird auf die Rolle des Gleichnisses als Einschub in der Handlung und die damit verbundene Spannung im Handlungsverlauf eingegangen.
Interpretationsansätze der neueren Forschung
Dieser Abschnitt präsentiert die wichtigsten Interpretationsansätze der neueren Forschung zum „Bogengleichnis“, wobei der Fokus auf der Beziehung zwischen „krumm“ und „sleht“ als zentrale Interpretationsfolie liegt. Die unterschiedlichen Deutungen werden vorgestellt und ihre Auswirkungen auf das Verständnis des Bogengleichnisses im Kontext der gesamten Parzival-Handlung werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Wolfram von Eschenbach, Parzival, Bogengleichnis, krumm, sleht, Erzähltechnik, Interpretation, mittelalterliche Literatur, Forschungsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Bogengleichnis in Wolframs „Parzival“?
Das Bogengleichnis ist eine berühmte Textstelle, in der Wolfram von Eschenbach seine Erzähltechnik mit einem Bogen vergleicht. Es thematisiert das Verhältnis von „krumm“ (biuge) und „gerade“ (sleht) im Erzählfluss.
Welche Bedeutung haben die Begriffe „krumm“ und „sleht“?
Sie dienen als Metaphern für die Erzählweise. „Krumm“ steht für Umwege, Einschübe und komplexe Strukturen, während „sleht“ für eine einfache, lineare Erzählweise steht, die Wolfram oft ironisch hinterfragt.
Warum gilt das Bogengleichnis als Zäsur im Werk?
Viele Forscher sehen darin einen Moment, in dem der Autor direkt zum Publikum spricht, um seine poetologischen Prinzipien zu erläutern und sich von zeitgenössischen Konkurrenten abzugrenzen.
Wie wird das Gleichnis in der neueren Forschung interpretiert?
Die Ansätze divergieren stark: Einige sehen die „Krümme“ als notwendige Voraussetzung für die Wahrheit der Erzählung, andere betrachten sie als rein stilistisches Mittel zur Spannungssteigerung.
Welche Rolle spielt der mittelhochdeutsche Originaltext für die Deutung?
Die präzise Analyse der mittelhochdeutschen Begriffe ist entscheidend, da moderne Übersetzungen oft die vielschichtigen Wortbedeutungen Wolframs nicht vollständig erfassen können.
- Arbeit zitieren
- Carsten Mogk (Autor:in), 2004, Das Bogengleichnis in Wolfram von Eschenbachs Parzival, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28194