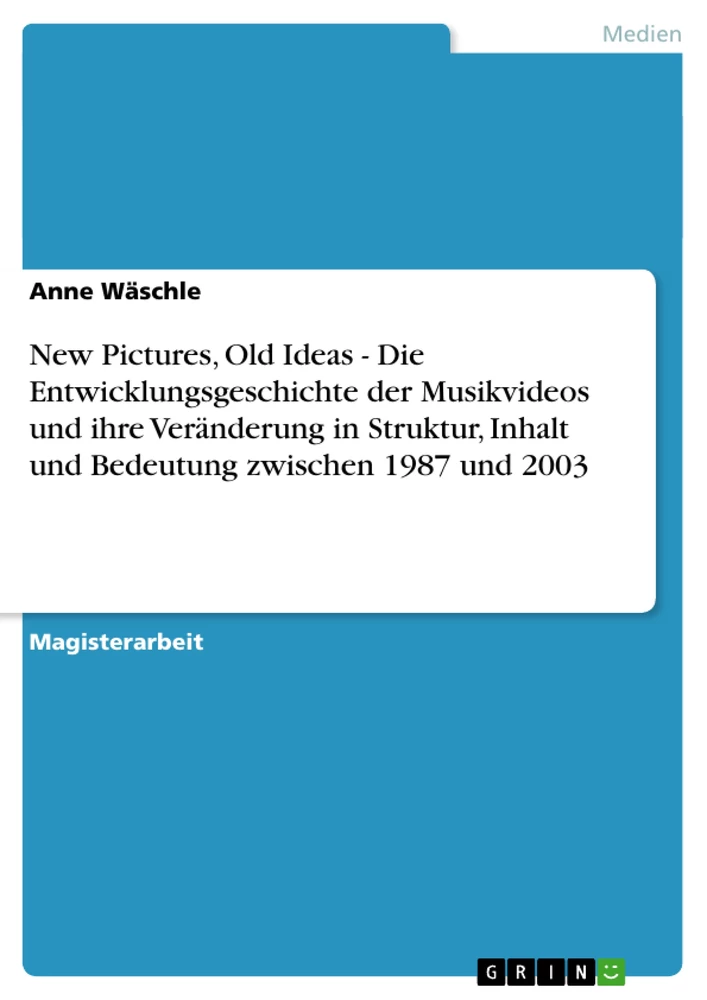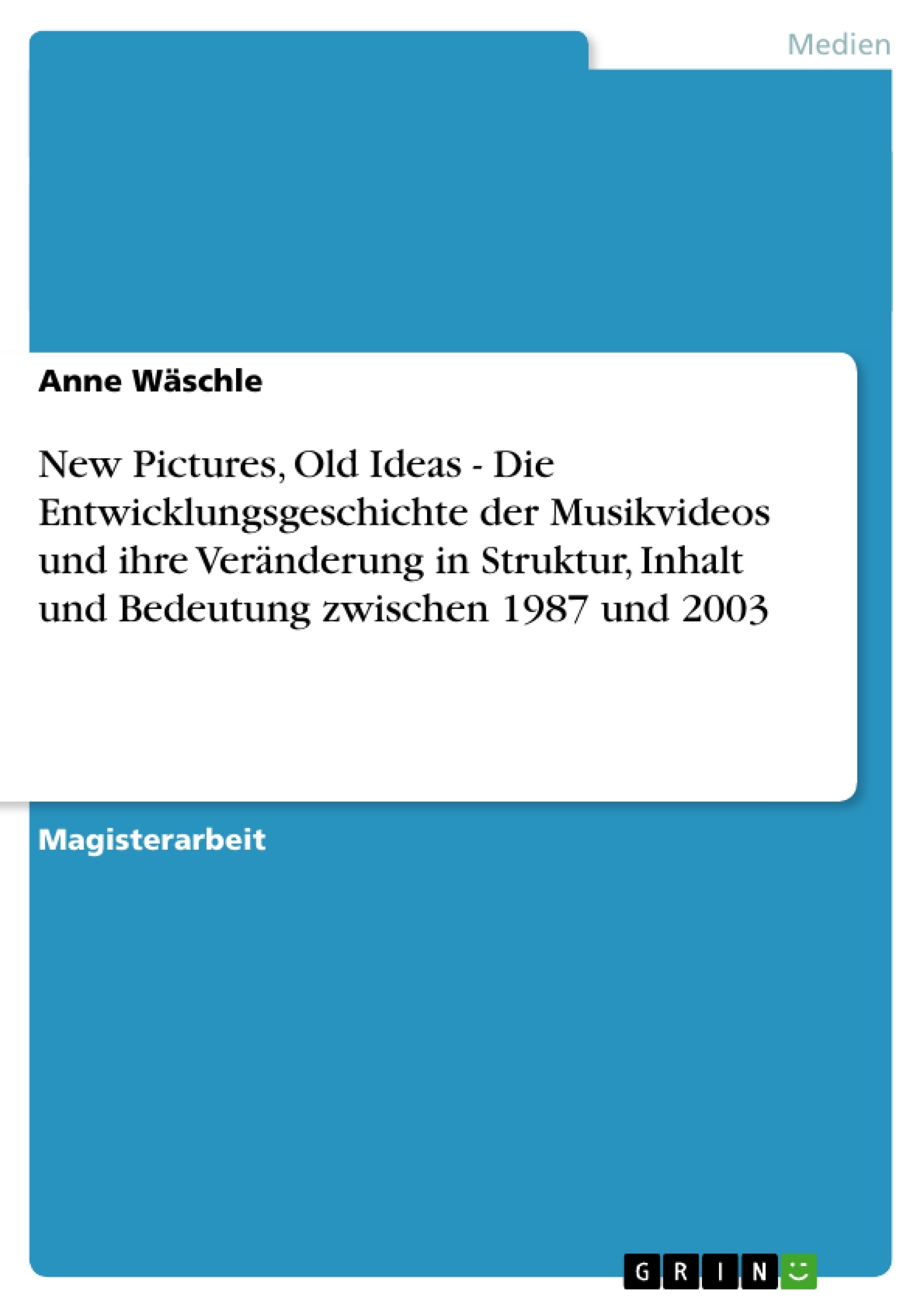Am Anfang war der Ton. Der macht die Musik und diese die Menschen glücklich – zeitweilig zumindest. Denn nicht in der Musik allein liegt die Begründung für die Faszination, die Musikvideos ausüben. Jeder, der beim Zapping zum ersten Mal über einen Musikvideokanal stolpert, bleibt unwillkürlich hängen. Schnell, bunt und laut kommen die mehrminütigen kleinen Beiträge, die einen Star und seinen Song preisen, daher. Oftmals für das ungeübte Auge kaum zu entschlüsseln. Was ist die Botschaft? Worum geht es? Was will mir der Künstler damit sagen? – „Kaufe meine Platte! Kaufe meine Platte!“ hört man sie zwischen den Bildern flüstern. Für Stars, Sternchen und ihre Macher ist Musik nicht nur Spaß, Erfüllung und Ruhm, sondern vor allem Broterwerb. Musikvideos sind ebenso essentiell wie Konzerttouren und Fernsehshowauftritte. Sie sichern die Verbreitung des Produktes, erhöhen im besten Fall (heavy rotation) die Beliebt- und Bekanntheit des Interpreten und seine Verkaufszahlen.
Jede Liedermacherin mit Gitarre, jede Boy- oder Girlgroup, jeder Gangster-Rapper und jeder Alternative-Rocker braucht heute ein passendes Video, das ihre oder seine Präsenz auf einem Musikkanal und in den Köpfen der Zielgruppe sichert. Möchte man im Musikbusiness Karriere machen, dann muss man sich an diese einfache Regel halten. Kein Clip, kein Erfolg. Also entstehen Jahr für Jahr tausende Videos für große und kleine Stars. Wen wundert es da, dass Kritiker eine Vereinheitlichung beklagen? Die meisten Musikvideos sind nur für wenige Wochen auf den Bildschirmen zu sehen, die allerwenigsten schaffen es zum Clipklassiker und werden auch nach Monaten oder Jahren noch ausgestrahlt. Den Beteiligten bleibt, auch in Anbetracht der Tatsache, dass Videos selten länger als vier Minuten dauern, wenig Zeit, das Image einer Musikerin, eines Musikers oder einer Band so zu vermitteln, dass die jungen Zuschauer sich dadurch angesprochen fühlen und bestenfalls einen Kaufwunsch entwickeln. Das schmale Zeitfenster beschränkt Art und Tiefe der Darstellung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist ein Musikvideo? Begriffsbestimmung
- Die historische Entwicklung der Musikvideos
- Von den historischen Vorläufern bis zur Herausbildung der Musikvideos
- Frühe Formen der Verbindung von Ton und Bild und der Diskurs über die Beziehung beider Elemente zueinander
- Die visuelle Musik
- Einflüsse aus den Bereichen des kommerziellen Kinos und der Musik
- Von den ersten Videoclips bis zu MTV
- Die Musikkanalentwicklung
- Der Werdegang von MTV
- Musikvideos im deutschen Fernsehen
- Musikvideos im Jahr 2003
- Ausblick
- Von den historischen Vorläufern bis zur Herausbildung der Musikvideos
- Die Analyse der Musikvideos
- Das Klassifizierungsmodell nach Michael Altrogge
- Der Musik-Aspekt und die drei Musikstile
- Die Darstellungsebenen
- Die reine Performance
- Die Konzeptperformance
- Konzept mit Interpreten
- Konzept ohne Interpret
- Die Ausnahmen
- Visuelle Binnenstruktur
- Rahmenbedeutungen der externen Bilder
- Zur Auswahl und ihrer Begründung
- Die Beschreibung der Musikvideos
- Die Videoauswahl 1987
- Vanessa Paradis - Joe le Taxi
- Boy George - Everything I Own
- Black - Wonderful Life
- George Harrison - I Got My Mind Set on You
- Samantha Fox - Nothing's Gonna Stop Me Now
- Kim Wilde - You Keep Me Hangin' on
- Peter Gabriel - Big Time
- Hot Chocolate - You Sexy Thing
- Iggy Pop - Real Wild Child
- Die Videoauswahl 2003
- Oasis Songbird
- 50 Cent - In da Club
- B2K featuring P. Diddy – Bump, Bump, Bump
- Missy Elliot - Gossip Folks
- Curse - Hand hoch
- Moloko - Familiar Feeling
- Holly Valance - Naughty Girl
- Placebo - Bitter End
- Good Charlotte - Lifestyle of the Rich and Famous
- Die Videoauswahl 1987
- Vergleich der ausgewählten Videos von 1987 und 2003
- Die Überprüfung der Thesen
- Es bleibt alles anders - Die Ergebnisdiskussion
- Das Klassifizierungsmodell nach Michael Altrogge
- Die Entwicklung des Musikvideos vom historischen Vorläufer bis zum MTV-Zeitalter
- Die Rolle von Musikkanälen und wirtschaftlichen Interessen
- Die Analyse der Musikvideos anhand eines Klassifikationsmodells
- Der Vergleich von Musikvideos aus den Jahren 1987 und 2003
- Die Auswirkungen von technischen Innovationen und kulturellen Einflüssen auf die Musikvideoästhetik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Entwicklung der Musikvideos zwischen 1987 und 2003. Sie verfolgt das Ziel, die Veränderungen in Struktur, Inhalt und Bedeutung dieses Mediums zu analysieren und die Ursachen und Folgen dieser Entwicklung aufzuzeigen.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in das Thema und die Problemstellung der Arbeit. Es wird die Bedeutung des Musikvideos im Kontext der Musikindustrie und der Jugendkultur hervorgehoben.
Kapitel zwei definiert den Begriff des Musikvideos und beleuchtet verschiedene Perspektiven auf dieses Medium. Es wird die Entstehung und Entwicklung des Musikvideos in Verbindung mit der Entstehung von Musikkanälen wie MTV und VIVA beschrieben. Die Rolle von wirtschaftlichen Interessen und kulturellen Einflüssen wird dabei hervorgehoben.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Analyse der Musikvideos anhand eines Klassifikationsmodells. Es werden verschiedene Aspekte des Musikvideos wie die Darstellungsebenen, die visuelle Binnenstruktur und die Rahmenbedeutungen der externen Bilder analysiert.
Das vierte Kapitel beinhaltet die Beschreibung der Musikvideos. Es werden ausgewählte Videos aus den Jahren 1987 und 2003 vorgestellt und anhand des Klassifikationsmodells analysiert. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Videos aus beiden Zeitpunkten werden herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Musikvideo, Musikkanal, MTV, VIVA, visuelle Musik, Jugendkultur, Musikästhetik, Klassifikationsmodell, Altrogge, Entwicklung, Veränderung, Struktur, Inhalt, Bedeutung.
Häufig gestellte Fragen
Wie haben sich Musikvideos zwischen 1987 und 2003 verändert?
Die Arbeit zeigt eine Entwicklung in Struktur und Inhalt auf, wobei wirtschaftliche Interessen der Musikindustrie und technische Innovationen die Ästhetik zunehmend prägten.
Welche Rolle spielten Musikkanäle wie MTV und VIVA?
Diese Kanäle machten Musikvideos zu einem essentiellen Marketinginstrument ("Kein Clip, kein Erfolg") und beeinflussten die Sehgewohnheiten der Jugendlichen massiv.
Was ist das Klassifizierungsmodell nach Michael Altrogge?
Ein Modell zur Analyse von Musikvideos, das zwischen verschiedenen Darstellungsebenen wie reiner Performance, Konzeptperformance und visueller Binnenstruktur unterscheidet.
Welche Künstler werden in der Videoanalyse von 1987 untersucht?
Unter anderem werden Videos von Vanessa Paradis, Peter Gabriel, George Harrison und Kim Wilde analysiert.
Welche Trends lassen sich in den Videos von 2003 feststellen?
Es zeigt sich eine stärkere Professionalisierung und Kommerzialisierung, beispielhaft analysiert an Künstlern wie 50 Cent, Missy Elliott und Good Charlotte.
Sind Musikvideos mehr als nur Werbung für Plattenverkäufe?
Obwohl sie primär dem Broterwerb dienen, werden sie in der Arbeit auch als eigenständige Kunstform und Spiegel der Jugendkultur betrachtet.
- Arbeit zitieren
- Anne Wäschle (Autor:in), 2003, New Pictures, Old Ideas - Die Entwicklungsgeschichte der Musikvideos und ihre Veränderung in Struktur, Inhalt und Bedeutung zwischen 1987 und 2003, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28199