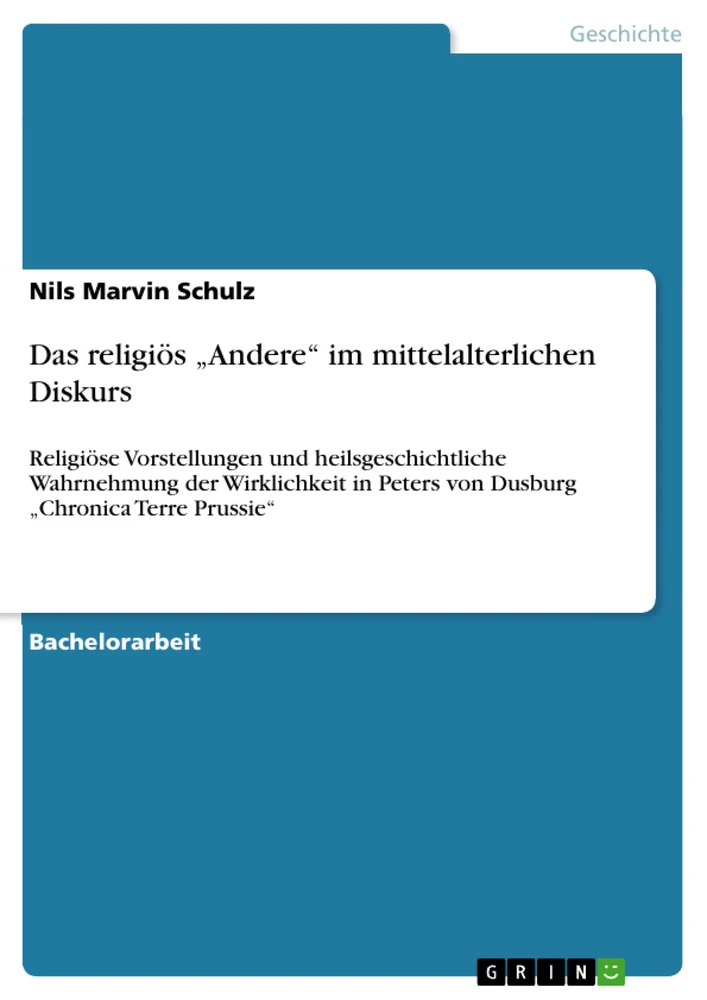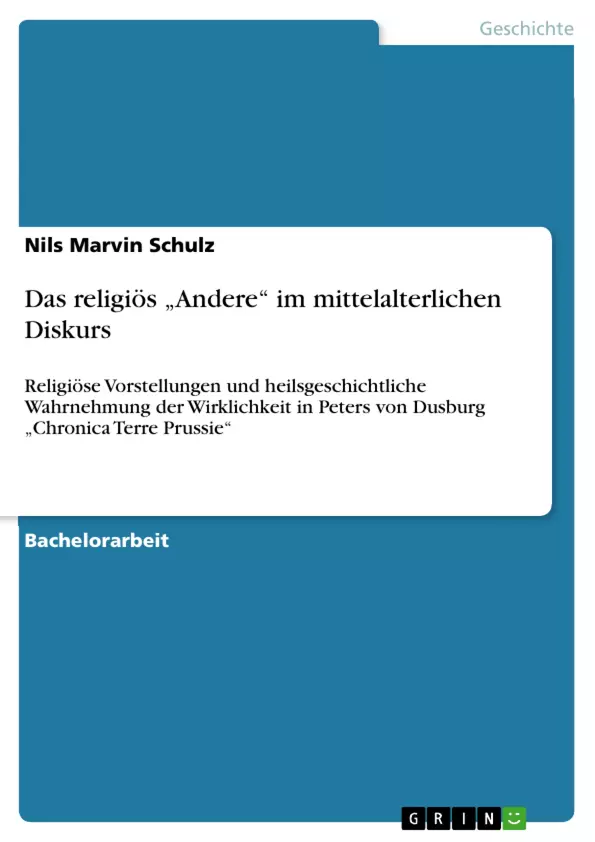In der mittelalterlichen Wahrnehmungs- und Vorstellungswelt nahm das Christentum ohne Zweifel eine herausragende Position ein. Kein aus heutiger Sicht noch so profan anmutender Bereich war nicht durchdrungen von bestimmten religiösen Vorstellungen.
Bedient man sich zum besseren Verständnis der weder in der Forschungsliteratur noch bei Michel Foucault selbst keineswegs kohärent formulierten Diskurstheorie, so wird ein theoretischer Ansatz zur Konstitution von Wahrheit und Wirklichkeit geboten. Sowohl für den französischen Philosoph und Psychologen als auch für die moderne Historiographie gibt es keine Universalien (allgemein gültige Aussagen) – also keine überzeitlichen bzw. ewigen Wahrheiten. Andernfalls wäre durch diese Art von Statik der Lauf der Geschichte vorhersagbar. Der Diskursbegriff bildet Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre das Zentrum von Foucaults Arbeit. Durch Diskurse werden Wirklichkeit und Wahrheit erzeugt, weshalb diese so sehr umkämpft seien. Diskurse wiederum seien eingebettet in verschiedene Dispositve, welche zu einer bestimmten Zeit bzw. historischen Epoche eine Art Netz oder Formation bestimmter diskursiver, praktischer und gegenständlicher – äußerst heterogener – Elemente bilden, die sich mit Wissen und Macht verbinden und damit eine Wirklichkeit konstituieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Worte in Bezug auf die mittelalterlich-christliche Ordnung in Verbindung mit methodologischen Überlegungen zu Michel Foucaults diskurstheoretischem Ansatz: Regulative Maßnahmen und die Konstitution von Wahrheit und Wirklichkeit durch Diskurse und Dispositive. Heranführung an den vorstellungsgeschichtlichen (Quellen-)Zugang
- Der Christentum-Dispositiv in der mittelalterlichen Ordnung: Konstitution von Wirklichkeit und Wahrheit
- Die Regulation des Christentum-Dispositivs durch die päpstliche Glaubenslehre: Markierung und Diffamierung des religiös „Anderen“ und der Eingriff in die Wirklichkeit
- Der doktrinäre Diskurs im Spannungsfeld der Konstitution von Wahrheit: Die Kirche als Garant des Seelenheils
- Methodologie und Konzept der vorliegenden Arbeit: Diskursfelder im Werk von Peters von Dusburg „Chronica Terre Prussie“
- Religions- und Gottesverständnis in Peters von Dusburg „Chronica Terre Prussie“
- Peters von Dusburg „Chronik des Preußenlandes“
- Der Diskurs des religiös „Anderen“ am Beispiel der „Heiden“ und der Weizen-Unkrautmetapher
- Heilsgeschichtliche Zeichenhaftigkeit der Welt: Das Eingreifen Gottes in Form von Zeichen und des göttlichen Strafgerichts
- Der Kreuzzugsdiskurs
- Fremd- und Eigenzuschreibungen in Peters Preußenchronik
- Das religiös,,Fremde“ und das „Eigene“ aus christlicher und heilsgeschichtlicher Perspektive
- Die moralisch-christliche Fremdzuschreibungsebene als „Interpretatio Christiana“
- Das,,aquilo\"-Konzept: Der „Norden“ als Sitz Satans
- Die,,Heiden“-Darstellung in der Preußenchronik
- Das Konzept des „heidnischen“ Unglaubens in Peters Preußenchronik
- Das Antisakrament
- Der Unglaube
- Die Laster und die bösen Werke
- Die zivilisatorisch-kulturelle Fremdzuschreibungsebene
- Zusammenfassung der Ergebnisse sowie abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit „Das religiös,,Andere\" im mittelalterlichen Diskurs. Religiöse Vorstellungen und heilsgeschichtliche Wahrnehmung der Wirklichkeit in Peters von Dusburg „Chronica Terre Prussie““ untersucht die Wahrnehmung des „Anderen“ im Kontext der mittelalterlichen christlichen Weltanschauung. Die Arbeit analysiert, wie Peters von Dusburg in seiner „Chronica Terre Prussie“ die religiösen Vorstellungen und heilsgeschichtlichen Konzepte seiner Zeit auf die Wahrnehmung der „Heiden“ in Preußen anwendet.
- Die Konstitution von Wahrheit und Wirklichkeit durch Diskurse im mittelalterlichen Christentum
- Die Rolle der Kirche in der Definition des „Anderen“ und der Bekämpfung von Häresie
- Die Darstellung von „Heiden“ in Peters von Dusburgs „Chronica Terre Prussie“ und die Verbindung zu heilsgeschichtlichen Konzepten
- Fremd- und Eigenzuschreibungen in der Preußenchronik und die Konstruktion von „Eigener“ und „Fremder“
- Der Einfluss von Machtstrukturen und Dispositiven auf die Wahrnehmung des „Anderen“ im Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beleuchtet die Konstitution von Wahrheit und Wirklichkeit im mittelalterlichen Christentum anhand von Michel Foucaults Diskurs- und Dispositivtheorie. Es wird argumentiert, dass das Christentum-Dispositiv eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der mittelalterlichen Ordnung spielte und durch die päpstliche Glaubenslehre reguliert wurde. Das Kapitel untersucht auch die Rolle der Kirche als Garant des Seelenheils und die Mechanismen der Markierung und Diffamierung des religiös „Anderen“.
- Kapitel zwei beschäftigt sich mit dem Religions- und Gottesverständnis in Peters von Dusburgs „Chronica Terre Prussie“. Der Diskurs des „Anderen“ wird am Beispiel der „Heiden“ in Preußen untersucht und die Weizen-Unkrautmetapher als Mittel zur Veranschaulichung der heilsgeschichtlichen Bedeutung der Welt interpretiert. Kapitel zwei analysiert auch die Zeichenhaftigkeit der Welt und das Eingreifen Gottes in Form von Zeichen und des göttlichen Strafgerichts.
- Das dritte Kapitel untersucht die Fremd- und Eigenzuschreibungen in Peters Preußenchronik. Es werden die Perspektiven des religiös „Fremden“ und des „Eigenen“ aus christlicher und heilsgeschichtlicher Sicht beleuchtet. Das Kapitel analysiert die moralisch-christliche Fremdzuschreibungsebene als „Interpretatio Christiana“ und untersucht insbesondere das „aquilo“-Konzept und die Darstellung der „Heiden“ in der Preußenchronik. Es werden verschiedene Aspekte des „heidnischen“ Unglaubens, wie Antisakrament, Unglaube und Laster, untersucht. Kapitel drei betrachtet auch die zivilisatorisch-kulturelle Fremdzuschreibungsebene, die den „Heiden“ ein niedrigeres Kulturniveau zuweist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen „religiös Anderer“, „Diskurs“, „Dispositiv“, „Heiden“, „Interpretatio Christiana“, „Heilsgeschichte“, „Kreuzzug“, „Fremd- und Eigenzuschreibung“, „aquilo“, „Antisakrament“, „Unglaube“ und „Laster“ im Kontext der mittelalterlichen christlichen Weltanschauung und der „Chronica Terre Prussie“ von Peters von Dusburg.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde das „Andere“ im Mittelalter wahrgenommen?
Das „Andere“ wurde primär durch die Linse des Christentums definiert, wobei Nicht-Christen oft als Heiden markiert und diffamiert wurden.
Welche Rolle spielt die Diskurstheorie von Foucault in dieser Arbeit?
Foucaults Theorie dient als methodischer Rahmen, um zu erklären, wie durch kirchliche Diskurse und Dispositive Wahrheit und Wirklichkeit im Mittelalter konstruiert wurden.
Was ist die „Interpretatio Christiana“?
Dies beschreibt die Umdeutung fremder Kulturen und Religionen aus einer rein christlichen Perspektive, oft um das Eigene aufzuwerten und das Fremde herabzusetzen.
Was besagt das „aquilo“-Konzept?
Es ist eine mittelalterliche Vorstellung, die den Norden (aquilo) als den Sitz Satans und den Ursprung des Bösen bzw. des Unglaubens symbolisierte.
Wer war Peter von Dusburg?
Er war ein Chronist des Deutschen Ordens, dessen Werk „Chronica Terre Prussie“ die Eroberung Preußens aus einer heilsgeschichtlichen Sicht darstellt.
- Quote paper
- Nils Marvin Schulz (Author), 2013, Das religiös „Andere“ im mittelalterlichen Diskurs, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282065