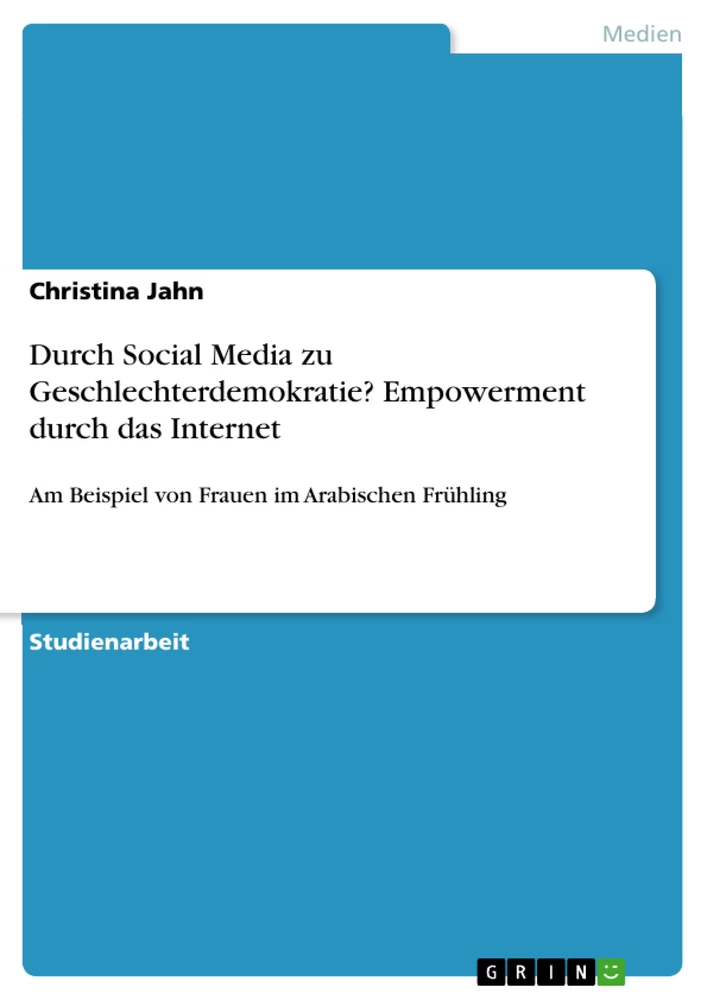Die Teilnahme von Frauen an den Protesten des Arabischen Frühlings weckte bei feministischen AktivistInnen in den betroffenen Ländern die Hoffnung, aus den gesellschaftlichen Umbrüchen würde auch eine verbesserte gesellschaftliche Stellung der Frau folgen. Der Arabische Frühling bot ihnen eine Plattform, um ihren Forderungen Gehör zu verschaffen. Dennoch wurde die Partizipation von Frauen an den Protestbewegungen durch patriarchalische Gesellschaftsstrukturen in vielen der betroffenen Ländern erschwert, und feministische Themen marginalisiert.
Am Beispiel von Frauen in arabischen Ländern und im Kontext des Arabischen Frühlings untersucht diese Arbeit welche Chancen das Internet für marginalisierte Bevölkerungsgruppen während sozialer Bewegungen bietet. Während des Arabischen Frühlings hat das Internet für Frauen die Möglichkeit geschaffen, sich auch dann aktiv an den Protesten zu beteiligen, wenn es ihnen aufgrund der patriarchalischen Strukturen nicht möglich war, im physischen Raum teilzunehmen. Nicht nur durch ihre physische, sondern auch schon durch ihre virtuelle Präsenz machten sie ihre Partizipation sichtbar und konnten so für einen Veränderung des traditionellen passiven Frauenbildes sorgen. Sie konnten ihre Anliegen auch dann in die Öffentlichkeit tragen, wenn ihnen der Zugang zu anderen Medienarten oder zum physischen Raum erschwert wurde oder verwehrt blieb.
Feministischer Diskurs im Internet ist potentiell transnational und bot damit die Möglichkeit, neue cross-kulturelle Erkenntnisse zu gewinnen und einen "Bumerang-Effekt" zu erzeugen. Als Fallbeispiele werden in dieser Arbeit zwei Online-Kampagnen beziehungsweise Online-Projekte genauer betrachtet: Zum einen 'HarassMap', ein ägyptisches Projekt, bei dem partizipativ Fälle von sexueller Gewalt dokumentiert wurden, sowie 'Women2Drive', eine Social-Media-Kampagne, die sich gegen das Fahrverbot für saudi-arabische Frauen richtete. Anhand der Beispiele sollen die Durchführung sowie kurz- und - soweit möglich - langfristige Wirkungen von Online-Kampagnen beschrieben werden.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- 1 Einleitung
- 2 Potenziale sozialer Medien im Arabischen Frühling: Online-Feminismus als Empowerment?
- 2.1 Das Internet als alternative Öffentlichkeit und 'Safe Space'
- 2.2 Frauen als politische Leitfiguren
- 2.3 Das Internet und transnationaler Feminismus
- 3 "Collective Action" im digitalen Zeitalter: Fallbeispiele
- 3.1 „Women2Drive"
- 3.2 „HarassMap"
- 4 Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Rolle des Internets und sozialer Medien im Kontext des Arabischen Frühlings, insbesondere im Hinblick auf die Empowerment-Potenziale für Frauen in arabischen Ländern. Die Arbeit analysiert, wie das Internet Frauen die Möglichkeit bot, sich aktiv an den Protesten zu beteiligen und ihre Anliegen in die Öffentlichkeit zu tragen, trotz der bestehenden patriarchalischen Strukturen.
- Das Internet als Plattform für feministische Anliegen und Empowerment von Frauen
- Die Rolle des Internets als alternative Öffentlichkeit und 'Safe Space' für Frauen
- Die Bedeutung von Online-Kampagnen und -Projekten für die Förderung von Frauenrechten
- Die Herausforderungen und Chancen des transnationalen Feminismus im digitalen Zeitalter
- Die Auswirkungen des Arabischen Frühlings auf die gesellschaftliche Stellung von Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Relevanz des Internets und der sichtbaren Teilnahme von Frauen an den Protesten des Arabischen Frühlings heraus. Sie beleuchtet die Frage, wie das Internet dazu beitragen kann, die gesellschaftliche Position von diskriminierten Bevölkerungsgruppen zu stärken, und stellt die Theorie des technologischen Determinismus vor.
Kapitel 2 analysiert die Potenziale sozialer Medien im Arabischen Frühling, insbesondere im Hinblick auf den Online-Feminismus als Empowerment-Instrument. Es beleuchtet das Internet als alternative Öffentlichkeit und 'Safe Space' für Frauen, die Rolle von Frauen als politische Leitfiguren und die Möglichkeiten des transnationalen Feminismus im digitalen Zeitalter.
Kapitel 3 präsentiert zwei Fallbeispiele: „Women2Drive" und „HarassMap". Diese Online-Kampagnen und -Projekte verdeutlichen die praktische Anwendung des Internets zur Förderung von Frauenrechten und zur Bewältigung von Herausforderungen in patriarchalischen Gesellschaften.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Arabischen Frühling, Online-Feminismus, Empowerment, soziale Medien, Internet, Frauenrechte, Patriarchat, alternative Öffentlichkeit, 'Safe Space', transnationale Bewegungen, 'Collective Action', Online-Kampagnen, Fallbeispiele, 'Women2Drive', 'HarassMap'.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte das Internet für Frauen im Arabischen Frühling?
Das Internet bot Frauen eine Plattform für politische Partizipation und Empowerment, besonders wenn ihnen der Zugang zum physischen Protestraum durch patriarchalische Strukturen erschwert war.
Was ist das Projekt "HarassMap"?
HarassMap ist ein ägyptisches Online-Projekt, bei dem Fälle von sexueller Gewalt partizipativ dokumentiert werden, um das Bewusstsein für das Problem zu schärfen.
Wogegen richtete sich die Kampagne "Women2Drive"?
Women2Drive war eine Social-Media-Kampagne, die gegen das Fahrverbot für Frauen in Saudi-Arabien protestierte und internationale Aufmerksamkeit erregte.
Was versteht man unter dem "Safe Space" im Internet?
Das Internet kann als geschützter Raum dienen, in dem marginalisierte Gruppen ihre Anliegen diskutieren und organisieren können, ohne unmittelbarer physischer Unterdrückung ausgesetzt zu sein.
Was ist der "Bumerang-Effekt" im transnationalen Feminismus?
Er beschreibt, wie lokaler Aktivismus über das Internet internationale Unterstützung mobilisiert, die dann wiederum Druck auf die nationalen Regierungen ausübt.
- Quote paper
- Christina Jahn (Author), 2014, Durch Social Media zu Geschlechterdemokratie? Empowerment durch das Internet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282274