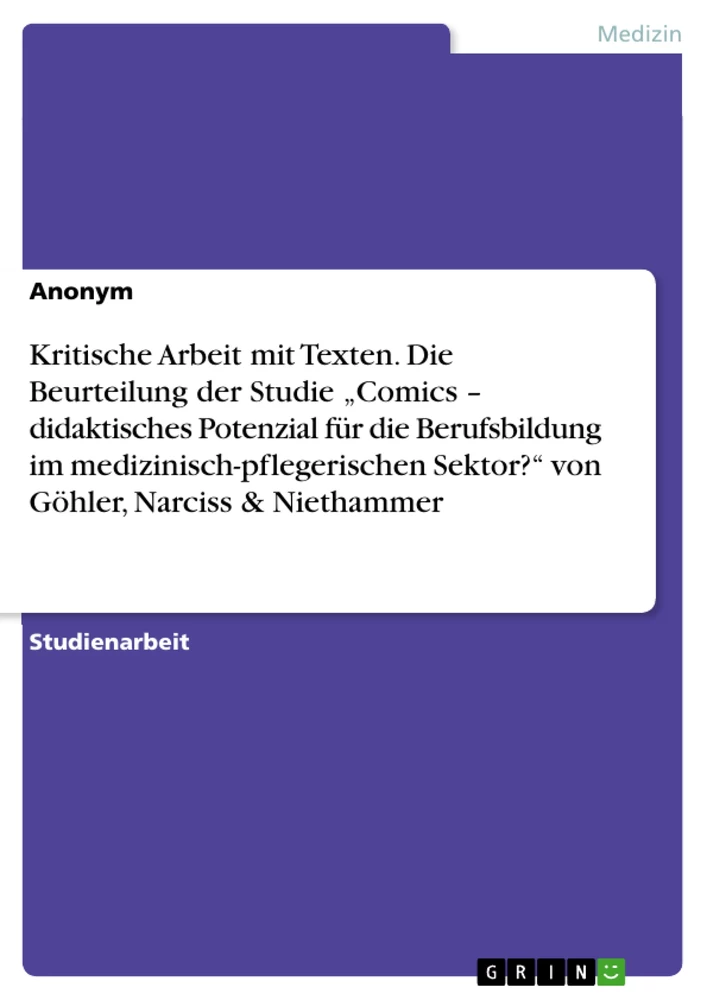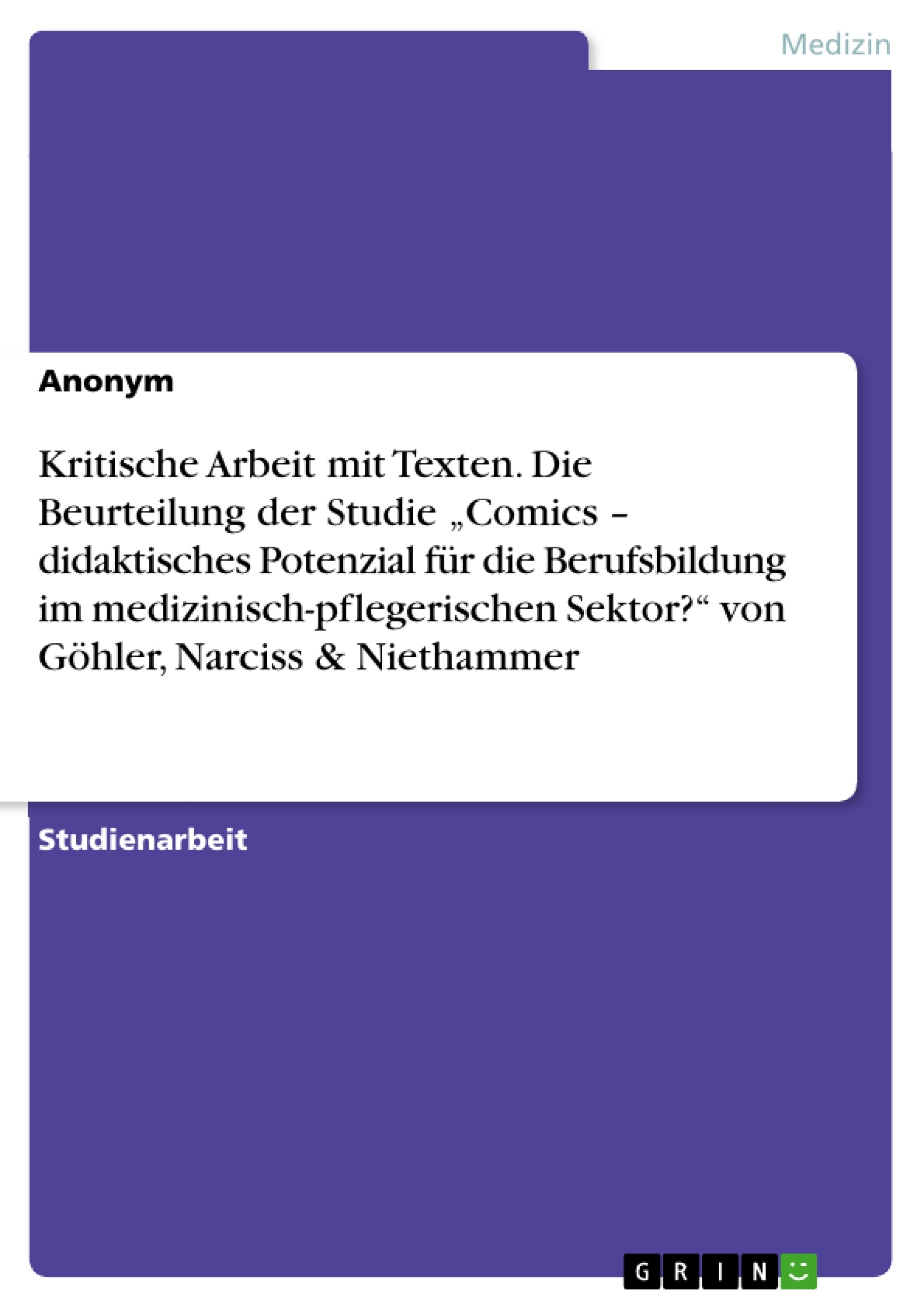Zur beruflichen Kompetenz von Lehrkräften gehört das Unterrichten auf der Grundlage von theoretischem und empirischem Wissen sowie das Wissen über Einwirkungsmöglichkeiten im Rahmen des Lehr-Lernkontextes (Kiper & Mischke, 2006, S. 9). Diese empirischen Erkenntnisse versucht die Unterrichtsforschung als Teil der Bildungsforschung zu liefern. Eine kritische Einschätzung der Qualität von Forschungsarbeiten ist für Lehrende unabdingbar um relevante Erkenntnisse für die eigene Unterrichtspraxis ableiten zu können. Im Rahmen dieser Hausarbeit soll dies exemplarisch anhand der experimentellen Studie „Comics – didaktisches Potenzial für die Berufsbildung im medizinisch-pflegerischen Sektor?“ (Göhler, Narciss & Niethammer, 2013) erfolgen. Hierzu können je nach Studientyp und Design unterschiedliche Kriterien zugrunde gelegt werden. Im Rahmen dieser Arbeit werden die „Allgemeinen Kriterien zur Beurteilung von Studien“ herangezogen, wie sie von Panfil (2013, S. 205-212) vorgeschlagen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorstellung der Studie
- Hintergrund, Zielsetzung & Fragestellung der Studie
- Datenerhebung und Datenauswertung
- Ergebnisse und Diskussion
- Kritische und systematische Beurteilung der Studie
- Formulierung der Forschungsfrage
- Auswahl des Studiendesigns
- Literaturanalyse
- Stichprobe
- Methoden zur Datenerhebung
- Ethik
- Analyse
- Ergebnisse
- Diskussion
- Übertragbarkeit
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der kritischen Beurteilung einer experimentellen Studie zum Einsatz von Comics in der Berufsbildung im medizinisch-pflegerischen Sektor. Ziel ist es, die Qualität der Studie anhand von wissenschaftlichen Kriterien zu analysieren und die Relevanz der Ergebnisse für die Unterrichtspraxis zu bewerten.
- Einsatz von Comics in der Berufsbildung
- Didaktisches Potenzial von Comics
- Methoden der Unterrichtsforschung
- Kriterien zur Beurteilung von Studien
- Relevanz für die Unterrichtspraxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Unterrichtsforschung und die Bedeutung der kritischen Beurteilung von Studien ein. Sie stellt die Forschungsfrage und den strukturellen Aufbau der Arbeit dar.
Im zweiten Kapitel wird die Studie von Göhler, Narciss & Niethammer (2013) vorgestellt. Es werden der Hintergrund, die Zielsetzung und die Fragestellung der Studie erläutert. Außerdem werden die Methoden der Datenerhebung und Datenauswertung beschrieben sowie die Ergebnisse und die Diskussion der Studie zusammengefasst.
Das dritte Kapitel widmet sich der kritischen und systematischen Beurteilung der Studie. Es werden die Formulierung der Forschungsfrage, die Auswahl des Studiendesigns, die Literaturanalyse, die Stichprobe, die Methoden zur Datenerhebung, die ethischen Aspekte, die Analyse, die Ergebnisse, die Diskussion und die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Kontexte untersucht.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Berufsbildung im medizinisch-pflegerischen Sektor, das didaktische Potenzial von Comics, die Unterrichtsforschung, die kritische Beurteilung von Studien und die Relevanz für die Unterrichtspraxis. Die Arbeit analysiert die Studie von Göhler, Narciss & Niethammer (2013) anhand von wissenschaftlichen Kriterien und bewertet die Ergebnisse hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Praxis.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2014, Kritische Arbeit mit Texten. Die Beurteilung der Studie „Comics – didaktisches Potenzial für die Berufsbildung im medizinisch-pflegerischen Sektor?“ von Göhler, Narciss & Niethammer, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282306