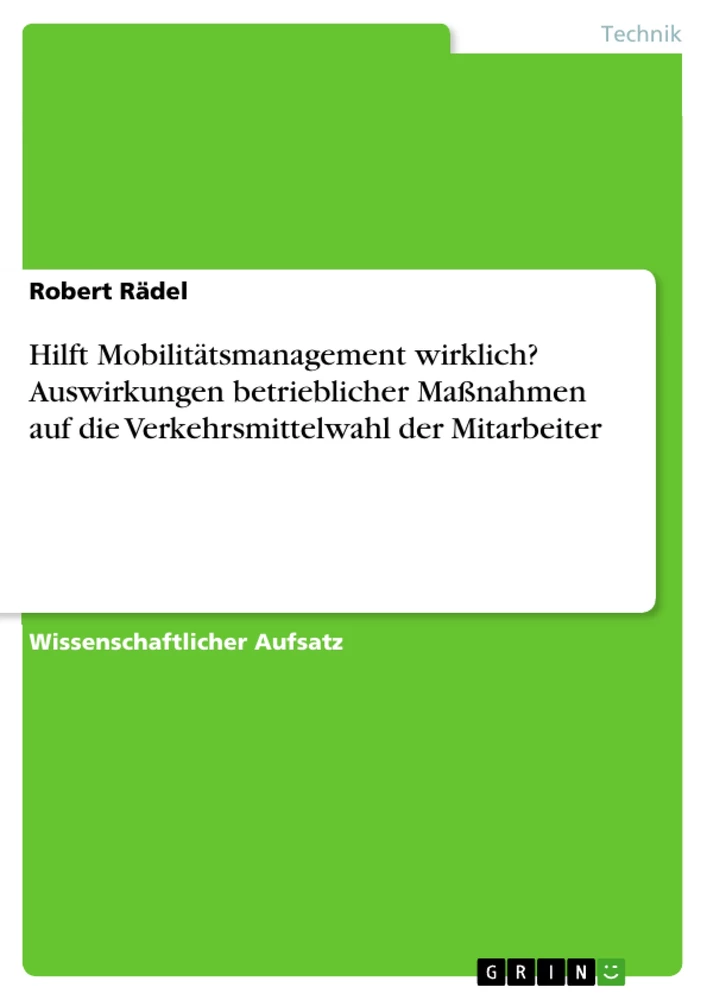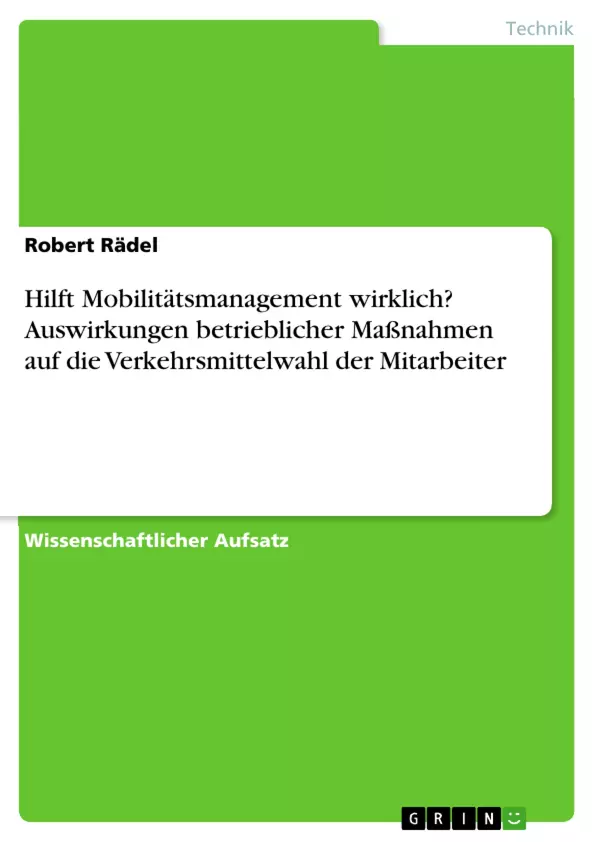Mobilitätsmanagement wird als eine Lösung für das Problem angeboten, den Verkehr auf umweltfreundliche Verkehrsmittel zu verlagern, ohne mit als staatlich-autoritär wahrgenommenen restriktiven ordnungspolitischen Maßnahmen zu stark in die individuelle Verhaltensfreiheit einzugreifen, oder teure neue Infrastrukturen bzw. Buslinien finanzieren zu müssen. Mit v.a. kommunikativen, motivierenden, nachfrageorientierten, also Anreiz setzenden und gleichzeitig relativ kostengünstigen Maßnahmen sollen z.B. Angestellte eines Betriebes, Einwohner einer Kommune, Eltern einer Schule oder Besucher eines Krankenhauses dazu gebracht werden, den ÖPNV, das Fahrrad oder wenigstens Fahrgemeinschaften zu nutzen, um den motorisierten Individualverkehr an einem Standort zu reduzieren. Besonders auf betrieblicher Ebene wird dieses Instrument in letzter Zeit verstärkt eingesetzt, um entweder Verkehrs- und Parkraumdruck zu reduzieren, Kosten zu sparen, die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern oder im Unternehmen bzw. in einer Stadtverwaltung ein Nachhaltigkeitsleitbild zu unterstreichen.
Befürworter von Mobilitätsmanagement verweisen auf messbare Verkehrsverlagerungseffekte nach gewissen Projektlaufzeiten. Allerdings fehlt in der Praxis häufig ein Nachweis für die kausale Wirkung der Maßnahmen, weil die Veränderungen im Modal Split lediglich auf aggregierter Ebene festgestellt, aber nicht auf individueller Ebene erhoben und evaluiert werden. Es ist unklar, ob die eingesetzten Maßnahmen verhaltenswirksam in dem Sinne sind, dass die festgestellten globalen Veränderungen auf Mikroebene (individuell) wirklich auf diese zurückzuführen sind.
Die soziologischen und psychologischen Zusammenhänge auf individueller Handlungsebene bleiben bisher im Dunklen. Aus wissenschaftlicher Perspektive lohnt es sich jedoch, hier zu forschen, da die Gründe für die Verhaltensänderung, also den messbaren Modal Shift, nicht nachgewiesen sind, weil in der verkehrswissenschaftlichen Handlungstheorie davon ausgegangen wird, dass das alltägliche Verkehrshandeln stark routinisiert ist und außer im Rahmen von Kontextänderungen (Umzug, Veränderungen im Haushalt, neuer Arbeitsplatz, Kinder etc.) nur äußerst schwer von außen zu beeinflussen ist, wenn nicht starke Anreize oder Restriktionen eine Änderung erzwingen.
In dieser Arbeit wird ein Forschungsdesign vorgestellt, um die individual-soziopsychologischen Wirkmechanismen im Verkehrshandeln zu untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- Gegenstand und Erkenntnisinteresse
- Fragestellung
- Stand der Forschung
- Verkehrs- und Mobilitätsforschung
- Umweltpsychologie und Verhaltensforschung
- Forschung zum Mobilitätsmanagement
- Theoretisches Modell
- Das Stage Model of self-regulated behavioral change
- Annahmen
- Untersuchungsmerkmale im betrieblichen Mobilitätsmanagement
- Hypothesen und Forschungsfragen
- Forschungsdesign
- Sampling
- Baustein A: Erhebung von betrieblichen und Projektmerkmalen
- Empirische Methoden
- Operationalisierung
- Baustein B: Mitarbeiterbefragung
- Empirische Methoden
- Operationalisierung der persönlichen Merkmale
- Baustein C: Interviews mit Projektträgern und ausgewählten Mitarbeitern (nur Projektgruppe)
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Wirkmechanismen von Interventionskampagnen im betrieblichen Mobilitätsmanagement auf das Mobilitätsverhalten der Mitarbeiter. Ziel ist es, herauszufinden, ob und unter welchen Bedingungen kommunikative Maßnahmen einen messbaren Einfluss auf das Mobilitätsverhalten haben und eine langfristig stabile Verhaltensänderung hervorrufen können.
- Wirkung von kommunikativen Maßnahmen im betrieblichen Mobilitätsmanagement
- Einflussfaktoren auf die Verhaltensänderung
- Rolle von soziologischen Personenmerkmalen, unternehmensbezogenen Charakteristika und der Qualität der Maßnahmen
- Messbarkeit von Verhaltensänderungen
- Langfristige Stabilität der Verhaltensänderung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert den Gegenstand und das Erkenntnisinteresse der Arbeit. Es wird die Notwendigkeit eines Modal Shift, einer nachhaltigen Reduktion des Pkw-Verkehrs, betont und die Grenzen der bisherigen Politik zur Senkung der Treibhausgasemissionen im Verkehr aufgezeigt. Das zweite Kapitel formuliert die Hauptfrage der Arbeit: Ob und unter welchen Bedingungen kommunikative Maßnahmen im betrieblichen Mobilitätsmanagement einen messbaren Einfluss auf das Mobilitätsverhalten haben und eine langfristig stabile Verhaltensänderung hervorrufen können. Das dritte Kapitel beleuchtet den Stand der Forschung in den Bereichen Verkehrs- und Mobilitätsforschung, Umweltpsychologie und Verhaltensforschung sowie Forschung zum Mobilitätsmanagement. Es werden verschiedene Theorien und Modelle vorgestellt, die die Wirkmechanismen von Interventionskampagnen auf das Mobilitätsverhalten erklären können. Das vierte Kapitel stellt das theoretische Modell der Arbeit vor, das auf dem Stage Model of self-regulated behavioral change basiert. Es werden die Annahmen des Modells und die Untersuchungsmerkmale im betrieblichen Mobilitätsmanagement erläutert. Das fünfte Kapitel formuliert die Hypothesen und Forschungsfragen der Arbeit. Es wird untersucht, ob und unter welchen Bedingungen kommunikative Maßnahmen im betrieblichen Mobilitätsmanagement einen messbaren Einfluss auf das Mobilitätsverhalten haben und eine langfristig stabile Verhaltensänderung hervorrufen können. Das sechste Kapitel beschreibt das Forschungsdesign der Arbeit. Es werden die Stichprobenziehung, die Erhebung von betrieblichen und Projektmerkmalen sowie die Mitarbeiterbefragung erläutert. Das siebte Kapitel enthält die Literaturangaben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Mobilitätsmanagement, Interventionskampagnen, Verhaltensänderung, Modal Shift, Verkehrsverlagerung, Umweltpsychologie, Verhaltensforschung, Stage Model of self-regulated behavioral change, soziologische Personenmerkmale, unternehmensbezogene Charakteristika, Qualität der Maßnahmen, Messbarkeit, Langfristigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist betriebliches Mobilitätsmanagement?
Es umfasst Maßnahmen eines Unternehmens, um den Verkehr der Mitarbeiter (z.B. Arbeitsweg) auf umweltfreundliche Verkehrsmittel wie ÖPNV, Fahrrad oder Fahrgemeinschaften zu verlagern.
Helfen rein kommunikative Maßnahmen bei der Verkehrsverlagerung?
Die Arbeit untersucht, ob Motivation und Information ausreichen, um eingefahrene Routinen zu brechen, oder ob starke finanzielle Anreize bzw. Restriktionen (z.B. Parkplatzmangel) notwendig sind.
Was ist das 'Stage Model of self-regulated behavioral change'?
Dieses psychologische Modell beschreibt Verhaltensänderung als einen Prozess in mehreren Stufen – von der Vorüberlegung bis zur stabilen Gewohnheit.
Warum ist der Nachweis der Wirkung von Mobilitätsmanagement schwierig?
Oft werden nur globale Veränderungen (Modal Split) gemessen, ohne die kausalen Zusammenhänge auf individueller Ebene (warum hat Person X ihr Verhalten geändert?) zu evaluieren.
Welche Ziele verfolgen Unternehmen mit Mobilitätsmanagement?
Ziele sind die Reduktion von Parkraumbedarf, Kosteneinsparungen, Gesundheitsförderung der Mitarbeiter und die Umsetzung von Nachhaltigkeitsleitbildern.
- Quote paper
- Robert Rädel (Author), 2012, Hilft Mobilitätsmanagement wirklich? Auswirkungen betrieblicher Maßnahmen auf die Verkehrsmittelwahl der Mitarbeiter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282326