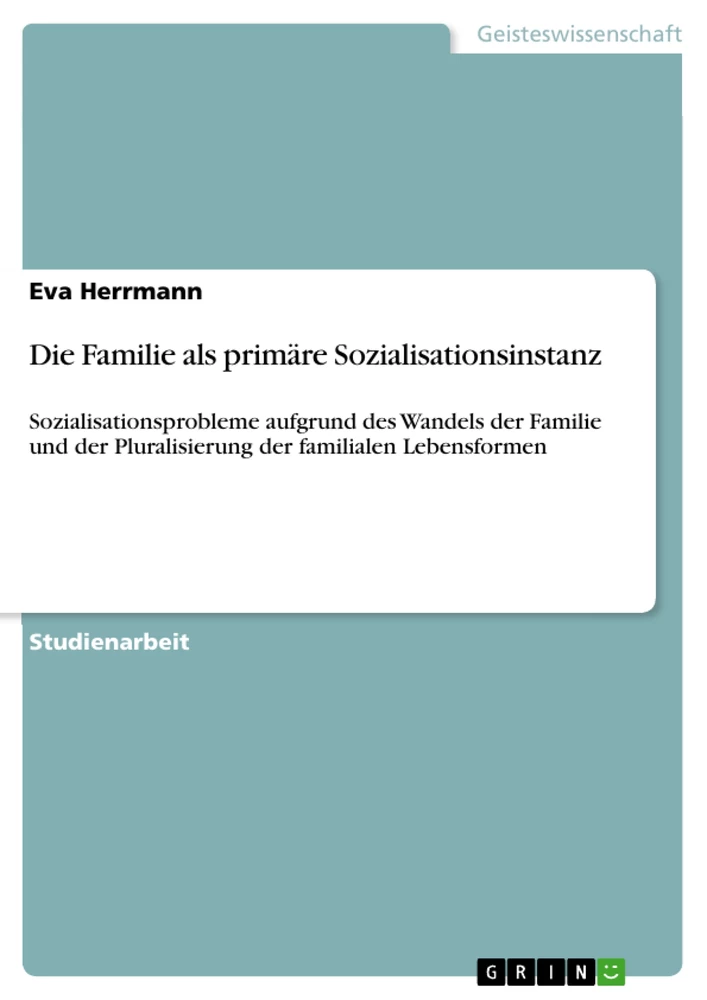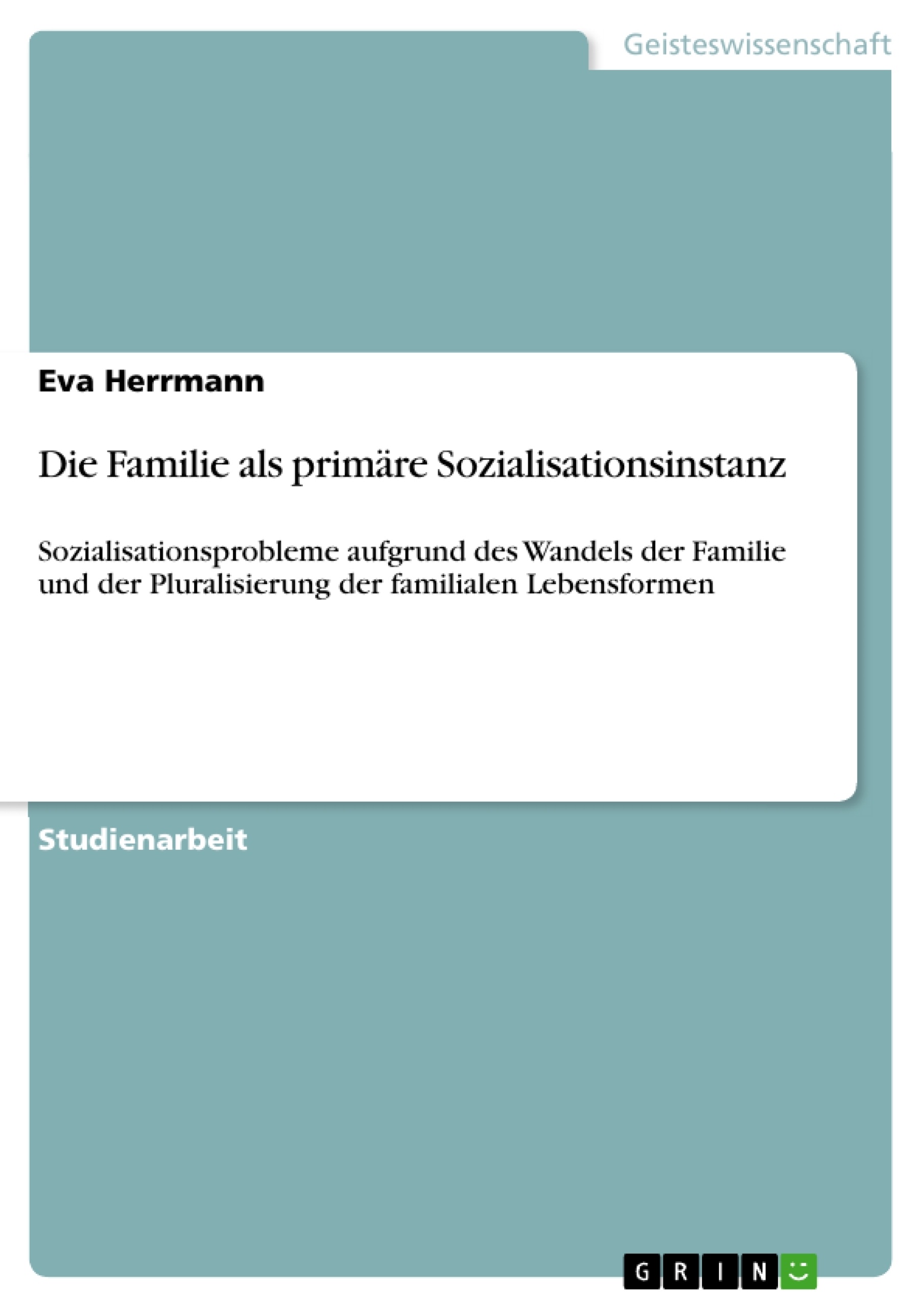Die Lebensform Familie - so kann man es immer wieder in den Medien, aber auch im näheren oder entfernteren sozialen Umfeld beobachten - besteht gegenwärtig nicht mehr zwingend aus einem leiblichen Vater, einer leiblichen Mutter und einem Kind bzw. mehreren Kindern. Diese traditionelle Form von Familie wird heutzutage zum Teil durch andere Familienformen abgelöst. Daher wachsen einige Kinder auf Grund von Scheidung und Trennung beispielsweise nur mit einem Elternteil auf oder sehen sich mit einem neuen (Ehe-) Partner der Mutter bzw. einer neuen (Ehe-) Partnerin des Vaters und eventuell auch mit neuen Geschwistern in ihrem Zusammenleben konfrontiert. Ein-Eltern-Familien wie auch Stief- und Patchworkfamilien stellen in unserer Gesellschaft bereits seit mehreren Jahren keine Seltenheit mehr dar. Insgesamt ist nunmehr seit Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts ein Wandel der Familie zu verzeichnen, der u.a. - überspitzt formuliert - eine Krise der Normalfamilie mit sich bringt. Dies spiegelt sich insbesondere in einer Pluralisierung der familialen Lebensformen wieder. Jedoch wie wirkt sich der Wandel der Familie auf die kleinsten Mitglieder unserer Gesellschaft aus bzw. welche Auswirkungen birgt dieser für den Sozialisationsprozess der Kinder? - Und welche neuen Sozialisationsprobleme ergeben sich dadurch? Sich dieser Frage zu stellen, ist deshalb so wichtig, da die Familie die primäre Sozialisationsinstanz für Kinder darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Familie als primäre Sozialisationsinstanz
- Die Bedeutung und Phasen des Sozialisationsprozesses
- Die Familie als zentrale Sozialisationsinstanz
- Der Wandel der Familie im 20. Jahrhundert: Vom dominanten traditionellen Familienmodell der bürgerlichen Kleinfamilie hin zu einer Pluralisierung der familialen Lebensformen
- Die Etablierung der modernen bürgerlichen Kleinfamilie als traditionelles Familienmodell
- Die Pluralisierung der familialen Lebensformen als Teil des Wandels der Familie
- Veränderungen der Eltern-Kind-Beziehungen als weiterer Aspekt des familialen Wandels
- Welche neuen Sozialisationsprobleme ergeben sich auf Grund der Pluralisierung familialer Lebensformen?
- Die Sozialisation in Ein-Eltern-Familien
- Die Sozialisation in Stieffamilien
- Schlussteil
- Literaturverzeichnis
- Verwendete Literatur
- Verwendete Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Wandel der Familie im 20. Jahrhundert und dessen Auswirkungen auf die Sozialisation von Kindern. Ziel ist es, die Bedeutung der Familie als primäre Sozialisationsinstanz zu beleuchten und die Herausforderungen zu analysieren, die sich durch die Pluralisierung der familialen Lebensformen für die Entwicklung von Kindern ergeben.
- Die Bedeutung der Familie als primäre Sozialisationsinstanz
- Der Wandel der Familie im 20. Jahrhundert
- Die Pluralisierung der familialen Lebensformen
- Die Auswirkungen des familialen Wandels auf die Sozialisation von Kindern
- Neue Sozialisationsprobleme in Ein-Eltern- und Stieffamilien
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und erläutert die Bedeutung des Sozialisationsprozesses, insbesondere der primären Sozialisation, die innerhalb der Familie stattfindet. Es wird definiert, was unter Sozialisation zu verstehen ist und welche Phasen der Sozialisationsprozess umfasst.
Das zweite Kapitel widmet sich der Familie als primäre Sozialisationsinstanz. Es wird die zentrale Rolle der Familie im Sozialisationsprozess hervorgehoben und die wichtigsten familialen Einflussfaktoren, die sich mit dem familialen Wandel modifizieren, beleuchtet.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Wandel der Familie im 20. Jahrhundert und der damit verbundenen Pluralisierung der familialen Lebensformen. Es wird das traditionelle Familienmodell der bürgerlichen Kleinfamilie vorgestellt und die Veränderungen, die zu einer Pluralisierung der Familienformen führten, analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Wandel der Familie, die Pluralisierung der familialen Lebensformen, die Sozialisation von Kindern, die primäre Sozialisationsinstanz, Ein-Eltern-Familien, Stieffamilien und die Herausforderungen der Sozialisation in veränderten Familienstrukturen.
- Quote paper
- Eva Herrmann (Author), 2014, Die Familie als primäre Sozialisationsinstanz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282388