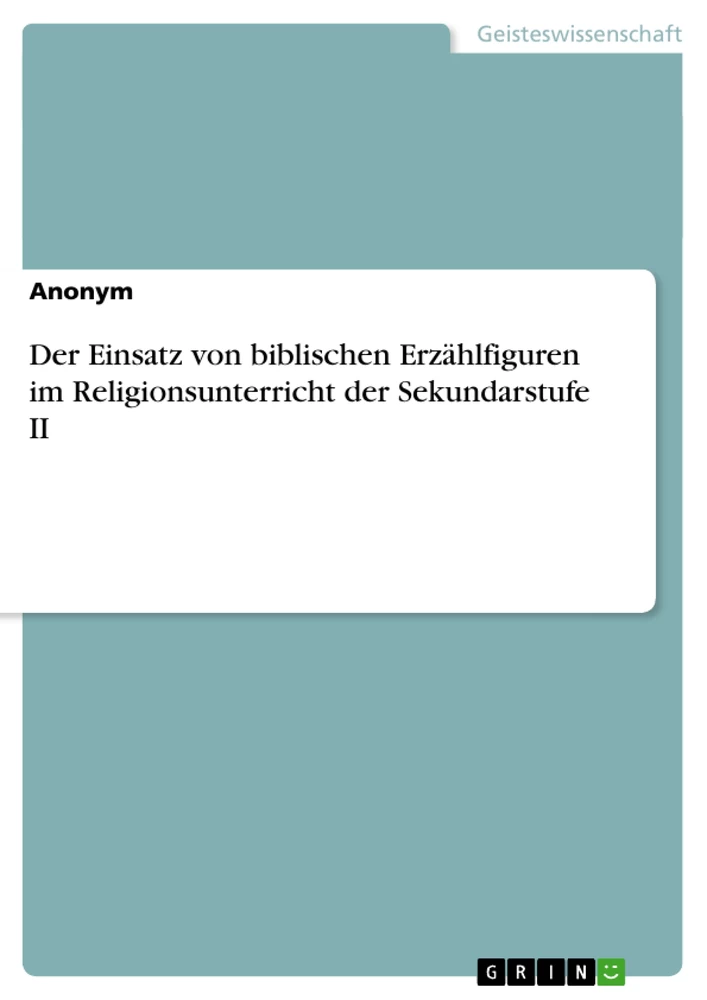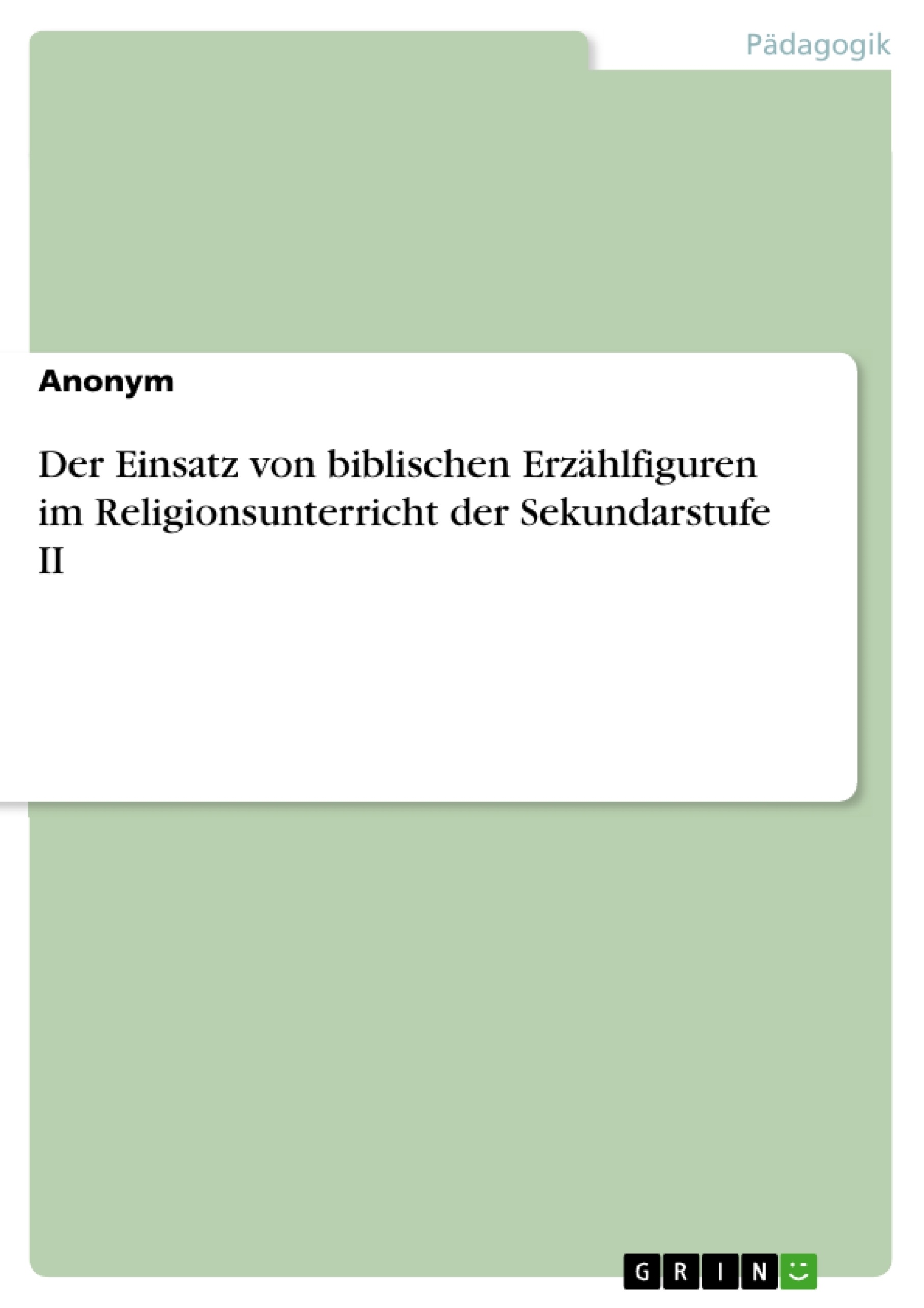Im Seminar Methoden und Materialien im Religionsunterricht stellte sich mir bei dem Thema biblische Erzählfiguren die Frage, wie ich diese später in meinem Beruf in der Sekundarstufe II einsetzen könnte. Bis dahin habe ich darüber hauptsächlich etwas im Zusammenhang über deren Einsatz in der Kinderarbeit gelesen. Doch wie können meine zukünftigen SuS ebenfalls von diesen Materialien in ihrem Religionsunterricht profitieren?
Um diese Frage aufzuschlüsseln wird die folgende Ausarbeitung zunächst die generellen Einsatzmöglichkeiten von Erzählfiguren mit ihren Chancen und Grenzen beleuchten und die Probleme ansprechen, die bei der Arbeit mit Jugendlichen aufkommen könnten.
Darauf folgt die Beschreibung der Methode des kreativen Schreibens, eine Erläuterung über die dafür zu erfüllenden Voraussetzungen. Außerdem werden einige Formen des kreativen Schreibens vorgestellt.
Schließlich wird auch ein Beispiel für die Praxis aufgeführt, das den Einsatz vom kreativen Schreiben mit dem von Erzählfiguren verbindet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Erzählfiguren
- Welche Chancen bieten Erzählfiguren?
- Wo liegen die Grenzen im Umgang mit Erzählfiguren?
- Jugendliche als Zielgruppe
- Kreatives Schreiben
- Voraussetzungen
- Formen des kreativen Schreibens
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ausarbeitung befasst sich mit der Frage, wie biblische Erzählfiguren im Religionsunterricht der Sekundarstufe II eingesetzt werden können. Sie beleuchtet die Einsatzmöglichkeiten, Chancen und Grenzen von Erzählfiguren, insbesondere im Kontext der Arbeit mit Jugendlichen. Darüber hinaus wird die Methode des kreativen Schreibens als ein mögliches Werkzeug zur Förderung von SuS auf kognitiver, emotionaler und sozialer Ebene vorgestellt.
- Einsatzmöglichkeiten von Erzählfiguren im Religionsunterricht
- Chancen und Grenzen von Erzählfiguren
- Kreatives Schreiben als pädagogische Methode
- Voraussetzungen und Formen des kreativen Schreibens
- Verbindung von Erzählfiguren und kreativem Schreiben im Religionsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung dar, wie biblische Erzählfiguren im Religionsunterricht der Sekundarstufe II eingesetzt werden können. Das Kapitel „Erzählfiguren“ beleuchtet die Einsatzmöglichkeiten, Chancen und Grenzen von Erzählfiguren. Es wird betont, dass Erzählfiguren ein „sehr wirksames kreatives Medium“ sind, das den Lernvorgang bestärken und positive Emotionen anregen kann. Allerdings werden auch die Grenzen der Figuren, insbesondere im Hinblick auf die Mimik und die Interaktion mit Jugendlichen, aufgezeigt. Das Kapitel „Kreatives Schreiben“ stellt die Methode des kreativen Schreibens als ein ganzheitliches Instrument zur Förderung von SuS auf kognitiver, emotionaler und sozialer Ebene vor. Es werden die Voraussetzungen für erfolgreiches kreatives Schreiben, wie z.B. eine motivierende Arbeitsatmosphäre und die Vermeidung von Schreibblockaden, sowie verschiedene Formen des kreativen Schreibens, wie z.B. assoziative und begrenzenden Schreibverfahren, erläutert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen biblische Erzählfiguren, Religionsunterricht, Sekundarstufe II, kreatives Schreiben, pädagogische Methoden, Chancen und Grenzen, Jugendliche, Lernförderung, Emotionen, Motivation, Schreibblockaden, Formen des kreativen Schreibens.
Häufig gestellte Fragen
Wie können biblische Erzählfiguren in der Sekundarstufe II eingesetzt werden?
Sie dienen als kreatives Medium, um komplexe biblische Texte zu visualisieren und Schülern einen emotionalen sowie kognitiven Zugang zu religiösen Themen zu ermöglichen.
Was sind die Chancen beim Einsatz dieser Figuren bei Jugendlichen?
Die Figuren fördern die Empathie, regen die Fantasie an und können als Projektionsfläche für eigene Erfahrungen und religiöse Fragen dienen.
Wo liegen die Grenzen der Arbeit mit Erzählfiguren?
Grenzen liegen oft in der Akzeptanz durch Jugendliche, die die Methode als „kindisch“ empfinden könnten, sowie in der fehlenden Mimik der Figuren.
Wie lässt sich kreatives Schreiben mit Erzählfiguren verbinden?
Schüler können Szenen mit den Figuren stellen und anschließend aus der Perspektive einer Figur Texte verfassen, was die Auseinandersetzung mit dem Text vertieft.
Welche Voraussetzungen müssen für kreatives Schreiben im Unterricht erfüllt sein?
Notwendig sind eine motivierende Atmosphäre, die Vermeidung von Schreibblockaden und klare methodische Impulse durch die Lehrkraft.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2013, Der Einsatz von biblischen Erzählfiguren im Religionsunterricht der Sekundarstufe II, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282462