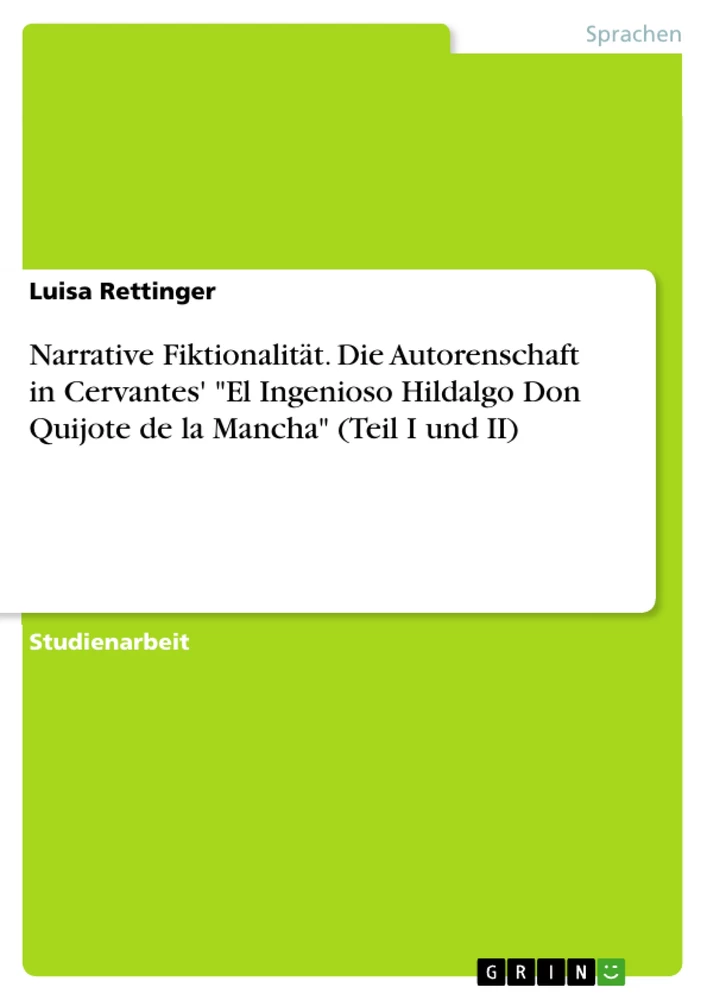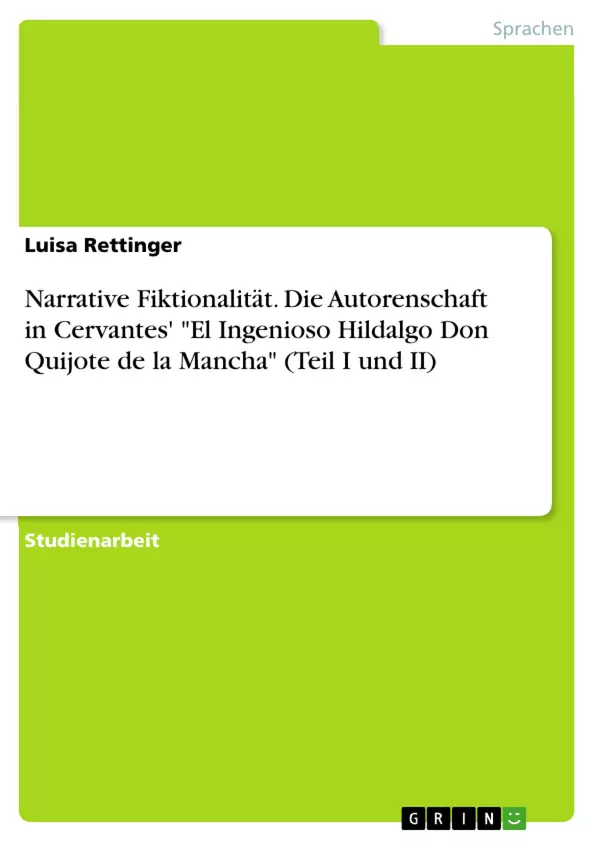Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage nach dem Autor bzw. der Autorenschaft, die hinter dem Werk "Don Quijote" steht. Wer ist derjenige, der sich nicht an den Namen des Ortes erinnern möchte?
Natürlich weiß man heute, was man auch schon im 17. Jahrhundert wusste, dass der empirische Autor des „besten Buches der Welt“ niemand anderes als Miguel de Cervantes Saavedra ist. Lassen wir allerdings beim Lesen diese außerliterarische Wirklichkeit außer Acht und betrachten nur die Ebene der narrativen Fiktionalität, indem wir uns in die Rolle des implizierten Lesers hineinversetzen, müssen wir uns die Frage stellen, wer denn nun die Geschichte eigentlich erzählt und woher der fiktionale Verfasser all die Informationen und Details über den „Ritter von trauriger Gestalt“ hatte.
Inhaltsverzeichnis
- Wer ist derjenige, der sich nicht an den Namen des Ortes erinnern möchte?
- Die Autorenschaft im Don Quijote
- Kommunikationsmodell nach A. Metzler
- Begriff des Autors
- Intertextualität
- Fiktion und Fiktionalität
- Prolog (Teil 1)
- Wahrheitsaspekt
- Erzählsituation zwischen dem achten und neunten Kapitel (Teil 1)
- Cide Hamete Benengeli
- Selbstthematisierung Cervantes'
- Avellaneda
- Don Quijote als sein eigener Autor
- Letztes Kapitel (Teil II)
- Borges Experiment,,Pierre Menard"
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage der Autorenschaft im Don Quijote von Miguel de Cervantes. Sie analysiert die verschiedenen Ebenen der Erzählstruktur und die Rolle der Intertextualität im Werk. Ziel ist es, die komplexe Beziehung zwischen dem empirischen Autor, dem fiktionalen Erzähler und den verschiedenen fiktiven Autoren innerhalb des Romans zu beleuchten.
- Die Rolle des fiktionalen Erzählers im Don Quijote
- Die Bedeutung der Intertextualität für die Autorenschaft
- Die Unterscheidung zwischen Fiktion und Fiktionalität
- Die verschiedenen Ebenen der Erzählstruktur im Don Quijote
- Die Frage nach der Wahrheit im Roman
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit dem berühmten Eröffnungssatz des Don Quijote und stellt die Frage nach dem Autor des Werkes. Es wird die Unterscheidung zwischen dem empirischen Autor Cervantes und dem fiktionalen Erzähler des Romans erläutert. Das zweite Kapitel analysiert das Kommunikationsmodell narrativer Texte nach A. Metzler und definiert die Begriffe des Autors, der Intertextualität und der Fiktionalität. Es wird gezeigt, wie die Intertextualität im Don Quijote sowohl real als auch fiktional sein kann. Das dritte Kapitel untersucht den Prolog des ersten Teils des Don Quijote und die Rolle des fiktionalen Erzählers. Es wird die Frage nach der Wahrheit im Roman und die Beziehung zwischen dem fiktionalen Erzähler und dem implizierten Leser beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Autorenschaft, den Don Quijote, die Intertextualität, die Fiktion und die Fiktionalität. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Ebenen der Erzählstruktur und die Rolle des fiktionalen Erzählers im Werk. Es werden die Beziehungen zwischen dem empirischen Autor, dem fiktionalen Erzähler und den verschiedenen fiktiven Autoren innerhalb des Romans beleuchtet. Weitere Schwerpunktthemen sind die Frage nach der Wahrheit im Roman und die Beziehung zwischen dem fiktionalen Erzähler und dem implizierten Leser.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist der wahre Autor von Don Quijote?
Während Miguel de Cervantes der empirische Autor ist, spielt der Roman mit verschiedenen fiktiven Autoren wie dem maurischen Chronisten Cide Hamete Benengeli.
Was versteht man unter narrativer Fiktionalität im Don Quijote?
Cervantes nutzt eine komplexe Erzählstruktur, bei der der Erzähler behauptet, nur ein Herausforderer gefundener Manuskripte zu sein, was die Grenze zwischen Wahrheit und Fiktion verwischt.
Welche Rolle spielt die Intertextualität im Werk?
Das Werk bezieht sich auf Ritterromane und sogar auf eine apokryphe Fortsetzung von Avellaneda, wodurch der Roman über sich selbst und seine eigene Entstehung reflektiert.
Wer ist Cide Hamete Benengeli?
Er ist die fiktive Quelle, ein arabischer Historiker, dem Cervantes die Urheberschaft der Geschichte zuschreibt, um den Wahrheitsanspruch ironisch zu distanzieren.
Was ist das Borges-Experiment „Pierre Menard“?
Die Arbeit zieht einen Vergleich zu Jorge Luis Borges, der die Idee untersuchte, den Don Quijote im 20. Jahrhundert wortwörtlich neu zu schreiben, was die Bedeutung von Autorschaft hinterfragt.
- Quote paper
- Luisa Rettinger (Author), 2014, Narrative Fiktionalität. Die Autorenschaft in Cervantes' "El Ingenioso Hildalgo Don Quijote de la Mancha" (Teil I und II), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282500