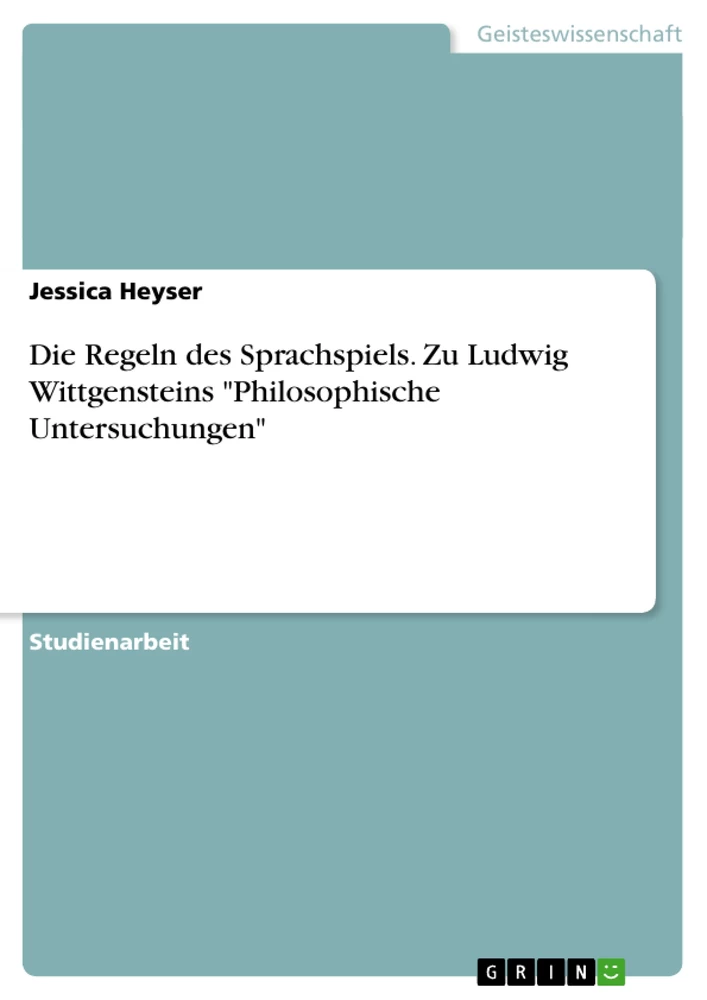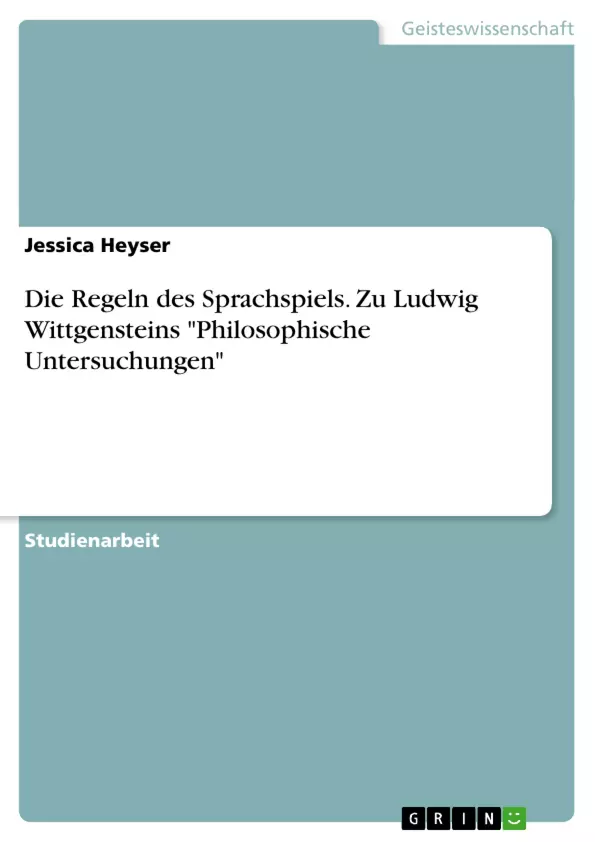Wittgenstein geht es um das Sprechen, um die tägliche Interaktion als das allgegenwärtige Spiel, und wie sich dieses strukturiert. Er nähert sich dem Phänomen der Sprache von „innen“, betritt ihr Spielfeld und fragt nicht, nach dem „Was“, welches die Diskurse hervorbringt und lenkt. Ihn interessieren zuvorderst die internen Funktionsweisen.
Der Schwerpunkt der Hausarbeit wird deshalb auf der Struktur des Sprachspiels und seinen internen Mechanismen liegen. Diesbezüglich folgende Leitfragen: Inwieweit wird ein Spiel durch Regeln begrenzt? Was kann als eine Regel angesehen werden, und wie konstituieren sich die Regeln eines Spiels? Lassen sie sich beschreiben? Wie läßt sich Neues integrieren?
Und welchen Unterschied gibt es in dieser Hinsicht zwischen einem Spiel, einem Sprachspiel und der Sprache allgemein?
Ansatzpunkte bilden Wittgensteins Kommentare zu den Regeln und dem Regelhaften des Sprachspiels und zu dessen Grenzen. In diesem Zusammenhang halte ich allerdings auch eine kurze Einführung in den Sprachspielbegriff Wittgensteins für sinnvoll. Seine Bedeutungstheorie soll jedoch in diesem Kontext nicht ausführlich behandelt werden.
Es ergibt sich eine Schwierigkeit bei der Interpretation von Wittgensteins Spätphilosophie, die sich allerdings bei jeder Theorie über die Sprache stellt: Instrument und Objekt fallen zusammen. Wittgenstein versucht dieser Schwierigkeit zu entkommen, indem er sich fast ausschließlich auf konkrete Situationen bezieht. Aus diesem Grund lassen seine „Zettelsammlungen“ viel Raum für die Interpretation. Dabei stellt sich die Frage, ob es legitim ist, Wittgensteins Spätphilosophie zu systematisieren, was dieser doch gerade vermeiden wollte. Doch für eine Auseinandersetzung ist es meiner Ansicht nach unumgänglich. In diesem Sinne werde ich Wittgenstein Gewalt antun. Doch „wittgensteinianisch“ handelt es sich gar nicht um eine Meta-Perspektive: Ich werde das Sprachspiel der Beschreibung und Interpretation von Wittgensteins Philosophie spielen.
Neben „Philosophische Untersuchungen“ werden einige seiner Spätwerke als Quelle dienen: „Philosophische Grammatik“, „Blaue Buch“, „Philosophische Bemerkungen“ und „Über Gewißheit“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprachspiel
- Eine Sprache erfinden
- Spiele und Sprachspiele
- Sprachspiel der Benennung
- Regeln im Spiel
- Mit Sprache spielen
- Grenzen
- Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit Ludwig Wittgensteins Spätphilosophie, insbesondere mit seinen Ausführungen zum Sprachspielbegriff in den „Philosophischen Untersuchungen“. Ziel ist es, die Struktur des Sprachspiels und seine internen Mechanismen zu beleuchten.
- Die Bedeutung des Sprachspiels für die Struktur und Funktion von Sprache
- Die Rolle von Regeln im Sprachspiel und ihre Bedeutung für die Bedeutung von Sprache
- Die Grenzen des Sprachspiels und die Herausforderungen, die sich aus der Interaktion zwischen Sprache und Praxis ergeben
- Die Beziehung zwischen Sprachspielen und Lebensformen
- Die Dynamik des Sprachspiels im Kontext gesellschaftlicher und kultureller Veränderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in Wittgensteins Sprachspielbegriff und zeigt auf, dass Sprache und Tätigkeit für Wittgenstein untrennbar miteinander verbunden sind. Es wird betont, dass Sprache nicht als ein abgeschlossenes System betrachtet werden kann, sondern als ein dynamischer Prozess, der sich in unterschiedlichen Sprachspielen manifestiert.
Im weiteren Verlauf der Arbeit wird die Rolle von Regeln im Sprachspiel untersucht. Die Bedeutung von Regeln für die Struktur und Funktion von Sprache sowie die Herausforderungen, die sich aus der Integration von Neuem ergeben, werden diskutiert.
Schließlich werden die Grenzen des Sprachspiels und ihre Bedeutung für die Interaktion zwischen Sprache und Praxis beleuchtet. Der Einfluss von Sprachspielen auf die Erkenntnis und Welterfahrung des Menschen wird im Kontext des Verhältnisses von Sprache und Lebensformen untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Begriffen der Sprachphilosophie, insbesondere mit dem Sprachspielbegriff, der im Kontext von Wittgensteins Spätphilosophie eine zentrale Rolle spielt. Weitere wichtige Schlüsselbegriffe sind Regeln, Grenzen, Lebensformen, Sprache und Praxis. Die Arbeit befasst sich außerdem mit der Bedeutung von Sprachspielen für die Konstitution von Wissen, die Struktur von Erkenntnis und die Interaktion zwischen Mensch und Welt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein „Sprachspiel“ nach Ludwig Wittgenstein?
Ein Sprachspiel beschreibt die Einheit aus Sprache und den Tätigkeiten, mit denen sie verwoben ist. Sprache wird hier als dynamischer Prozess und soziale Praxis verstanden.
Welche Rolle spielen Regeln in Sprachspielen?
Regeln strukturieren das Sprachspiel, sind aber nicht immer starr. Die Arbeit untersucht, wie Regeln konstituiert werden und wie Neues in bestehende Systeme integriert wird.
Gibt es Grenzen für Sprachspiele?
Ja, die Arbeit beleuchtet die internen Grenzen von Sprachspielen und die Herausforderungen, die entstehen, wenn Sprache auf reale Praxis trifft.
Was meint Wittgenstein mit „Lebensformen“?
Lebensformen sind der soziale und kulturelle Kontext, in dem Sprachspiele eingebettet sind. Sie bilden den Hintergrund, vor dem Sprache Sinn ergibt.
Warum ist die Interpretation von Wittgensteins Spätphilosophie schwierig?
Schwierig ist, dass Instrument und Objekt (die Sprache) zusammenfallen und Wittgenstein eine Systematisierung seiner oft fragmentarischen „Zettel“ eigentlich vermeiden wollte.
Welche Werke Wittgensteins werden als Quellen genutzt?
Primär die „Philosophischen Untersuchungen“, ergänzt durch das „Blaue Buch“, „Philosophische Grammatik“ und „Über Gewißheit“.
- Quote paper
- Jessica Heyser (Author), 2002, Die Regeln des Sprachspiels. Zu Ludwig Wittgensteins "Philosophische Untersuchungen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28254