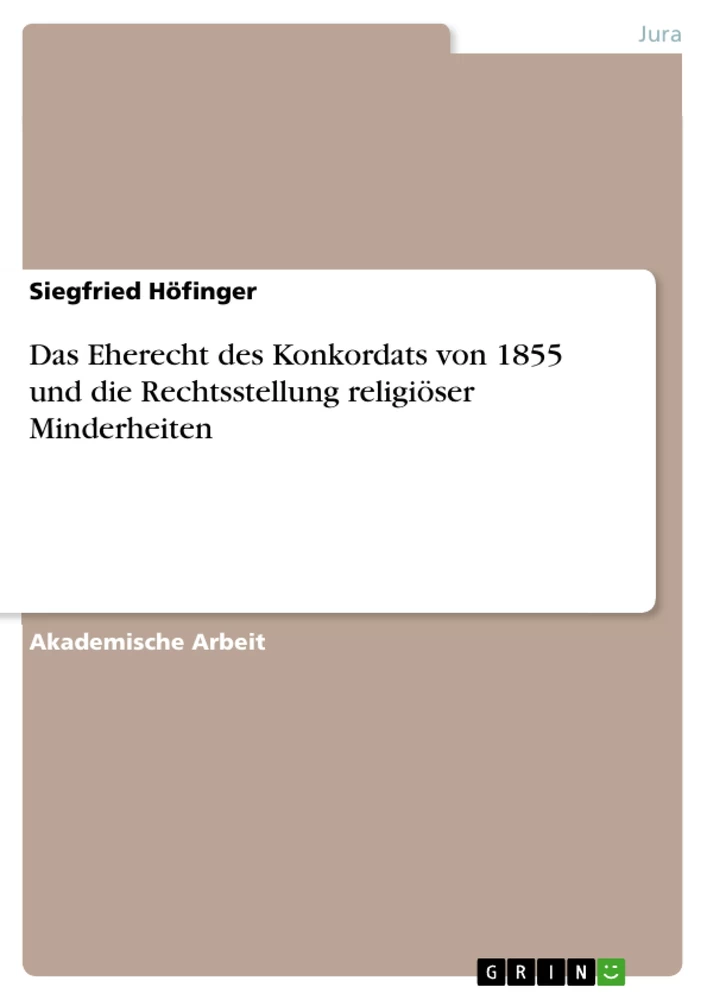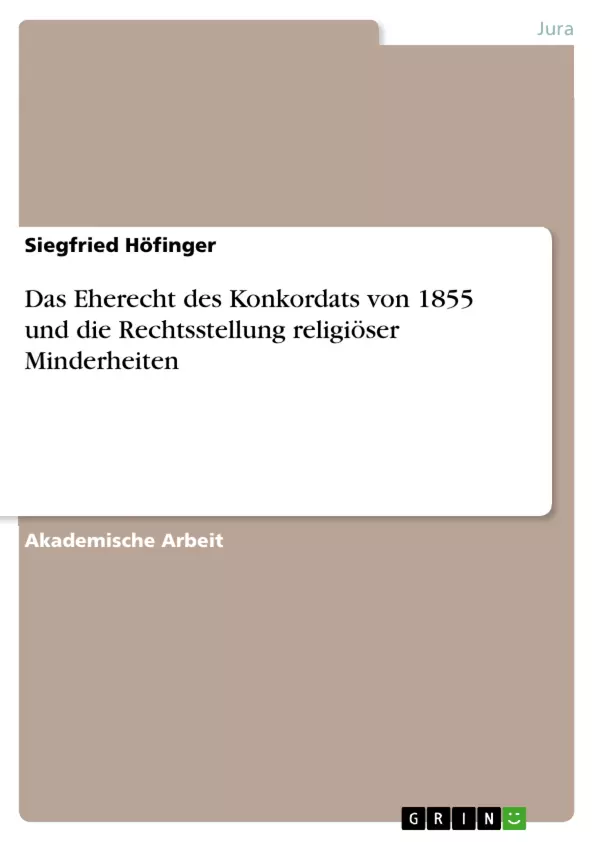Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist eine zweifache: einmal ist, im Allgemeinen, die Frage zu stellen, wie das Eherecht in Österreich während der Geltung des Konkordats von 1855 ausgestaltet war und wodurch es sich vom vorhergehenden Eherecht unterscheidet; ein andermal geht es, im Besonderen, darum, die Auswirkungen der mit dem Konkordat verbundenen Gesetzgebung im Bereich des Eherechts auf die Rechtsstellung der Angehörigen religiöser Minderheiten in der Habsburgermonarchie zu untersuchen. Hinter dieser Forschungsfrage verbirgt sich das Problem, dass unser Wissen über die lebensweltliche Mikroebene religiöser Minderheiten im Zeitalter des Neoabsolutismus außerordentlich mangelhaft ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsfrage, Problemstellung und Relevanz des Themas
- Methode und Quellenlage
- Die historische Ausgangssituation
- Das Konkordat vom 18. August 1855 mit der österreichischen Monarchie
- Voraussetzungen und Bewertung des Konkordats
- Das Zeitalter des Neoabsolutismus (1852-1860)
- Die Entwicklung des österreichischen Eherechts bis zum Konkordat von 1855
- Die „Instructio Austriaca pro iudiciis ecclesiasticis“
- Ehegerichtsbarkeit bei gemischten Ehen
- Der Grundsatz des § 111 ABGB und seine Auswirkungen
- Das Protestantenpatent von 1861
- Die Bemühungen um ein Protestantenpatent
- Eherechtliche Regelungen im Protestantenpatent von 1861
- Abschließende Bemerkungen und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, wie das Eherecht in Österreich während der Geltung des Konkordats von 1855 ausgestaltet war und welche Auswirkungen die damit verbundene Gesetzgebung auf die Rechtsstellung religiöser Minderheiten hatte. Die Studie analysiert die Entwicklung des Eherechts im Kontext der historischen Situation und untersucht die Relevanz des Konkordats für die Rechtsstellung von Angehörigen religiöser Minderheiten in der Habsburgermonarchie.
- Die Auswirkungen des Konkordats von 1855 auf das österreichische Eherecht
- Die Rechtsstellung religiöser Minderheiten im Kontext des Konkordats
- Die Rolle der kirchlichen Ehegerichtsbarkeit bei gemischten Ehen
- Die Anwendung des Gleichheitsgrundsatzes auf Angehörige religiöser Minderheiten
- Die Bedeutung des Protestantenpatents von 1861 für die Rechtsstellung der Protestanten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage, die Problemstellung und die Relevanz des Themas dar. Sie beleuchtet die historische Ausgangssituation und die methodischen Grundlagen der Arbeit. Das zweite Kapitel widmet sich dem Konkordat von 1855 mit der österreichischen Monarchie, seinen Voraussetzungen und seiner Bewertung. Es analysiert die Entwicklung des österreichischen Eherechts bis zum Konkordat und die Auswirkungen des Neoabsolutismus auf die Rechtsstellung religiöser Minderheiten. Das dritte Kapitel untersucht die „Instructio Austriaca pro iudiciis ecclesiasticis“, die Ehegerichtsbarkeit bei gemischten Ehen und den Grundsatz des § 111 ABGB. Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Protestantenpatent von 1861, den Bemühungen um seine Erlassung und den eherechtlichen Regelungen, die darin enthalten sind.
Schlüsselwörter
Konkordat, Eherecht, Österreich, religiöse Minderheiten, Habsburgermonarchie, Neoabsolutismus, „Instructio Austriaca pro iudiciis ecclesiasticis“, Protestantenpatent, Ehegerichtsbarkeit, Gleichheitsgrundsatz, gemischte Ehen, Diskriminierung.
- Arbeit zitieren
- Mag. Siegfried Höfinger (Autor:in), 2014, Das Eherecht des Konkordats von 1855 und die Rechtsstellung religiöser Minderheiten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282742