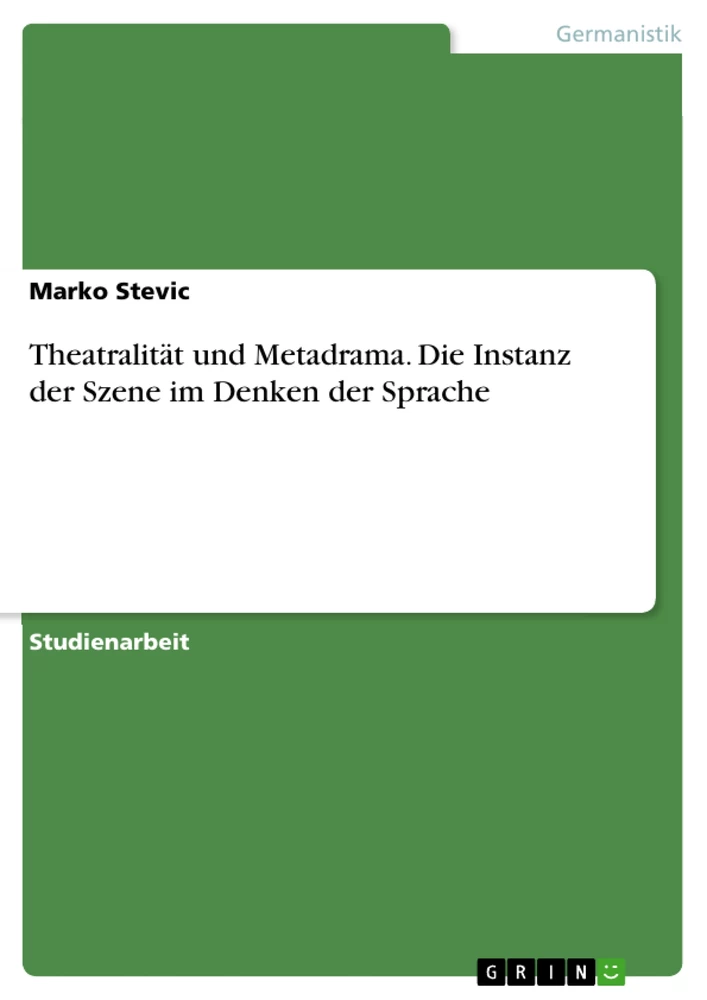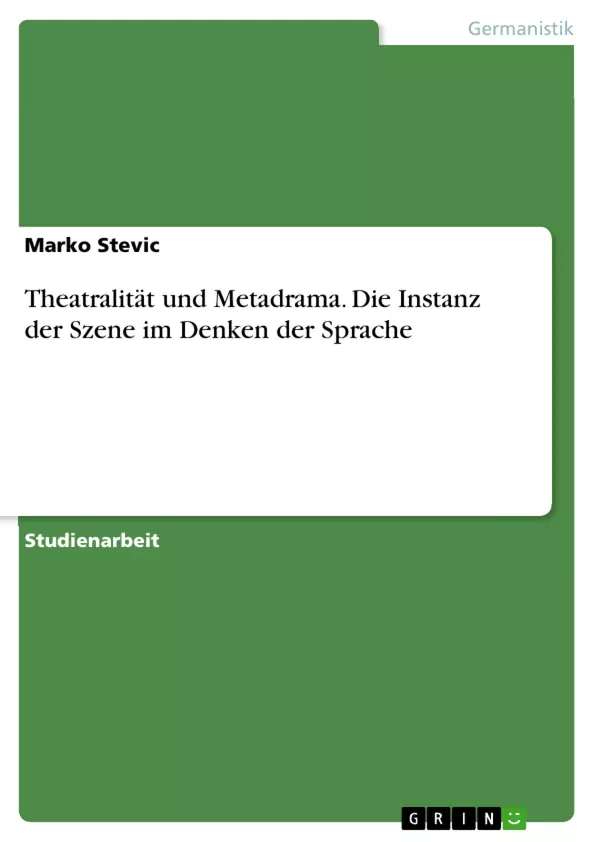Betrachtet man die Kulturgeschichte, so ist diese mit der Geschichte des Theaters eng verknüpft. Die Theatralität erweist sich als ein essenzieller Faktor für die Kulturproduktion. Zu den bedeutendsten kulturellen antiken Stätten zählten u. a. die Theater- und Sportanlagen Griechenlands und Roms, welche für die Entwicklung der Poleis und das jahrhundertelange Fortbestehen des Imperium Romanum sowie die Integration dessen eroberter Länder von Bedeutung waren. Darüber hinaus prägten sie das Denken von Gelehrten und Philosophen und waren Diskussionsbühnen. Im Hippodrom Konstantinopels wurden selbst Kaiserwahlen mitbestimmt sowie religiöse und politische Fehden ausgefochten, die zu bürgerkriegsähnlichen Konflikten ausarten konnten. Angemerkt seien die Liturgie, die barocke Guckkastenbühne, die Guillotine, bedeutende Weltliteratur schaffende Dramatiker wie bspw. Shakespeare, Goethe oder Schiller sowie die Entstehung des Films – nur um einige weltgeschichtlich bedeutende Institutionen, Entwicklungen und Personen zu nennen, bei denen Theatralität ein manifester Aspekt ist.
Im Alltag ist Theatralität ein Bestandteil menschlichen Handelns und Seins. Vielleicht ist Theatralität grundlegender als es den Anschein erweckt, sodass sie nicht nur im Rahmen von Ritualen, Festen, Zeremonien, Wettkämpfen, Reden usw. zu suchen ist, sondern auch innerhalb des Denkens und der Sprache? Bereits die Überlegung was Theatralität sei könnte als theatralischer Prozess angesehen werden.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es eine Neuformulierung nach Gerhard Neumann vorzustellen. Der Begriff der Theatralität, welcher in verschiedenen Definitionen an das Schauspiel gekoppelt ist, wird hierbei von seinem Gegenstandsbereich von Theater und Schauspiel befreit und als eine im Denken vorhandene und auf die Sprache wirkende Instanz definiert. Zudem soll daran anknüpfend die Erzählung Franz Kafkas Ein Bericht für eine Akademie stellenweise analysiert und interpretiert werden. Als Primärtext dient die kritische Ausgabe der Erzählung aus einem – u. a. von Gerhard Neumann herausgegebenen – Sammelband von Texten Franz Kafkas. Unter der Sekundärliteratur sei explizit auf den – ebenfalls von Gerhard Neumann mit herausgegebenen – Sammelband Szenographien: Theatralität als Kategorie der Literaturwissenschaft5 verwiesen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theatralität
- Definitionen von Theatralität
- Theatralität nach Gerhard Neumann
- Literatur als Dramen der Bedeutungsproduktion ...
- Ein Bericht für eine Akademie..
- Die Menschwerdung des Affen.....
- Die Unmöglichkeit der Rückkehr zum Affentum
- Die Traumata Rotpeters
- Der Käfig der Kultur
- Das Erwachen im Käfig
- Der Ausweg aus dem Käfig
- Im Käfig der Kultur.
- Schlussbetrachtung..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, den Begriff der Theatralität nach Gerhard Neumann neu zu formulieren und seine Bedeutung für das Verständnis der Sprache zu beleuchten. Dabei wird die Erzählung "Ein Bericht für eine Akademie" von Franz Kafka als Beispiel herangezogen, um die Anwendung der Theatralitätsdefinition in der Literatur zu demonstrieren.
- Die Bedeutung der Theatralität als anthropologische Kategorie
- Theatralität als Praxis der Bedeutungsproduktion in der Sprache
- Die Rolle der Theatralität in der Menschwerdung des Affen in Kafkas Erzählung
- Der Einfluss der Theatralität auf die Kultur und das Denken
- Die Analyse von Kafkas "Ein Bericht für eine Akademie" im Kontext der Theatralitätstheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die enge Verbindung zwischen Kulturgeschichte und Theatergeschichte heraus und betont die Bedeutung der Theatralität für die Kulturproduktion. Es wird die Zielsetzung der Arbeit erläutert, die auf eine Neuformulierung des Begriffs der Theatralität nach Gerhard Neumann abzielt, und die Analyse von Kafkas "Ein Bericht für eine Akademie" angekündigt.
Das zweite Kapitel widmet sich verschiedenen Definitionen von Theatralität, die sie als anthropologische oder ästhetische Kategorie begreifen. Im Anschluss wird die Theorie von Gerhard Neumann erläutert, der Theatralität als eine im Denken vorhandene und auf die Sprache wirkende Instanz definiert.
Das dritte Kapitel befasst sich mit Franz Kafkas Erzählung "Ein Bericht für eine Akademie", die stellenweise analysiert und interpretiert wird. Dabei wird die Rolle der Theatralität bei der Menschwerdung des Affen in der Erzählung untersucht.
Schlüsselwörter
Theatralität, Sprache, Bedeutungsproduktion, Gerhard Neumann, Franz Kafka, "Ein Bericht für eine Akademie", Menschwerdung, Kultur, Inszenierung, Schauspiel, Literatur.
Häufig gestellte Fragen zur Theatralität
Was bedeutet Theatralität nach Gerhard Neumann?
Neumann befreit den Begriff vom reinen Schauspiel und definiert Theatralität als eine im Denken vorhandene Instanz, die die Produktion von Bedeutung in der Sprache steuert.
Wie zeigt sich Theatralität in Kafkas „Ein Bericht für eine Akademie“?
Die Menschwerdung des Affen Rotpeter wird als ein theatralischer Prozess der Inszenierung und Anpassung an die menschliche Kultur dargestellt.
Ist Theatralität ein Bestandteil des Alltags?
Ja, sie manifestiert sich in Ritualen, Zeremonien und Reden, ist aber laut Neumann auch grundlegend in unserem Denken und Handeln verankert.
Was ist der „Käfig der Kultur“ bei Kafka?
Es beschreibt die Situation, in der die Zivilisation zwar einen Ausweg aus der Gefangenschaft bietet, aber selbst eine neue Form der Einengung und Inszenierung darstellt.
Welche Rolle spielt die Sprache bei der Bedeutungsproduktion?
Sprache wird als Bühne verstanden, auf der durch theatralische Akte ständig neue Bedeutungen inszeniert und verhandelt werden.
- Quote paper
- Marko Stevic (Author), 2014, Theatralität und Metadrama. Die Instanz der Szene im Denken der Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282766