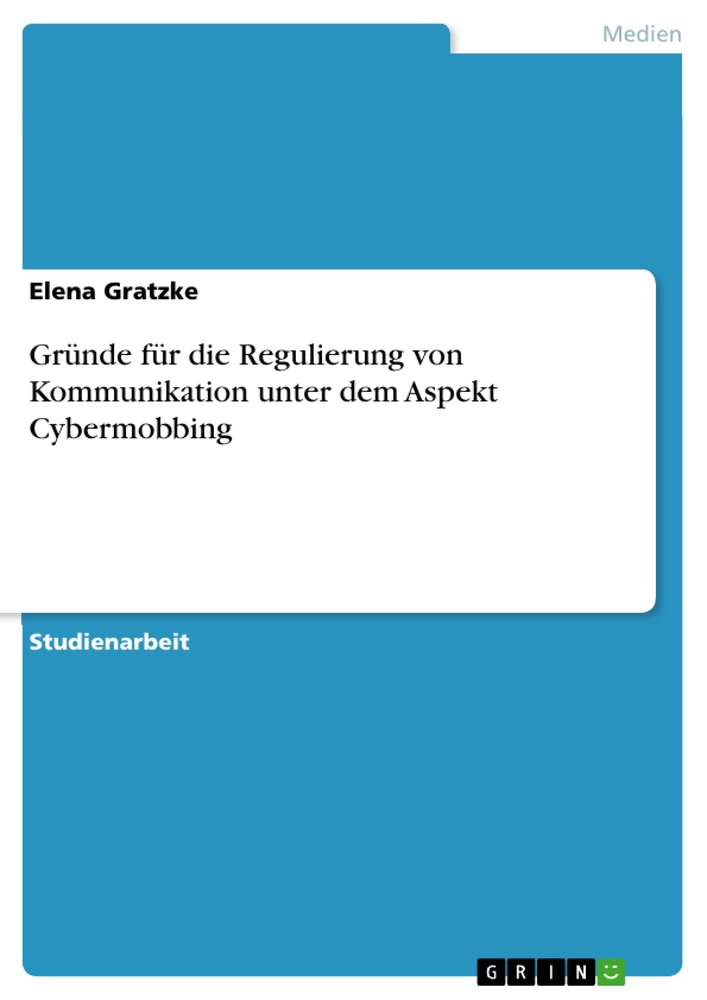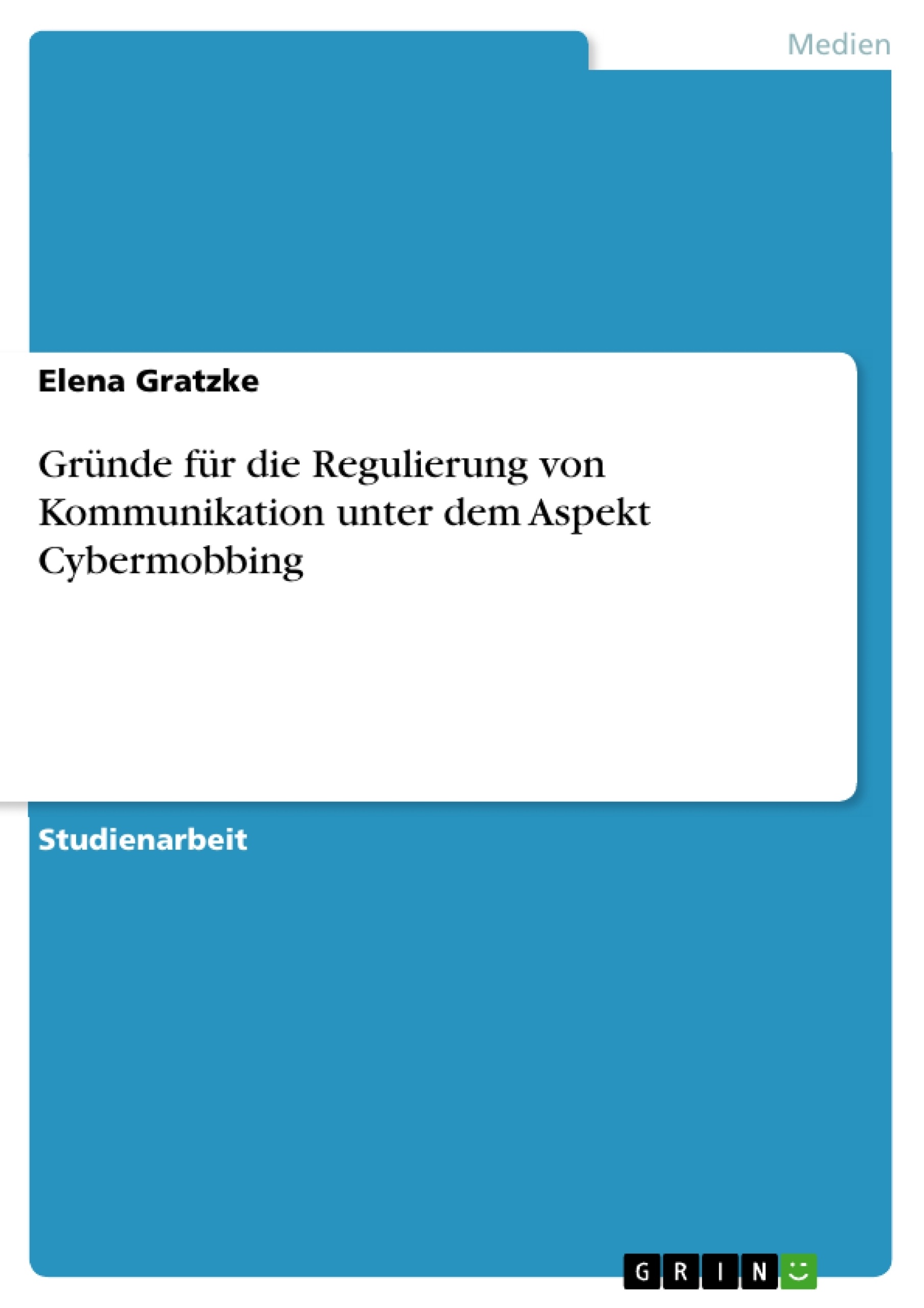Diese Arbeit beschäftigt sich mit den allgemeinen Gründen der Regulierung von Kommunikation und setzt dabei einen zentralen Schwerpunkt auf die Ursache und Problematik von Cybermobbing. Dazu werden zunächst der Begriff und die Unterschiede zu direktem Mobbing erläutert um anschließend die technischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Begründungen für die Regulierung von Kommunikation aufzuführen. Wo es möglich ist, werden diese Aspekte auf Cybermobbing bezogen. Der letzte Abschnitt legt zusätzlich ein Augenmerk auf die Schwierigkeiten bei der Regulierung des Internets und insbesondere Cybermobbing und soll so die Frage klären, inwieweit Cybermobbing durch Regulation des Internets verringert werden kann.
- Quote paper
- Bachelor of Arts Elena Gratzke (Author), 2011, Gründe für die Regulierung von Kommunikation unter dem Aspekt Cybermobbing, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282794