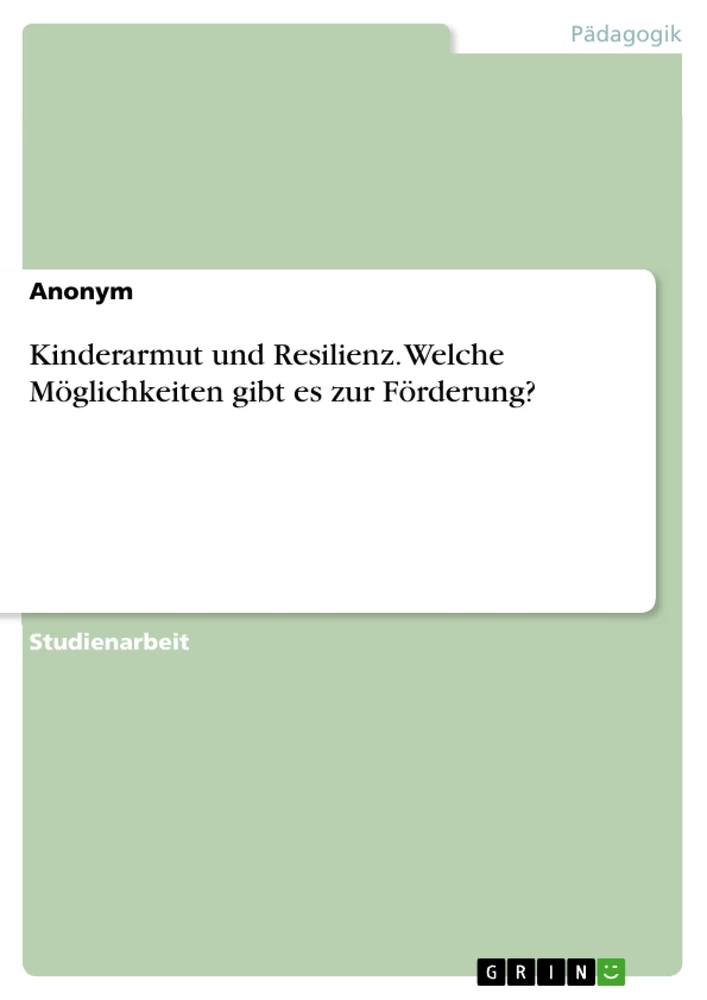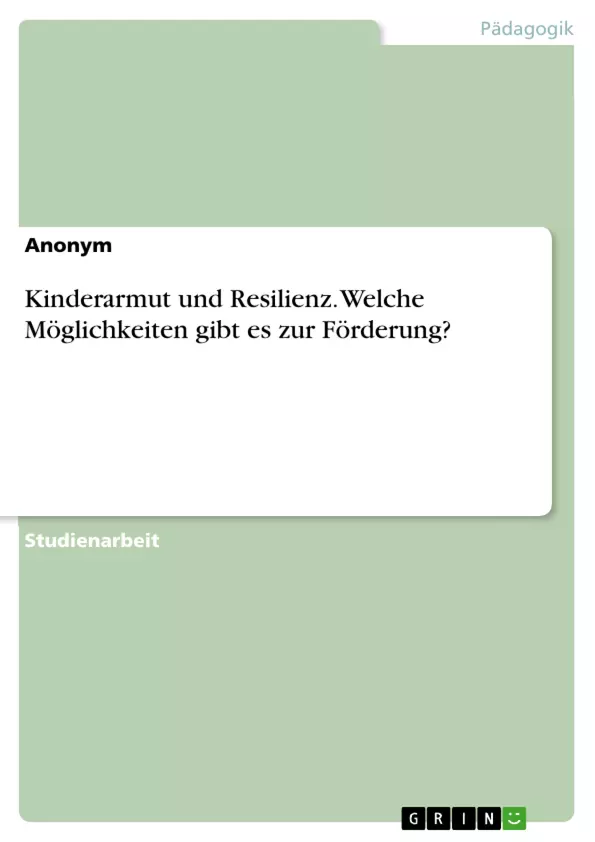Der Fokus dieser Hausarbeit liegt auf dem Phänomen der Kinderarmut und dem Konzept der Resilienz. Dafür sollen folgende Fragen beantwortet werden. Zum einen: Wie wirkt sich die Kinderarmut auf die Entwicklung der Kinder aus? Die andere Fragestellung ist: Warum meistern manche Kinder die ungünstigen Lebensbedingungen und andere nicht? Schließlich wird auf die Fragestellung eingegangen, welche Möglichkeiten es zur Förderung gibt. Zunächst wird Armut definiert und unterschieden zwischen absoluter und relativer Armut. Zudem werden der Ressourcen- und der Lebenslagenansatz dargestellt. Anschließend werden die Auswirkungen von Armut auf Jungen und Mädchen beschrieben. Beide Geschlechter reagieren unterschiedlich auf die familiäre Armut. Im nächsten Kapitel wird das Konzept der Resilienz erläutert. Es folgen die Risiko- und Schutzfaktoren, die Einfluss auf die kindliche Entwicklung haben. Im Folgenden sollen drei Risikogruppen dargestellt werden, die statistisch am meisten gefährdet sind in chronischer Armut zu leben. Exemplarisch werden Alleinerziehende, kinderreiche Familien und Familien mit einem Migrationshintergrund beschrieben. Im weiteren Verlauf werden empirische Studien vorstellt: Einmal die Kauai-Studie von Werner/Smith und die Mannheimer-Risikokinderstudie von Laucht und seinen Mitarbeitern. Anschließend werden zwei verschiedene Handlungskonzepte zur Resilienzförderung dargestellt. In dem Konzept von Grotberg wird das soziale Umfeld angesprochen und bei Grünke sollen die inneren Ressourcen der Kinder gestärkt werden. Im letzten Kapitel geht es um praktische Maßnahmen zur Prävention. Dabei werden verschiedene Ebenen beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Armut
- Absolute Armut
- Relative Armut
- Der Ressourcenansatz und der Lebenslagenansatz
- Auswirkungen der chronischen Armut auf Jungen und Mädchen
- Konzept der Resilienz
- Definition Resilienz
- Risiko- und Schutzfaktoren
- Risikogruppen
- Alleinerziehende
- Kinderreiche Familien
- Familien mit Migrationshintergrund
- Empirische Studien
- Die Kauai-Längsschnittstudie
- Die Mannheimer Risikokinderstudie
- Handlungskonzepte zur Resilienzförderung
- Kindzentriertes Konzept nach Edith Grotberg
- Schule als Schutzfaktor
- Prävention und Resilienz
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Kinderarmut und dem Konzept der Resilienz. Sie untersucht die Auswirkungen von Kinderarmut auf die Entwicklung von Kindern und analysiert, warum manche Kinder ungünstige Lebensbedingungen besser bewältigen als andere. Schließlich werden Möglichkeiten zur Förderung von Resilienz bei Kindern in Armutssituationen beleuchtet.
- Definition und Unterscheidung von absoluter und relativer Armut
- Einfluss von Armut auf die Entwicklung von Jungen und Mädchen
- Das Konzept der Resilienz und die Bedeutung von Risiko- und Schutzfaktoren
- Empirische Studien zur Resilienzforschung
- Handlungsstrategien zur Förderung von Resilienz bei Kindern in Armut
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Das Kapitel "Armut" definiert den Begriff Armut und unterscheidet zwischen absoluter und relativer Armut. Es erläutert den Ressourcenansatz und den Lebenslagenansatz und beleuchtet die unterschiedlichen Auswirkungen von chronischer Armut auf Jungen und Mädchen.
Das Kapitel "Konzept der Resilienz" definiert den Begriff Resilienz und beschreibt die Bedeutung von Risiko- und Schutzfaktoren für die kindliche Entwicklung. Es werden Risikogruppen wie Alleinerziehende, kinderreiche Familien und Familien mit Migrationshintergrund vorgestellt und zwei empirische Studien zur Resilienzforschung (Kauai-Studie und Mannheimer Risikokinderstudie) vorgestellt. Abschließend werden zwei Handlungskonzepte zur Resilienzförderung (Grotberg und Grünke) erläutert.
Schlüsselwörter
Kinderarmut, Resilienz, Schutzfaktoren, Risikofaktoren, empirische Studien, Handlungskonzepte, Prävention, Lebenslagenansatz, Ressourcenansatz, Entwicklungsrisiken, psychische Widerstandsfähigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirkt sich Kinderarmut auf die Entwicklung aus?
Armut kann zu gesundheitlichen Problemen, Bildungsdefiziten und sozialen Ausgrenzungen führen, wobei Jungen und Mädchen oft unterschiedlich reagieren.
Was versteht man unter Resilienz?
Resilienz bezeichnet die psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern, die es ihnen ermöglicht, trotz widriger Lebensumstände wie Armut eine positive Entwicklung zu nehmen.
Was sind Schutzfaktoren in der kindlichen Entwicklung?
Schutzfaktoren sind Ressourcen wie eine stabile Bezugsperson, soziale Unterstützung oder individuelle Fähigkeiten des Kindes, die Belastungen abpuffern.
Welche Gruppen sind besonders von chronischer Armut gefährdet?
Statistisch gesehen sind Kinder von Alleinerziehenden, kinderreiche Familien und Familien mit Migrationshintergrund am häufigsten betroffen.
Wie kann Resilienz praktisch gefördert werden?
Durch kindzentrierte Konzepte, die Stärkung innerer Ressourcen und die Gestaltung der Schule als sicherer Schutzraum und Förderort.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Kinderarmut und Resilienz. Welche Möglichkeiten gibt es zur Förderung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282848