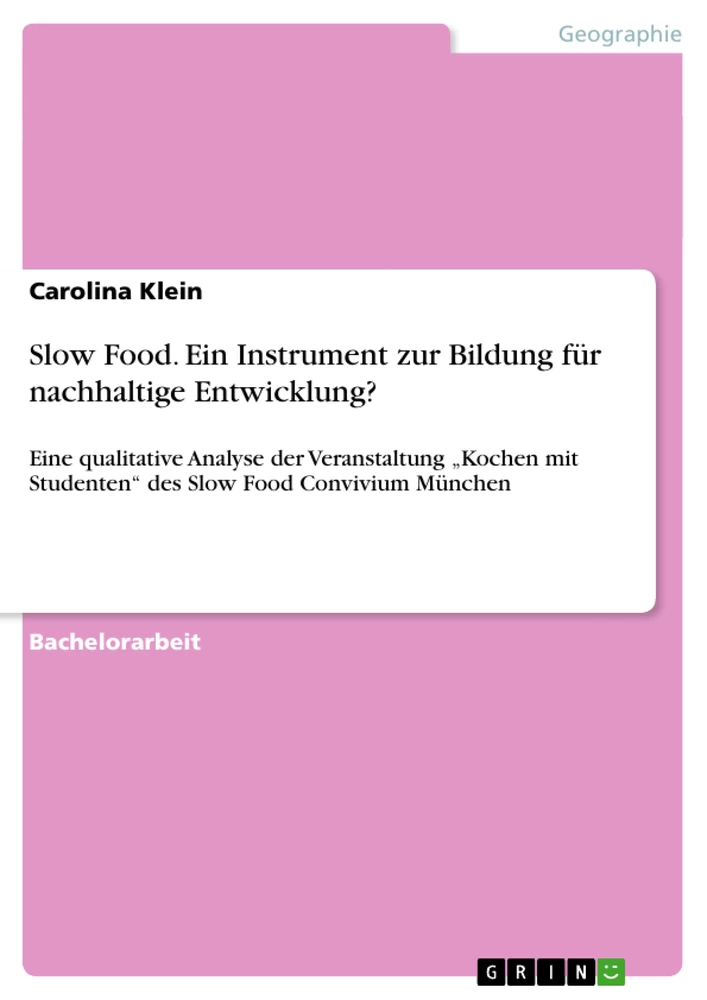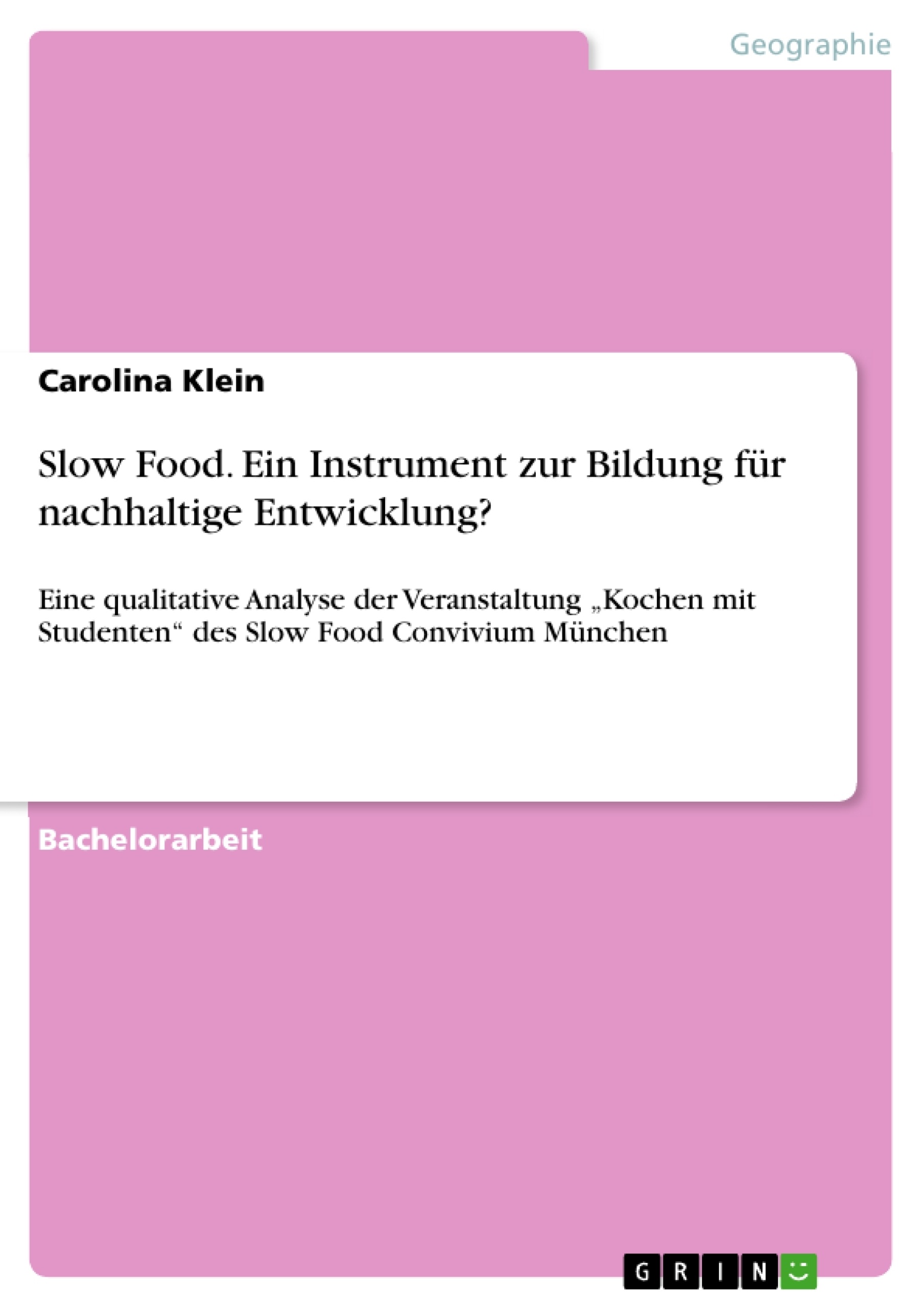Essen – ein Thema, welches Menschen überall auf der Erde in großer Bandbreite beschäftigt.
Diese reicht von der Überlegung, welche Köstlichkeit am Abend serviert werden soll, bis hin zur existenziellen Sorge um die Ernährung der eigenen Familie. Die Lebensmittelindustrie
steht vor dem Hintergrund einer immer weiter wachsenden Bevölkerung vor der Herausforderung, einen gangbaren Weg zu finden, die Ernährung einer sprunghaft wachsenden Bevölkerung auch in der Zukunft sicherzustellen.
In der Diskussion um Ernährung geht es allerdings nicht nur primär um Nahrungssicherung. Es gilt vielmehr auch zu klären, wie die Ernährungsbedürfnisse der heutigen Generation auf nachhaltige Weise befriedigt werden können. Hier gerät neben der Quantität vor allem auch die Qualität der produzierten Lebensmittel, verbunden mit den Ernährungsgewohnheiten der Konsumenten, in den Fokus (vgl. STIEß & HAYN 2005: 1). Die Globalisierung eröffnet den Menschen immer mehr Möglichkeiten, stellt die Gesellschaft gleichzeitig jedoch vor immer größere miteinander verwobene Herausforderungen.
„Wir leben in der paradoxen Situation, dass der Fortschrittsglaube in unserer postmodernen Gesellschaft einerseits gebrochen ist, andererseits in vielen Bereichen unvermindert vorausgesetzt wird und weitere Fortschritte vielfach notwendig scheinen, um die drängenden Probleme zu lösen“ (OSTHEIMER & VOGT 2004: 110).
Eine kontinuierlich zunehmende Komplexität auf sozialer, ökonomischer wie auch auf ökologischer Ebene bestimmt den Alltag der globalisierten Welt. Die Verantwortung, diesem Näherrücken von Kulturen und Märkten bewusst zu begegnen, obliegt nicht allein der Politik und der Wirtschaft. Vielmehr sind die Zivilgesellschaft und somit jeder Einzelne mit verantwortlich, sich den anstehenden Veränderungen anzunehmen. Ein globaler Mentalitätswandel muss ein-
setzen, der durch das Wissen von Wertevorstellungen und Normen gesteuert wird (vgl. DE HAAN 2003). Bildung ist daher unabdingbar. Sie stellt einen wichtigen Zugang zu Verständnisschaffung der weltweiten Zusammenhänge und Abhängigkeiten dar und bietet Raum für Diskussionen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Kochen für eine bessere Welt?
- Ziel der Arbeit und Einordnung in den geographischen Kontext
- Forschungsgegenstand
- Slow Bewegung – ein Konzept der Beschleunigung und Entschleunigung des Lebens
- Slow Food - eine Vereinigung zur Förderung der Esskultur
- Wege des Lernens unter dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung
- Ursprung des Begriffs nachhaltige Entwicklung
- Entstehung des Bildungsansatzes
- Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung
- Alternativer Wissensanspruch: Advocacy-Ansatz
- Ableitung der Forschungsfrage auf Basis von Leitfragen
- Angewandte Forschungsmethodik
- Qualitativ-teilnehmende Beobachtung der Veranstaltung „Kochen mit Studenten“
- Qualitative Interviews mit Slow Food Mitgliedern und Veranstaltungsteilnehmern
- Auswahlverfahren der Gesprächspartner
- Erhebungsdesign auf Grundlage der Forschungsmethodik
- Auswertung und Interpretation der Erhebungsdaten
- Die Motivation
- Die Gesprächssituation
- Die Wissensvermittlung
- Die Politik
- Slow Food als Impuls für einen Bewusstseinswandel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht den Beitrag von Slow Food zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Anhand der Veranstaltung „Kochen mit Studenten“ des Slow Food Convivium München wird analysiert, inwiefern Slow Food als Instrument zur Bewusstseinsbildung für nachhaltige Ernährung und Lebensweise fungieren kann.
- Die Bedeutung von Slow Food für die Förderung einer nachhaltigen Lebensweise
- Die Rolle von Bildung in der Bewusstseinsbildung für nachhaltige Entwicklung
- Die Analyse der Veranstaltung „Kochen mit Studenten“ als Plattform für Bildung und Austausch
- Die Motivation und Einstellungen der Teilnehmer und Organisatoren
- Die Herausforderungen und Chancen von Slow Food als Instrument der Nachhaltigkeitsbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt die Frage nach der Bedeutung von Slow Food für eine nachhaltige Entwicklung. Kapitel zwei erläutert das Ziel der Arbeit und ordnet es in den geographischen Kontext ein. Das dritte Kapitel definiert den Forschungsgegenstand und beleuchtet die Konzepte der Slow Bewegung und Slow Food. Kapitel vier beschäftigt sich mit den Wegen des Lernens im Kontext der nachhaltigen Entwicklung. Kapitel fünf leitet die Forschungsfrage auf Basis von Leitfragen ab. In Kapitel sechs wird die angewandte Forschungsmethodik vorgestellt, die sich aus qualitativ-teilnehmender Beobachtung der Veranstaltung „Kochen mit Studenten“ und qualitativen Interviews mit Slow Food Mitgliedern und Veranstaltungsteilnehmern zusammensetzt. Kapitel sieben analysiert und interpretiert die erhobenen Daten, wobei die Motivation, die Gesprächssituation, die Wissensvermittlung und die Politik im Fokus stehen. Kapitel acht beleuchtet das Potenzial von Slow Food als Impuls für einen Bewusstseinswandel.
Schlüsselwörter
Nachhaltige Entwicklung, Bildung, Slow Food, Esskultur, Bewusstseinsbildung, qualitative Forschung, teilnehmende Beobachtung, Interviews, Motivation, Wissensvermittlung, Politik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Bachelorarbeit über Slow Food?
Die Arbeit untersucht, ob und wie die Slow Food Bewegung als Instrument für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) fungieren kann.
Welches konkrete Projekt wurde als Forschungsgegenstand gewählt?
Untersucht wurde die Veranstaltung „Kochen mit Studenten“ des Slow Food Convivium München.
Wie definiert der Text die Slow Food Bewegung?
Slow Food wird als Vereinigung zur Förderung der Esskultur und als Teil einer umfassenderen Bewegung zur Entschleunigung des Lebens beschrieben.
Welche Forschungsmethodik wurde angewandt?
Die Studie nutzt qualitativ-teilnehmende Beobachtungen sowie qualitative Interviews mit Mitgliedern und Teilnehmern.
Kann Slow Food einen Bewusstseinswandel bewirken?
Die Arbeit analysiert, inwieweit die Wissensvermittlung bei gemeinsamen Kochereignissen Impulse für einen globalen Mentalitätswandel in Bezug auf Ernährung geben kann.
- Quote paper
- Carolina Klein (Author), 2013, Slow Food. Ein Instrument zur Bildung für nachhaltige Entwicklung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282904