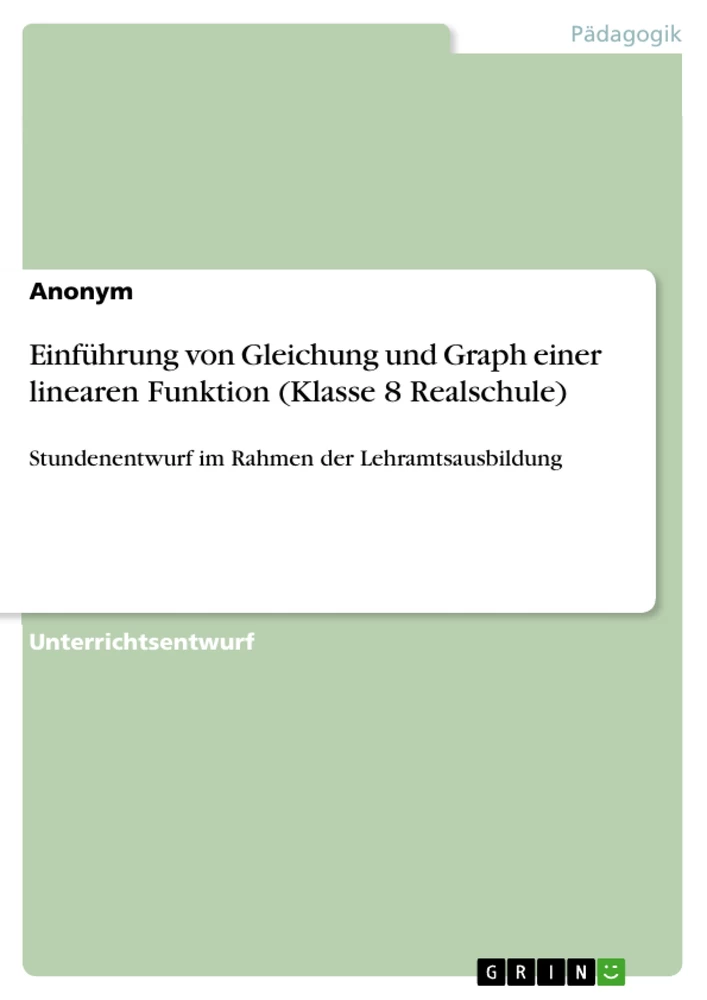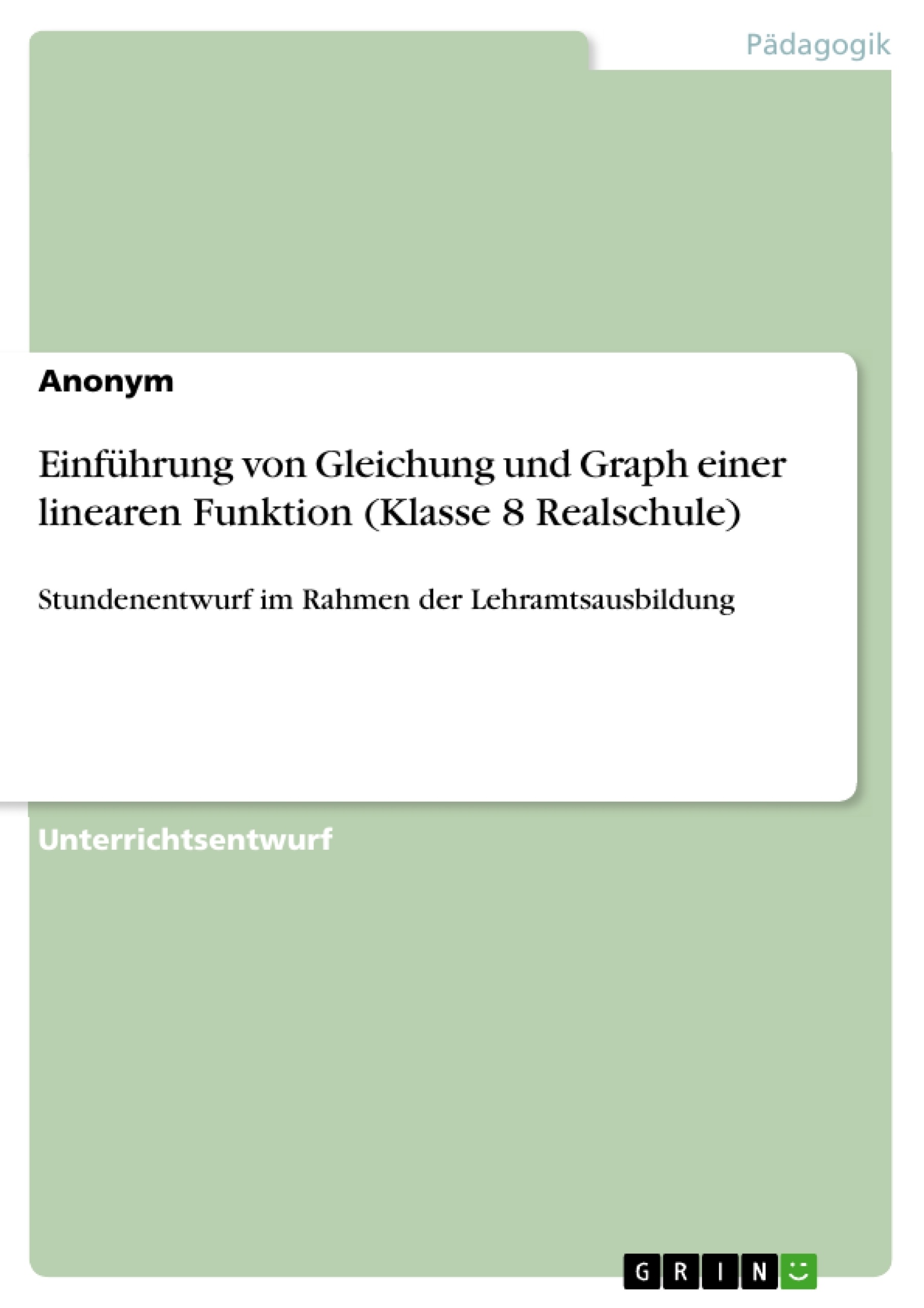Die Schüler erfahren beim Lösen von Sachproblemen mit Hilfe von Gleichungen, Gleichungssystemen und Funktionen grundlegende Schritte des Modellierens:
Modell bilden; Operieren im mathematischen Modell; Interpretieren der mathematischen Lösung mit Bezug auf den Sachverhalt
Sie nutzen die Problemlösestrategien Skizzieren und Zeichnen sowie tabellarisches Darstellen beim Aufstellen von Formeln und Gleichungen zu Sachproblemen. Die Schüler wenden Formeln an. Sie benutzen Hilfsmittel, wie Taschenrechner, Formelsammlung und Software sachgerecht und erkennen deren Stellenwert für das Problemlösen.
Entwickeln eines kritischen Vernunftgebrauchs: Sie nutzen mit linearen Funktionen und Gleichungssystemen weitere mathematische Mittel, um Alternativen abzuwägen und zwischen ihnen zu entscheiden.
Inhaltsverzeichnis
- Bedingungsanalyse
- Organisatorische und technische Rahmenbedingungen der Ausbildungsschule
- Analyse der Lerngruppe
- Einordnung der Stunde in den Lernbereich
- Tabellarische Lernbereichsplanung
- Inhalt und Ablauf der vorangegangenen und folgenden Stunde
- Fachwissenschaftliche Analyse
- Fachdidaktische Analyse
- Lernziele
- Methodische Überlegungen
- Verlaufsplanung
- Anhang
- Literatur
- Eidesstattliche Erklärung
- Tägliche Übung, Tafelbild und Folien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit stellt eine Unterrichtsstunde im Fach Mathematik für die 8. Klasse einer Mittelschule dar. Sie dient dazu, die didaktischen und methodischen Kompetenzen des Autors im Bereich der linearen Funktionen und Gleichungssysteme zu demonstrieren. Die Stunde soll den Schülern die Möglichkeit bieten, ihr Wissen über lineare Funktionen zu vertiefen und anzuwenden, um verschiedene Sachverhalte zu lösen.
- Analyse der Lerngruppe und ihrer individuellen Bedürfnisse
- Einordnung der Stunde in den Lernbereich und die tabellarische Lernbereichsplanung
- Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Analyse des Themas
- Formulierung von Lernzielen und methodische Überlegungen zur Gestaltung der Stunde
- Verlaufsplanung der Unterrichtsstunde mit detaillierter Beschreibung der einzelnen Phasen
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit der Bedingungsanalyse. Hier werden die organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen der Ausbildungsschule sowie die Analyse der Lerngruppe dargestellt. Die Lerngruppe besteht aus 22 Schülern, die ein unterschiedliches Leistungsniveau aufweisen. Es werden die Stärken und Schwächen der einzelnen Schüler beschrieben, um die Unterrichtsplanung zu optimieren.
Im zweiten Teil wird die Einordnung der Stunde in den Lernbereich erläutert. Die tabellarische Lernbereichsplanung zeigt die Inhalte und Kompetenzen, die im Laufe des Schuljahres vermittelt werden sollen. Die Stunde ist Teil des Lernbereichs "Lineare Funktionen und Gleichungssysteme" und soll den Schülern die Möglichkeit bieten, ihr Wissen über lineare Funktionen zu vertiefen und anzuwenden.
Die folgenden Kapitel befassen sich mit der fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Analyse des Themas, der Formulierung von Lernzielen, den methodischen Überlegungen und der Verlaufsplanung der Unterrichtsstunde. Die Arbeit endet mit einem Anhang, der die Literatur, die eidesstattliche Erklärung und die Materialien der Stunde enthält.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Unterrichtsplanung im Fach Mathematik, die Analyse der Lerngruppe, die Einordnung der Stunde in den Lernbereich, die fachwissenschaftliche und fachdidaktische Analyse des Themas, die Formulierung von Lernzielen, die methodischen Überlegungen und die Verlaufsplanung der Unterrichtsstunde. Der Text beleuchtet die didaktischen und methodischen Kompetenzen des Autors im Bereich der linearen Funktionen und Gleichungssysteme und zeigt, wie diese in der Praxis angewendet werden können.
Häufig gestellte Fragen
Was lernen Schüler der 8. Klasse über lineare Funktionen?
Schüler lernen, Sachprobleme mathematisch zu modellieren, Funktionsgleichungen aufzustellen und diese grafisch im Koordinatensystem darzustellen.
Welche Rolle spielt das Modellieren im Mathematikunterricht?
Beim Modellieren bilden Schüler aus einem realen Sachverhalt ein mathematisches Modell, operieren darin und interpretieren die Lösung anschließend wieder in Bezug auf die Ausgangssituation.
Wie wird die Lerngruppenanalyse für die Unterrichtsplanung genutzt?
Durch die Analyse der individuellen Stärken und Schwächen der 22 Schüler kann der Lehrer die Methoden und das Tempo der Stunde optimal an das Leistungsniveau anpassen.
Welche Hilfsmittel kommen beim Thema lineare Funktionen zum Einsatz?
Die Schüler nutzen sachgerecht Taschenrechner, Formelsammlungen und spezielle Software, um Gleichungssysteme zu lösen und Funktionen zu visualisieren.
Was ist das Ziel der tabellarischen Lernbereichsplanung?
Sie dient dazu, die aktuelle Unterrichtsstunde sinnvoll in den Kontext des gesamten Schuljahres und der vorangegangenen sowie folgenden Einheiten einzuordnen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2012, Einführung von Gleichung und Graph einer linearen Funktion (Klasse 8 Realschule), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283010