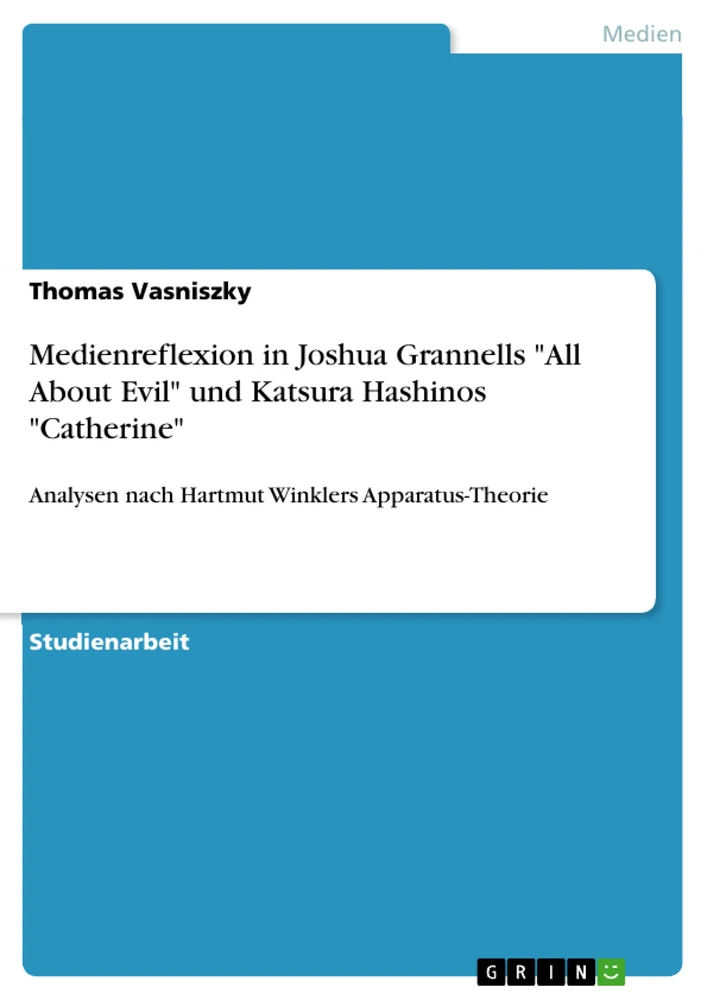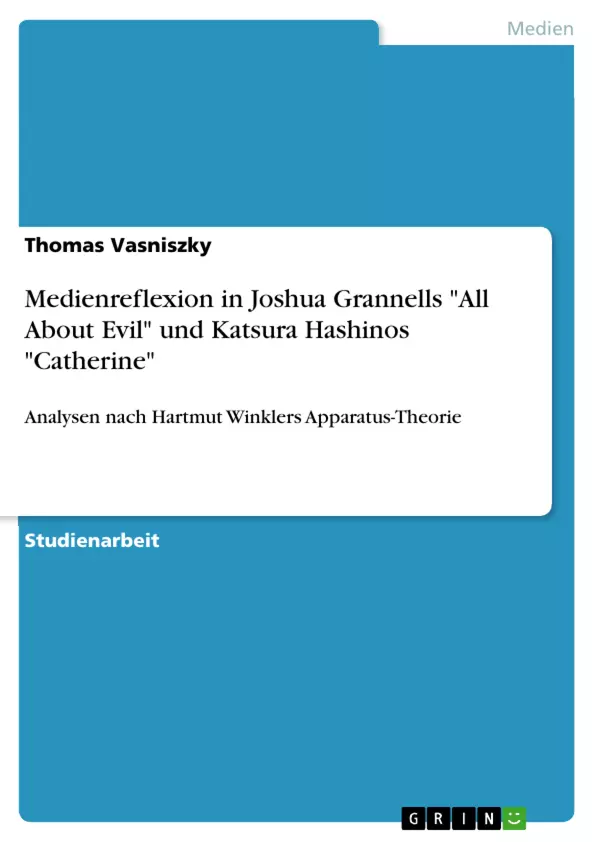Der vorliegende Text wendet Hartmus Winklers Apparatus-Theorien auf das Medium Film an und zeigt darüber hinaus, dass sich die zentralen Thesen auch auf das Medium Videospiel übertragen lassen. Exemplarische Anwendungsbeispiele sind der Film All About Evil (Joshua Grannell, 2010) und das Videospiel Catherine (Katsura Hashino, 2012).
Beide Werke sind in höchstem Maße selbstreflexiv, konstatieren also Aussagen über die eigene mediale Existenz. Im Rahmen dessen erweist es sich als ergiebig, Winklers Ausführungen zur Apparatus-Theorie mit selbstreferentiellen Werken ein Einklang zu bringen und Rückschlüsse über die Medien an sich zu ziehen.
Wie Winklers Gedanken sich in den Anwendungsbeispielen ausdrücken und was der Film und das Videospiel über ihr eigenes Medium aussagen, soll in der vorliegenden Arbeit aufgezeigt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Der Zuschauer und die filmische Technik
- Anwendungsbeispiele
- Film: All About Evil
- Videospiel: Catherine
- Selbstreflektion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die filmische Apparatur und deren Verhältnis zum Zuschauer anhand der Apparatus-Theorie von Hartmut Winkler. Dabei werden exemplarisch der Film "All About Evil" und das Videospiel "Catherine" betrachtet, um die Übertragbarkeit der Thesen auf unterschiedliche Medien zu zeigen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Selbstreflexivität beider Werke und deren Aussagen über ihre mediale Existenz.
- Die Verbindung zwischen filmischer Apparatur und Bedürfnissen des Einzelnen sowie der Gesellschaft
- Der direkte Konnex zwischen filmischer Technik und Subjektivität des Zuschauers
- Die Dekonstruktion der Vorstellung, Technik sei ein semantisches Neutrales Mittel
- Die Selbstreflexion der Medien in den Anwendungsbeispielen
- Die Rolle der Nostalgie in der Rezeption von B-Movie/Underground-Kino
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Zuschauer und die filmische Technik: Der Text führt in die Apparatus-Theorie von Hartmut Winkler ein und beleuchtet die Beziehung zwischen filmischer Technik und dem Zuschauer. Die Theorie betont die Verbindung zwischen der filmischen Apparatur und den Bedürfnissen des Einzelnen sowie der Gesellschaft. Zudem wird die direkte Verbindung zwischen filmischer Technik und Subjektivität des Zuschauers hervorgehoben. Weiterhin wird die Technik von der Vorstellung entkleidet, ein semantisches Neutrales Mittel zu sein, und die Analysierbarkeit der Sender-Seite und der Produkte des Kinos hinterfragt.
- Film: All About Evil: Das Kapitel analysiert den Film "All About Evil" als Beispiel für selbstreflexives Filmwerk. Die Analyse konzentriert sich auf die Rolle der Überwachungskamera als Filmkamera und deren Einfluss auf die Wahrnehmung des Publikums. Der Film reflektiert über die Grenzen zwischen Fiktion und Realität sowie über die Wirkung von Genrekonventionen. Die Entwicklung der Protagonistin Deborah und ihr Verhältnis zum Kino werden im Kontext der Nostalgie und der Suche nach Identität beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Apparatus-Theorie, filmische Technik, Selbstreflexion, Medienreflexion, "All About Evil", "Catherine", Horrorfilm, Schwarze Komödie, Nostalgie, Identität, Zuschauer, Bedürfnisstruktur, Gesellschaft, Technik, Medien, Videospiel.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Apparatus-Theorie von Hartmut Winkler?
Die Theorie untersucht die Verbindung zwischen technischer Apparatur (Kamera, Projektion) und der Subjektivität des Zuschauers sowie gesellschaftlichen Bedürfnissen.
Wie wird "All About Evil" medienreflexiv analysiert?
Der Film reflektiert über die Rolle der Kamera und die Grenzen zwischen Fiktion und Realität, indem er die Wirkung von Horrorgenre-Konventionen dekonstruiert.
Kann die Apparatus-Theorie auf Videospiele wie "Catherine" angewendet werden?
Ja, die Arbeit zeigt, dass sich Winklers Thesen über die mediale Existenz und Technik auch auf die interaktive Apparatur von Videospielen übertragen lassen.
Welche Rolle spielt Nostalgie in der Medienrezeption?
Die Arbeit beleuchtet Nostalgie im Kontext von B-Movies und Underground-Kino und wie diese die Wahrnehmung der Zuschauer beeinflusst.
Ist Medientechnik semantisch neutral?
Nein, die Apparatus-Theorie dekonstruiert diese Vorstellung und zeigt, dass Technik selbst Bedeutungen generiert und nicht nur ein Mittel zum Zweck ist.
- Citar trabajo
- Thomas Vasniszky (Autor), 2014, Medienreflexion in Joshua Grannells "All About Evil" und Katsura Hashinos "Catherine", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283101