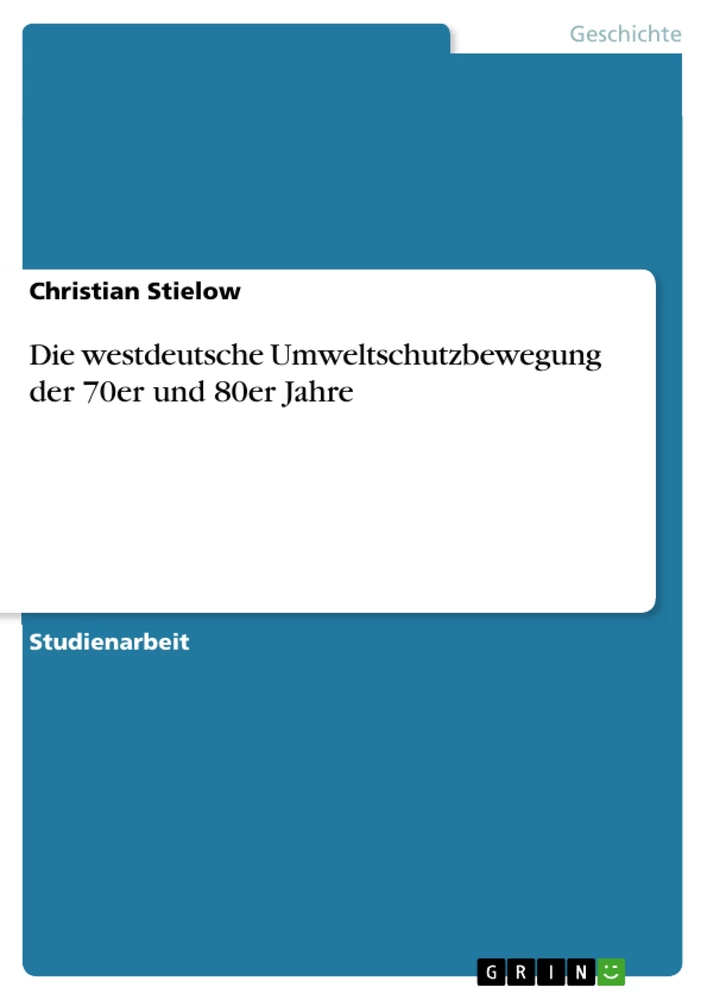Gemeinhin gilt das 20. Jahrhundert als das Jahrhundert der Umweltzerstörung: Lebensraumvernichtung in nie gekanntem Ausmaß, legale und illegale Jagd sowie die Verschmutzung des Wassers, des Bodens und der Atmosphäre veränderten die Erde in den vergangenen rund einhundert Jahren drastisch und führten zum Aussterben unzähliger Tier- und Pflanzenarten und zum Kollaps ganzer Ökosysteme. Nie zuvor hatte der Mensch den Planeten in so raschem Tempo so nachhaltig verändert wie im 20. Jahrhundert. Doch gerade die massive Zerstörung der Umwelt führte im selben Zeitraum zu einem bedeutenden Umdenken in Gesellschaft und Politik. Zum ersten Mal in der Geschichte wurden große Landschaftsgebiete unter Schutz gestellt, die Jagd auf bedrohte Arten gesetzlich verboten, umweltverträgliche Technologien entwickelt. Man kann das 20. Jahrhundert demnach auch als „Ära der Ökologie“ betrachten.
Einen entscheidenden Anteil an diesem Prozess hatten die Umweltschutzbewegungen. Eine erste gab es bereits um die „lange Jahrhundertwende“, als um 1900 Naturschutz und Lebensreform als neue Ideen aufkamen, zahlreiche Publikationen zum Thema erschienen und die ersten Heimat- und Artenschutzvereine gegründet wurden. In meiner vorliegenden Seminararbeit möchte ich aber die Umweltschutzbewegung der 1970-er und 1980-er Jahre näher beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Interpretationsmuster
- Die Zäsur der 70-er Jahre
- Phänomene des Modernen: Verwissenschaftlichung, Professionalisierung, Medialisierung
- Die Anti-Atomkraft-Bewegung: Widerstand gegen Social Engineering?
- Einflüsse auf den Umweltschutz in der BRD: „Westernisierung“ oder „Deutscher Sonderweg“?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die westdeutsche Umweltpolitik und Naturschutzbewegung der 1970er und 1980er Jahre im Kontext des 20. Jahrhunderts. Sie analysiert die umweltpolitischen, medialen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, wobei der Schwerpunkt auf den letzteren liegt.
- Die Bedeutung der 1970er Jahre als Zäsur für den Umweltschutz
- Die Rolle der Verwissenschaftlichung, Professionalisierung und Medialisierung in der Umweltschutzbewegung
- Der Konflikt um die Atomkraft als Ausdruck von Social Engineering
- Die Frage nach dem Einfluss des Westens auf die deutsche Umweltpolitik und Naturschutzbewegung
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Umweltschutzbewegung der 1970er und 1980er Jahre in den Kontext des 20. Jahrhunderts und erläutert die Aktualität des Themas.
- Das Kapitel „Die Zäsur der 70-er Jahre“ untersucht, inwieweit die 1970er Jahre eine Zäsur für den Umweltschutz darstellten und welche Rolle der „shock of the global“ und die Herausbildung eines neuen Gesellschaftssystems und Menschenbildes spielten.
- Das Kapitel „Phänomene des Modernen: Verwissenschaftlichung, Professionalisierung, Medialisierung“ analysiert, inwieweit diese Phänomene die Umweltschutzbewegung formten.
- Das Kapitel „Die Anti-Atomkraft-Bewegung: Widerstand gegen Social Engineering?“ beschäftigt sich mit dem Konflikt um die Atomkraft und untersucht, warum der Protest gegen die Kernenergie so leidenschaftlich geführt wurde.
- Das Kapitel „Einflüsse auf den Umweltschutz in der BRD: „Westernisierung“ oder „Deutscher Sonderweg“?“ befasst sich mit der Frage, in welchem Maß Umweltpolitik und Naturschutz in der Bundesrepublik vom Westen geprägt wurden.
Schlüsselwörter
Umweltschutzbewegung, 20. Jahrhundert, 1970er Jahre, 1980er Jahre, Westdeutschland, Zäsur, Verwissenschaftlichung, Professionalisierung, Medialisierung, Anti-Atomkraft-Bewegung, Social Engineering, „Westernisierung“, „Deutscher Sonderweg“, Umweltpolitik, Naturschutz.
Häufig gestellte Fragen
Warum gelten die 70er Jahre als Zäsur für den Umweltschutz?
In diesem Jahrzehnt entwickelte sich aus lokalem Naturschutz eine breite politische Bewegung, getrieben durch globale Krisenwahrnehmung und neue wissenschaftliche Erkenntnisse.
Welche Rolle spielte die Anti-Atomkraft-Bewegung?
Sie war der zentrale Kristallisationspunkt des Protests und richtete sich nicht nur gegen die Technologie, sondern auch gegen staatliche Planung („Social Engineering“).
Was bedeutet „Professionalisierung“ der Umweltschutzbewegung?
Die Bewegung wandelte sich von lockeren Bürgerinitiativen hin zu organisierten Verbänden mit Fachwissen, Lobbyarbeit und medialer Präsenz.
Gab es einen „Deutschen Sonderweg“ im Umweltschutz?
Die Arbeit untersucht, ob die deutsche Bewegung eher durch internationale Einflüsse („Westernisierung“) oder durch spezifisch deutsche Traditionen der Naturverbundenheit geprägt war.
Wie veränderte die Medialisierung den Umweltschutz?
Durch die Berichterstattung in Fernsehen und Presse wurden Umweltthemen erstmals massentauglich und konnten politischen Druck aufbauen.
- Arbeit zitieren
- Christian Stielow (Autor:in), 2014, Die westdeutsche Umweltschutzbewegung der 70er und 80er Jahre, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283178