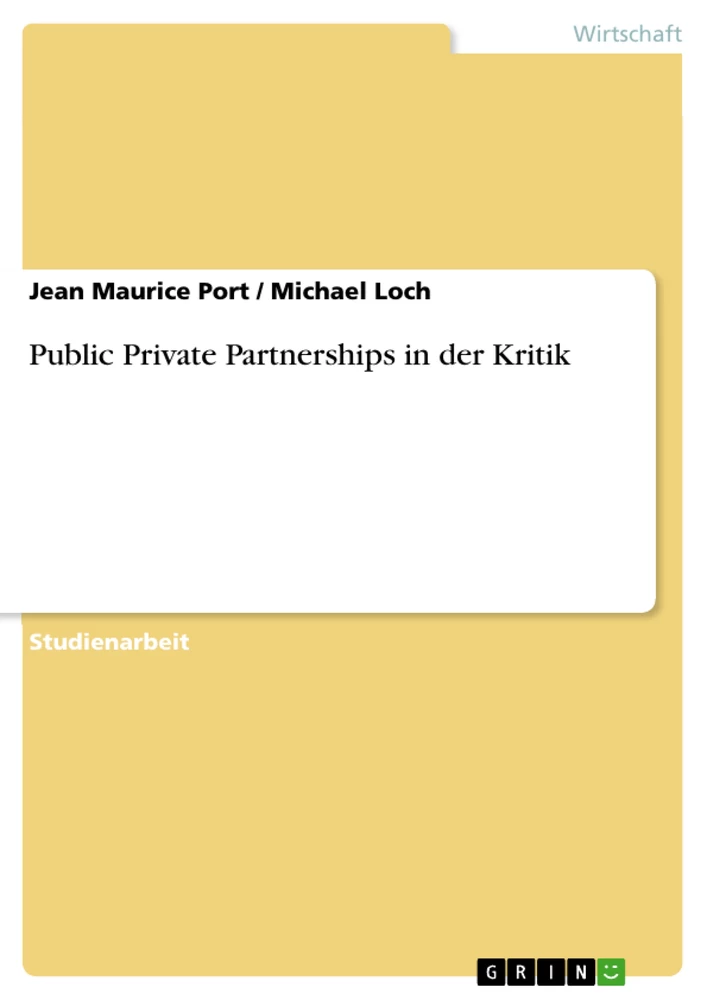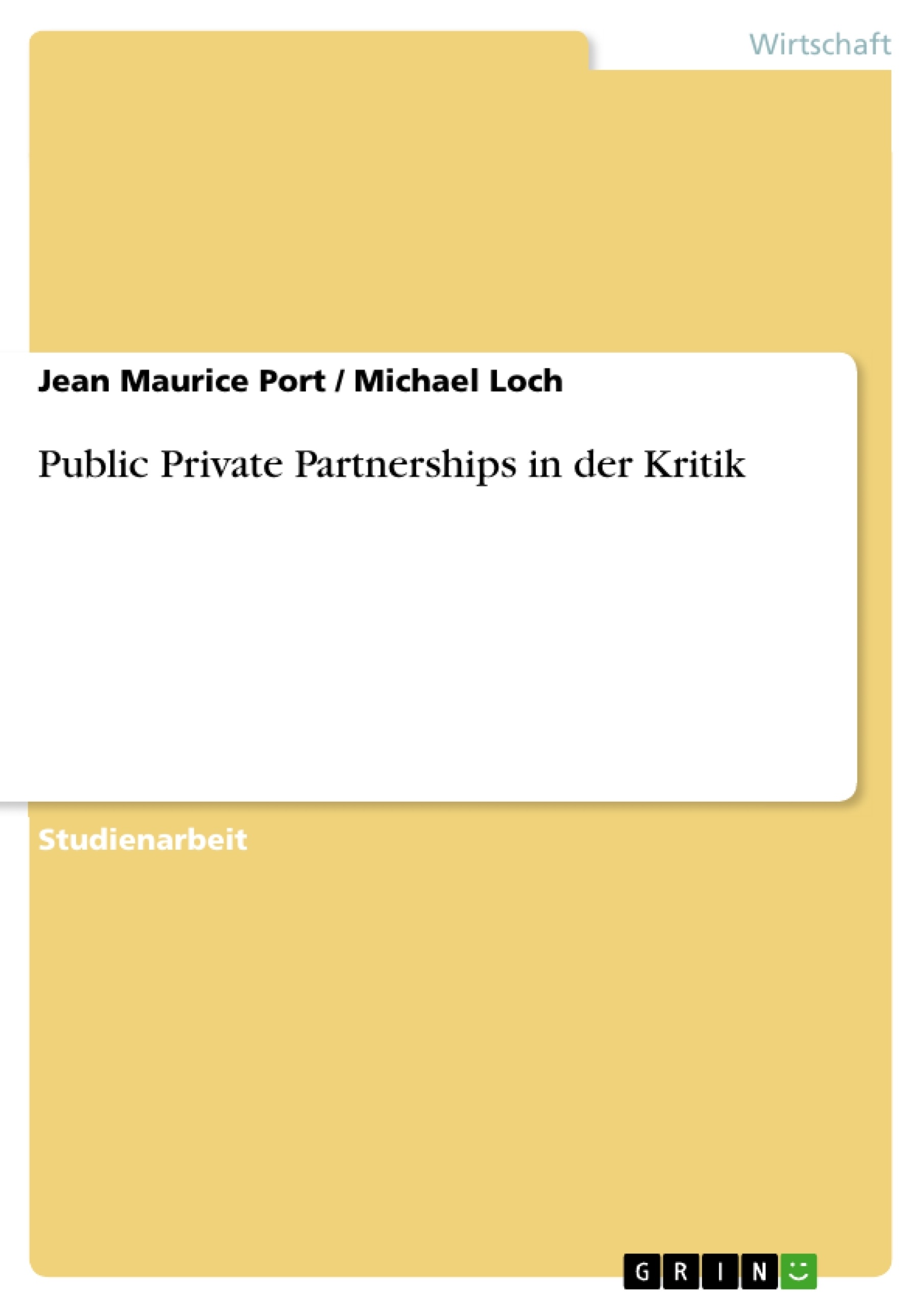Im Zuge etlicher neoliberaler Reformen hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht mehr nur das Selbstverständnis der öffentlichen Haushalte dahingehend geändert, dass nach dem Vorbild privatwirtschaftlich strukturierter Unternehmen die Sicherung der für den Bürger möglichst kostengünstigen Daseinsfürsorge die Leitwerte Effizienz und Effektivität als Sekundärziele an Bedeutung gewonnen haben. Zusätzlich stellt sich immer häufiger die Frage, woraus die finanziellen Mittel für mehr oder minder zwingend notwendige Investitionen generiert werden sollen.
Weil spätestens seit der Finanzkrise eine Neuverschuldung in Form offener Kreditaufnahmen entweder durch Schuldenbremsen rechtlich untersagt oder politisch unschick ist, haben Kommunen und Länder zunehmend das Instrument der PPP entdeckt, wodurch die finanzielle Belastung auf folgende Generationen abgewälzt wird. Weil die hierdurch entstehenden sozialen, ökologischen und ökonomischen Nachteile häufig erst viele Legislaturperioden später zu Tage treten, können die verantwortlichen Politiker realisierte PPP-Projekte der Öffentlichkeit gegenüber unbeirrt als ökonomischen Erfolg ihrer Amtsperiode verbuchen und nicht selten die eigene Wiederwahl sichern.
Dabei ist die vielgepriesene Entlastung der öffentlichen Haushalte bei genauerer Betrachtung nicht mehr als ein buchhalterischer Trick der die Entstehung von Schattenhaushalten zur Folge hat, denn obwohl der Deutsche Staat die Gebühren und Steuereinnahmen der folgenden Jahrzehnte verkauft, tauchen damit lediglich in die Zukunft verschobene Zahllasten bislang in keiner Verschuldungsbilanz auf. Sollten sie es in absehbarer Zukunft etwa durch die ESA-Richtlinie doch tun, würde die PPP-Blase hingegen platzen. Wären die Erfahrungen aus der Praxis deckungsgleich mit den Versprechungen der Theorie, hätte die Debatte höchstens ideologischen Streitwert. Kritik speziell am PPP-Konzept allerdings kommt nicht mehr nur aus ohnehin privatisierungsfeindlichen politischen Lagern sondern zunehmend aus der Mitte der Gesellschaft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Vorgehensweise
- Public Private Partnerships
- Definition
- Privatisierungsformen
- PPP-Vertragsmodelle
- Chancen und Risiken öffentlich-privater Partnerschaften
- Staatliche Motive
- Generelle Kritik an PPPs
- Zur Problematik von Wirtschaftlichkeitsgutachten
- Untergrabung der Demokratie
- Praxisbeispiele
- Gefängnisse
- Wasserversorgung
- Verbesserungsansätze
- Fazit
- Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Kritik an Public Private Partnerships (PPPs) und analysiert die Chancen und Risiken dieser Finanzierungsform für öffentliche Aufgaben. Ziel ist es, die Problematik von PPPs zu beleuchten und zu erörtern, ob und in welchen Bereichen sie durch Verbesserungen vorteilhaft realisiert werden können oder ob alternative Finanzierungsmodelle sinnvoller sind.
- Definition und Abgrenzung von PPPs
- Kritik an PPPs: Wirtschaftlichkeit, Transparenz, Demokratie
- Praxisbeispiele und Fallstudien
- Verbesserungsansätze für PPP-Modelle
- Alternativen zu PPPs
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz von PPPs im Kontext der öffentlichen Finanzpolitik dar und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 definiert PPPs, stellt verschiedene Privatisierungsformen vor und beschreibt die gängigen PPP-Vertragsmodelle. Kapitel 3 analysiert die Chancen und Risiken von PPPs aus staatlicher und gesellschaftlicher Perspektive. Dabei werden die Problematik von Wirtschaftlichkeitsgutachten und die potenzielle Untergrabung der Demokratie durch PPPs beleuchtet. Kapitel 4 präsentiert Praxisbeispiele für PPPs in den Bereichen Gefängnisse und Wasserversorgung. Das Kapitel 5 diskutiert mögliche Verbesserungsansätze für PPP-Modelle. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Public Private Partnerships (PPPs), Privatisierung, öffentliche Finanzpolitik, Wirtschaftlichkeit, Transparenz, Demokratie, Risikoallokation, Wirtschaftlichkeitsgutachten, Praxisbeispiele, Verbesserungsansätze, Alternativen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Public Private Partnership (PPP)?
PPP bezeichnet eine langfristige Zusammenarbeit zwischen der öffentlichen Hand und privaten Unternehmen zur Finanzierung, Planung und dem Betrieb öffentlicher Infrastrukturaufgaben.
Warum stehen PPPs oft in der Kritik?
Kritiker bemängeln mangelnde Transparenz, die Entstehung von Schattenhaushalten und die Tatsache, dass PPPs oft teurer sind als die herkömmliche staatliche Finanzierung.
Was ist das Problem bei Wirtschaftlichkeitsgutachten für PPPs?
Diese Gutachten werden oft unter Verschluss gehalten und nutzen Annahmen, die private Partner systematisch gegenüber staatlichen Lösungen bevorzugen, was die demokratische Kontrolle erschwert.
In welchen Bereichen werden PPPs häufig eingesetzt?
Typische Anwendungsgebiete sind der Bau von Schulen, Autobahnen, Gefängnissen und die Wasserversorgung.
Untergraben PPPs die Demokratie?
Durch jahrzehntelange Vertragslaufzeiten und geheime Klauseln werden künftige politische Entscheidungsräume massiv eingeschränkt, was als demokratisches Defizit gesehen wird.
- Arbeit zitieren
- B.A. Jean Maurice Port (Autor:in), Michael Loch (Autor:in), 2014, Public Private Partnerships in der Kritik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283308