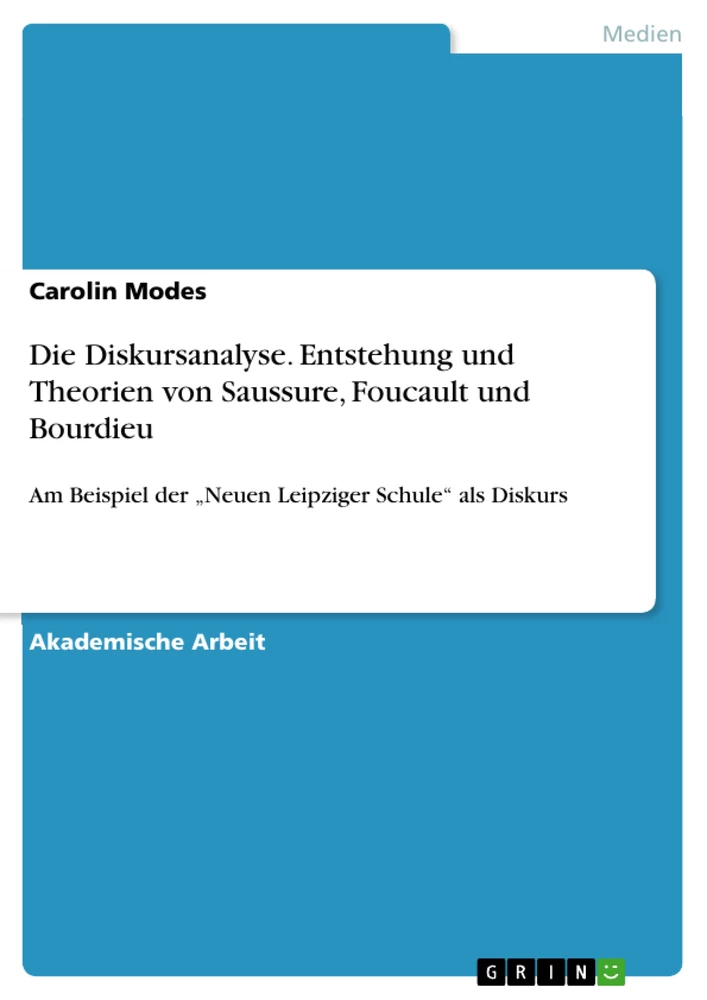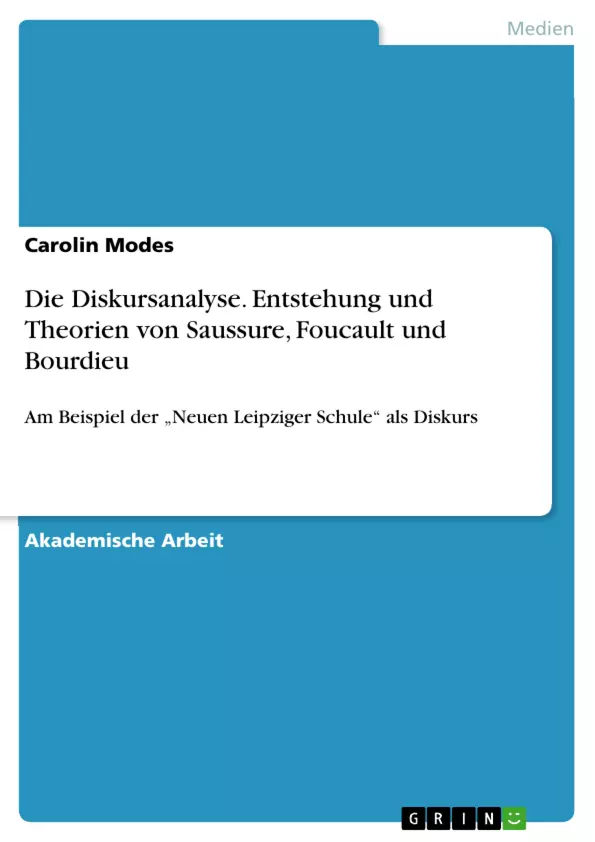In dieser Arbeit geht es um den Begriff Diskurs und die daraus resultierende Diskursanalyse. Als praktisches Beispiel für einen Diskurs dient die „Neue Leipziger Schule“, eine Künstlergruppe bei der die Grenzen zwischen Diskurs und Realität verschwimmen. Für die theoretische Herleitung der Entstehung des Zusammenhangs von Wissen und Wirklichkeit werden drei theoretische Positionen heran gezogen.
Zunächst wird auf die Theorie Ferdinand de Saussures (1857-1913) eingegangen, um die soziale Bedingtheit von Kommunikation aufzuzeigen. Daran anschließend wird mit Hilfe spezifischer Arbeiten Michel Foucaults (1926-1984) auf die Bedeutung der Diskurse als Erscheinungs- und Zirkulationsformen des Wissens hingewiesen. Anhand der kultursoziologischen Erkenntnisse von Pierre Bourdieu (1930-2002) wird schließlich die Bedeutung der Akteure und ihrer Macht in der Produktion von Diskursen, Kategorien und Wirklichkeit dargestellt.
Begriffe oder Kategorien wie z.B. Familie oder Geschlecht scheinen natürlich und selbstverständlich, sind aber eigentlich kollektive Vereinbarungen, die lediglich nicht mehr hinterfragt werden. Damit etwas Wirklichkeit wird, bedarf es der Akteure mit ihren jeweiligen Interessen, die über die Macht oder Legitimität zu sprechen verfügen, denn es ist nur einigen wenigen möglich Wissen zu etablieren. Diese Akteure lassen Dinge entstehen in dem sie über sie sprechen, sie abgrenzen und benennen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff „Diskurs“
- Theoretische Voraussetzungen für eine akteurzentrierte Diskursanalyse
- Ferdinand de Saussure und die soziale Bedingtheit von Kommunikation
- Michel Foucault und die Entstehung von „Wissen“
- Pierre Bourdieu und die Bedeutung der Akteure
- Die akteurzentrierte Diskursanalyse im Anschluss an Bourdieu
- Verhältnis des kulturellen zum sozialen Feld
- Das kulturelle Feld und seine Akteure
- Fazit und Praxisausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studie analysiert die Entstehung und Konstruktion der „Neuen Leipziger Schule“ (NLS) als Diskurs. Sie untersucht, wie verschiedene Akteure, wie Künstler, Galeristen, Kritiker und Institutionen, an der Entstehung und Verbreitung dieses Begriffs beteiligt waren.
- Die Bedeutung von Diskursen für die Produktion von Wissen und Wirklichkeit
- Die Rolle von Akteuren und ihren Machtverhältnissen in der Diskursbildung
- Die Konstruktion von Kategorien und Begriffen wie „Neue Leipziger Schule“
- Die Analyse von Veröffentlichungen und Diskursen im Zeitraum von 1997 bis 2006
- Die Identifizierung von Positionen und Strategien der verschiedenen Akteure im NLS-Diskurs
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der „Neuen Leipziger Schule“ ein und stellt die Problematik der Konstruktion dieses Begriffs dar. Sie verdeutlicht die Relevanz der Diskursanalyse für die Untersuchung dieser Thematik.
- Der Begriff „Diskurs“: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Diskursbegriffs und seine Relevanz für die vorliegende Studie. Es wird auf die verschiedenen Begriffsverwendungen und die Bedeutung der sozialen Dimension von Sprache eingegangen.
- Theoretische Voraussetzungen für eine akteurzentrierte Diskursanalyse: Dieses Kapitel stellt die theoretischen Grundlagen der Untersuchung dar. Es werden die Ansätze von Ferdinand de Saussure, Michel Foucault und Pierre Bourdieu vorgestellt und deren Relevanz für die Analyse von Diskursen und der Entstehung von Wissen erläutert.
- Die akteurzentrierte Diskursanalyse im Anschluss an Bourdieu: Dieses Kapitel erläutert die Anwendung der Bourdieuschen Theorie auf die Analyse der „Neuen Leipziger Schule“. Es wird auf das Verhältnis von kulturellen und sozialen Feldern, die Bedeutung von Akteuren und deren Macht sowie die Konstruktion von Wirklichkeit durch Diskurse eingegangen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Studie sind: Diskursanalyse, Neue Leipziger Schule, Kultursoziologie, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Ferdinand de Saussure, Akteure, Macht, Wissen, Konstruktion, Wirklichkeit, Kunstmarkt.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einer Diskursanalyse?
Eine Diskursanalyse untersucht, wie Wissen und Wirklichkeit durch Sprache und gesellschaftliche Debatten konstruiert und stabilisiert werden.
Welchen Beitrag leistete Michel Foucault zur Diskurstheorie?
Foucault betonte, dass Diskurse Formen der Zirkulation von Wissen sind und eng mit Machtstrukturen verknüpft sind, die bestimmen, was als „wahr“ gilt.
Was bedeutet „soziale Bedingtheit von Kommunikation“ bei Saussure?
Saussure zeigt auf, dass Sprache ein soziales System von Zeichen ist, deren Bedeutung auf kollektiven Vereinbarungen innerhalb einer Gemeinschaft beruht.
Wie erklärt Pierre Bourdieu die Entstehung von Wirklichkeit?
Bourdieu fokussiert auf die Akteure in sozialen Feldern, die über die Macht und Legitimität verfügen, Dinge zu benennen, abzugrenzen und so Wissen zu etablieren.
Was ist die „Neue Leipziger Schule“ im Sinne des Diskurses?
Sie dient als Beispiel für einen Diskurs, bei dem die Grenzen zwischen Realität und medialer/kritischer Konstruktion verschwimmen, um eine Künstlergruppe auf dem Markt zu positionieren.
- Quote paper
- Carolin Modes (Author), 2007, Die Diskursanalyse. Entstehung und Theorien von Saussure, Foucault und Bourdieu, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283508