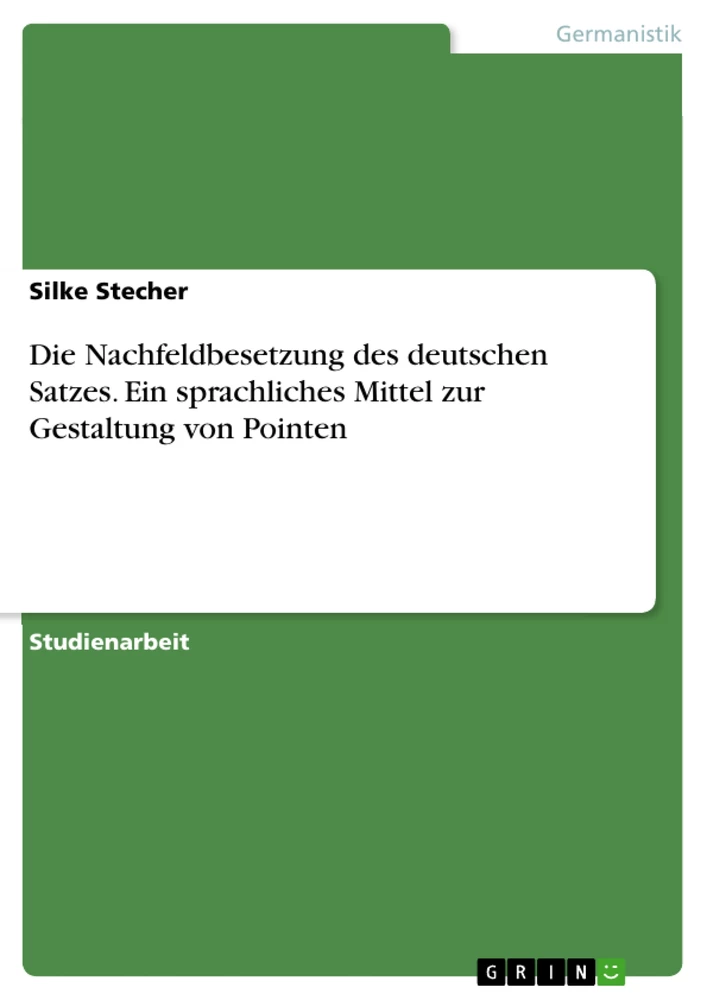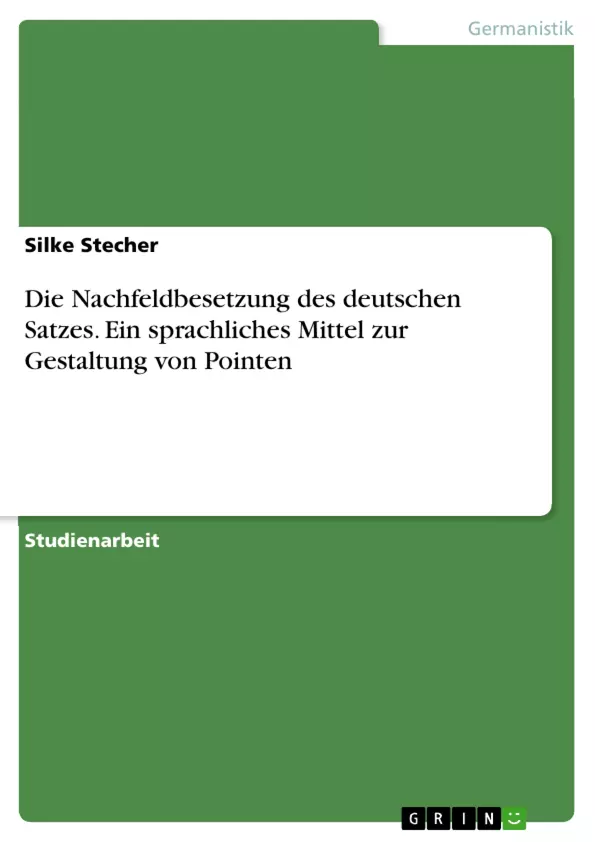Ein Witz bringt uns zum Lachen, weil wir urplötzlich in unerwartete Zusammenhänge eingeweiht werden. Eine uns vertraut erscheinende Wirklichkeit wird durch die Pointe umgestoßen. Die Pointe ist der entscheidende Teil eines Witzes oder eines schlagfertigen Spruchs – der Teil, der den Zuhörer zum Lachen bringt. Aufgabe dieser Arbeit ist es zu untersuchen, ob sich der geistreiche Schlusseffekt eines Witzes auch in einer besonderen syntaktischen Gestaltung der Pointe widerspiegeln kann. Genauer gesagt, ob gemäß dem Motto „Und das Beste kommt zum Schluss…“ die Nachfeldbesetzung beim letzten Satz der Pointe eventuell eine wichtige Rolle spielt. Der komische Effekt einer Pointe beruht oft darauf, dass der Hörer eines Witzes überrascht wird und auf einmal einen Zusammenhang zwischen zwei auf den ersten Blick nicht zusammenpassenden Konzepten erkennt.
[...]
Viele Pointen basieren auf einer Skriptopposition. Wörter und Begriffe sind in einem gewissen semantischen Umfeld eingebettet, das bei dem Zuhörer Assoziationen hervorruft und Erwartungen weckt – dem sogenannten Skript. Der erste Teil des anfänglich zitierten Witzes ist in das Skript „ängstlicher Patient“ eingebettet. Dann kippt dieses Skript um und wir stellen fest, dass wir es gar nicht mit einem extrem ängstlichen Patienten zu tun haben, sondern mit einem Arzt, der Angst davor hat die Operation durchzuführen. Dieser Skriptwechsel provoziert den komischen Effekt und bringt den Zuhörer im besten Fall zum Lachen.
Die Hypothese meiner Arbeit lautet, dass bei einer Pointe das Nachfeld des letzten Satzes eine wichtige Rolle spielen kann, weil es – um bei der Metapher mit dem Puzzle zu bleiben – das letzte und wichtigste Puzzleteil liefert. Das Puzzleteil, welches das Bild im Kopf des Lesers bzw. Zuhörers vervollständigt und den verblüffenden und unvermuteten Zusammenhang evoziert. Desweiteren denke ich, dass das Wissen um die Inkongruenztheorie des Witzes und die Tatsache, dass die bewusste Stellung eines Satzgliedes ins Nachfeld des deutschen Satzes sehr stark zur Rhematisierung dieses Satzgliedes beitragen kann, geeignete „Werkzeuge“ sind, um selbst Witze bzw. Punchlines zu schreiben.
Deshalb gliedert sich diese Arbeit in zwei Teile. Der theoretische Teil beschäftigt sich zuerst mit den möglichen Nachfeldbesetzungen des deutschen Satzes. Im praktischen Teil dieser Arbeit werde ich eigene Witze bzw. Punchlines kreieren, deren Pointe ganz bewusst auf dem stilistischen Mittel einer Nachfeldbesetzung beruht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hypothese und methodisches Vorgehen
- Kurze Einführung in die Inkongruenztheorie des Witzes
- Klassifikation und Funktion der Nachfeldbesetzung im Deutschen
- Klassifikation der fakultativen Nachfeldbesetzungen
- Die Nutzung des Nachfelds für kommunikative Zwecke
- Empirische Evidenz
- Die Nachfeldbesetzung - ein „Werkzeug“ zur Gestaltung von Pointen?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob die Nachfeldbesetzung im Deutschen ein sprachliches Mittel zur gezielten Gestaltung von Pointen in Witzen darstellt. Sie untersucht, ob die Positionierung des letzten Satzgliedes im Nachfeld, insbesondere in der Pointe, einen wichtigen Beitrag zum Überraschungseffekt und der humoristischen Wirkung leisten kann.
- Die Inkongruenztheorie des Witzes
- Die Funktion der Nachfeldbesetzung im Deutschen
- Die Rolle der Nachfeldbesetzung in der Gestaltung von Pointen
- Empirische Evidenz für die Hypothese
- Die Nachfeldbesetzung als "Werkzeug" zur Kreation von Witzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert den besonderen Stellenwert der Pointe im Witz. Sie stellt die Hypothese auf, dass die Nachfeldbesetzung des letzten Satzes in der Pointe eine entscheidende Rolle für den humoristischen Effekt spielen kann. Kapitel 1 beleuchtet die Inkongruenztheorie des Witzes und erläutert, wie Skriptwechsel und unerwartete Zusammenhänge zum Lachen führen.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Klassifikation und Funktion der Nachfeldbesetzung im Deutschen. Es werden verschiedene Arten der Nachfeldbesetzung vorgestellt und deren kommunikative Funktionen diskutiert. Kapitel 3 präsentiert empirische Evidenz, die die Hypothese der Arbeit unterstützt. Es werden Beispiele aus verschiedenen Witzen analysiert, um die Rolle der Nachfeldbesetzung für die Pointe zu beleuchten.
Kapitel 4 untersucht die Nachfeldbesetzung als "Werkzeug" zur Gestaltung von Pointen. Es werden eigene Witze bzw. Punchlines kreiert, deren Pointe bewusst auf der Nachfeldbesetzung basiert.
Schlüsselwörter
Nachfeldbesetzung, Pointe, Witz, Inkongruenztheorie, Skript, Überraschungseffekt, Humor, Sprachliche Mittel, Stilistik, Rhematisierung, Ausklammerung, Empirische Evidenz, Punchline, Kreation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Nachfeldbesetzung im deutschen Satz?
Die Nachfeldbesetzung (auch Ausklammerung genannt) beschreibt das Platzieren von Satzgliedern hinter der rechten Satzklammer, also ganz am Ende des Satzes.
Wie trägt die Nachfeldbesetzung zur Wirkung einer Pointe bei?
Sie fungiert als das „letzte Puzzleteil“, das erst ganz am Schluss den überraschenden Zusammenhang liefert und dadurch den komischen Effekt verstärkt.
Was besagt die Inkongruenztheorie des Witzes?
Humor entsteht laut dieser Theorie, wenn der Zuhörer plötzlich einen unerwarteten Zusammenhang zwischen zwei Konzepten erkennt, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen.
Was ist eine Skriptopposition?
Ein Witz basiert oft darauf, dass ein anfängliches Erwartungsmuster (Skript) plötzlich in ein gegenteiliges oder völlig anderes Skript umkippt (z.B. vom „ängstlichen Patienten“ zum „ängstlichen Arzt“).
Warum wird die Nachfeldbesetzung als „Werkzeug“ bezeichnet?
Weil man durch die bewusste Stellung eines Satzgliedes ins Nachfeld dieses rhematisieren (betonen) kann, was gezielt zur Konstruktion von Witzen und Punchlines genutzt werden kann.
Welche Rolle spielt die Rhematisierung?
Rhematisierung bedeutet, die wichtigste neue Information hervorzuheben. Im Witz ist dies meist die Pointe, die durch die Endstellung maximale Aufmerksamkeit erhält.
- Quote paper
- Silke Stecher (Author), 2011, Die Nachfeldbesetzung des deutschen Satzes. Ein sprachliches Mittel zur Gestaltung von Pointen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283648