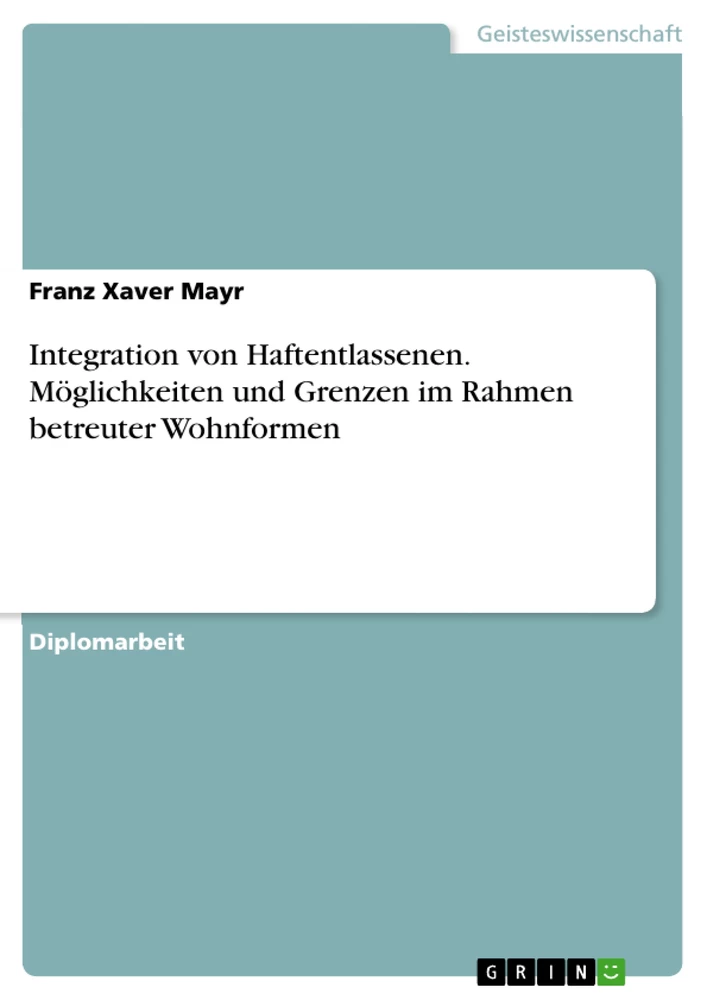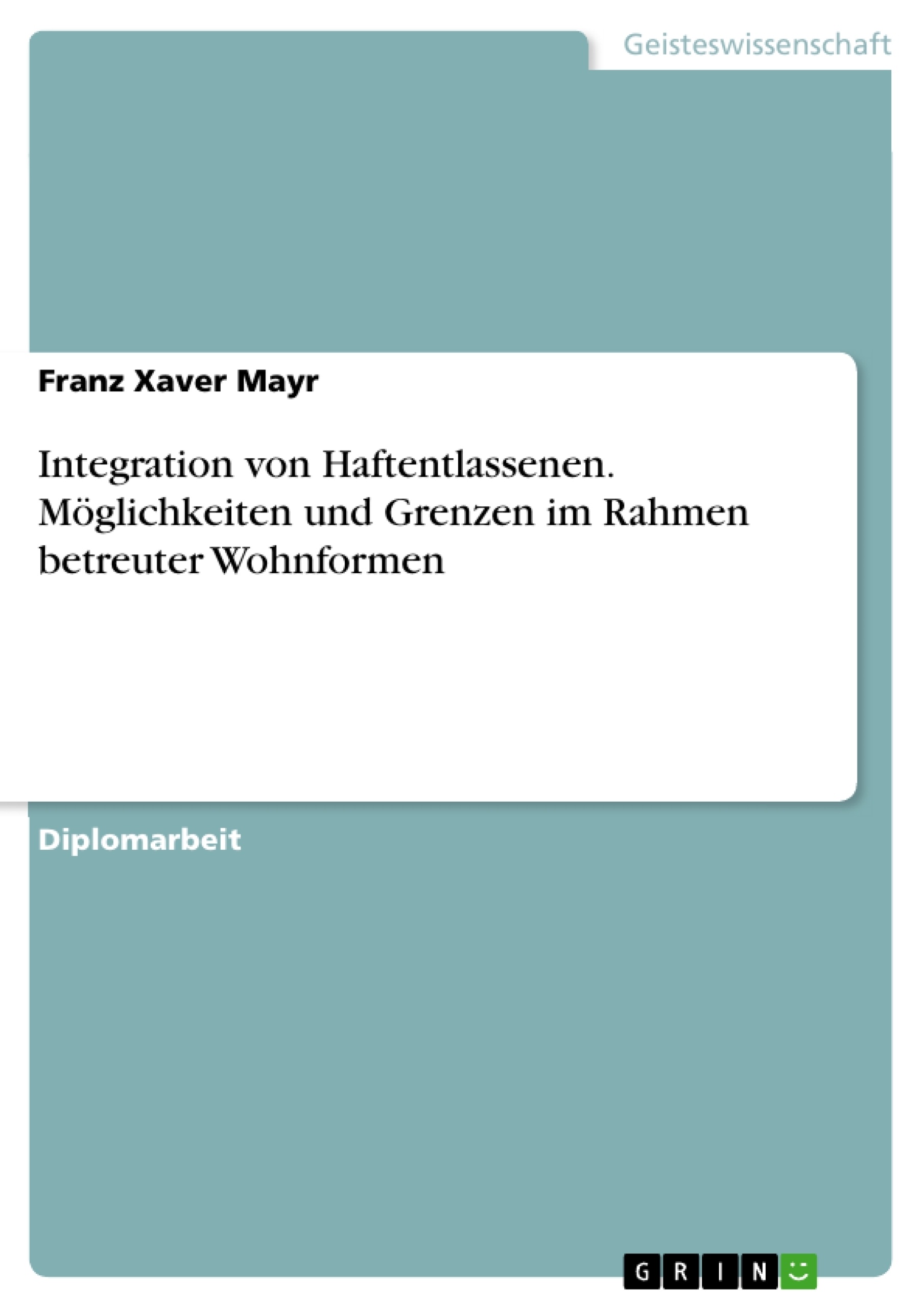Um das Thema "Integration von Haftentlassenen" behandeln zu können, bedarf es als erstes einer Klärung des Begriffes "Integration". Die Abgrenzung vom Begriff "Resozialisierung" und der Versuch einer Definition des Begriffes "Integration" ist eine Aufgabe dieses Buches. Des Weiteren beschäftigt sich das Buch mit der Frage nach gelungener sozialer Integration. Verschiedene Institutionen und Betroffene nehmen dazu Stellung.
Dass die Freiheitsstrafe einen dramatischen Einschnitt im Leben eines Menschen darstellt, steht außer Zweifel. Menschen werden dabei aus ihrer gewohnten Umgebung herausgerissen, von der Gesellschaft ausgesperrt. Der Staat begründet dies vor allem mit dem Argument der Sicherheit, hat aber auch den Anspruch, durch die Freiheitsstrafe den Verurteilten zu einer rechtschaffenen und den Erfordernissen des Gemeinschaftslebens angepassten Lebenseinstellung zu verhelfen (vgl. § 20 (1) Strafvollzugsgesetz).
Durch das "Wegsperren" erfahren viele Strafgefangene eine soziale Des-Integration. Sie verlieren ihre Arbeitsstelle, der Kontakt zur Familie wird weniger oder reißt ganz ab, Schulden entstehen oder werden höher, die Wohnung geht verloren. Nach der Haftentlassung ist eine Re-Integration notwendig.
Welchen Sinn hat die Strafe, dass diese massive Veränderung im Leben eines Menschen gerechtfertigt ist? Welche Alternativen zur Freiheitsstrafe gibt es, die kleinere "Schäden" in der sozialen Integration eines Menschen verursachen?
Die Situation von Inhaftierten wird in einem weiteren Kapitel des Buches behandelt. Welchen Belastungen und Entbehrungen sind sie ausgesetzt und wie wirken sich diese auf ihre Persönlichkeit und auf das bevorstehende Leben in Freiheit aus.
Viele Haftentlassene kommen mit den Konsequenzen der Haftstrafe, aber auch mit ihren Defiziten, die sie bereits vor der Inhaftierung erworben haben, nicht zurecht. Um wieder in die Gesellschaft integriert zu werden, brauchen sie Unterstützung und Begleitung. Udo Rauchfleisch gibt hier zwei Dimensionen an, die für die Integration von Haftentlassenen wichtig sind: die soziale Dimension und die psychologische Dimension.
Eine spezielle Form der Unterstützung ist die Unterbringung in betreuten Wohnformen. Wie kann durch sozialarbeiterische Betreuung in Wohneinrichtungen die soziale Integration von Haftentlassenen unterstützt werden und welche Möglichkeiten, aber auch welche Grenzen, liegen in dieser Betreuung?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. "Resozialisierung" und "Integration" – Definitionen
- 2.1. Resozialisierung
- 2.2. Integration
- 3. Gelungene soziale Integration?
- 3.1. Definitionen verschiedener Institutionen
- 3.1.1. Bundesministerium für Justiz
- 3.1.2. Verein Neustart
- 3.1.3. Caritaswohngemeinschaft Wege
- 3.2. Beispiel für gelungene Integration
- 3.3. Integration aus der Sicht der Betroffenen
- 3.1. Definitionen verschiedener Institutionen
- 4. Strafe und Strafvollzug
- 4.1. Vom Sinn der Strafe
- 4.1.1. Gerechtigkeitstheorien
- 4.1.2. "Relative" Theorien
- 4.1.3. "Vereinigungstheorien"
- 4.1.4. Die negativen Aspekte der Strafe
- 4.2. Das Strafvollzugsgesetz
- 4.3. Alternativen zur Freiheitsstrafe
- 4.3.1. Diversion
- 4.3.2. Bedingte und teilbedingte Verurteilungen
- 4.3.3. Bedingte Entlassungen
- 4.4. Zusammenfassung
- 4.1. Vom Sinn der Strafe
- 5. Situation von Häftlingen
- 5.1. Entmündigung der Insassen – Veränderung der Persönlichkeit
- 5.2. Deprivationen
- 5.2.1. Freiheitsverlust und Identitätsverlust
- 5.2.2. Entzug materieller und immaterieller Güter
- 5.2.3. Verlust der Privatsphäre und der Selbstbestimmung
- 5.2.4. Verlust heterosexueller Beziehungen
- 5.2.5. Verlust der eigenen Sicherheit
- 5.3. Das Gefängnis als totale Institution
- 5.4. Die Entlassungssituation
- 6. Situation von Haftentlassenen
- 6.1. Die soziale Dimension
- 6.1.1. Mangelnde Schul- und Berufsausbildung
- 6.1.2. Die Schuldenproblematik
- 6.1.3. Wohnsituation
- 6.1.4. Mangelnde soziale Kompetenzen
- 6.1.5. Aufbau eines tragfähigen sozialen Netzes
- 6.2. Die psychologische Dimension
- 6.1. Die soziale Dimension
- 7. Die Sozialarbeit mit Haftentlassenen in betreuten Wohnformen – Das Konzept der Caritaswohngemeinschaft Wege
- 7.1. Zielgruppe, Aufnahmeverfahren und Aufnahmekriterien
- 7.2. Leistungsangebot
- 7.3. Ausstattung
- 7.3.1. Räumliche Ausstattung
- 7.3.2. Personelle Ausstattung
- 7.4. Zielsetzungen der Wege
- 7.5. Betreuungsgrundsätze
- 7.5.1. Aufnahme und Gestaltung von Beziehungen
- 7.5.2. Entwicklung situationsgerechter Konfliktlösungsmuster
- 7.5.3. Umgang mit finanziellen Mitteln
- 7.5.4. Organisation des Haushalts
- 7.5.5. Arbeitsaufnahme
- 7.5.6. Freizeitgestaltung
- 7.5.7. Selbstwert- und Identitätsfindung
- 7.5.8. Vernetzung mit anderen Betreuungseinrichtungen
- 7.6. Öffentlichkeitsarbeit
- 7.7. Qualitätssicherung und Dokumentation
- 8. Möglichkeiten und Grenzen der Sozialarbeit in betreuten Wohnformen
- 8.1. Der persönliche Bereich
- 8.1.1. Die soziale Stabilisierung
- 8.1.2. Die psychische Stabilisierung
- 8.2. Der gesellschaftliche Bereich
- 8.2.1. Öffentlichkeitsarbeit
- 8.2.2. Vernetzung
- 8.1. Der persönliche Bereich
- 9. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Haftentlassenen im Rahmen betreuter Wohnformen. Ziel ist es, ein umfassendes Bild der Herausforderungen und Erfolgsfaktoren dieses Prozesses zu zeichnen.
- Definitionen und Konzepte von Resozialisierung und Integration
- Herausforderungen für Haftentlassene (soziale und psychische Aspekte)
- Konzept und Praxis der betreuten Wohnformen (am Beispiel der Caritaswohngemeinschaft Wege)
- Möglichkeiten und Grenzen der Sozialarbeit in diesem Kontext
- Analyse der Erfolgsfaktoren für gelungene Integration
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Integration von Haftentlassenen ein und skizziert den Aufbau und die Zielsetzung der Arbeit. Sie betont die Bedeutung betreuter Wohnformen in diesem Kontext und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung der Möglichkeiten und Grenzen.
2. "Resozialisierung" und "Integration" – Definitionen: Dieses Kapitel liefert fundierte Definitionen der Begriffe Resozialisierung und Integration, wobei verschiedene Perspektiven und theoretische Ansätze berücksichtigt werden. Es legt die Grundlage für das Verständnis der zentralen Konzepte der Arbeit und differenziert zwischen den beiden Begriffen.
3. Gelungene soziale Integration?: Dieses Kapitel untersucht den Begriff der "gelungenen sozialen Integration" aus verschiedenen Blickwinkeln. Es analysiert Definitionen verschiedener Institutionen (Bundesministerium für Justiz, Verein Neustart, Caritaswohngemeinschaft Wege), präsentiert ein Beispiel für gelungene Integration und berücksichtigt die Perspektive der Betroffenen. Es etabliert somit ein differenziertes Verständnis von Integration, das über abstrakte Definitionen hinausgeht.
4. Strafe und Strafvollzug: Dieses Kapitel beleuchtet den Sinn der Strafe aus verschiedenen Gerechtigkeitstheorien und betrachtet die negativen Aspekte des Strafvollzugs. Es diskutiert das Strafvollzugsgesetz und alternative Strafformen wie Diversion und bedingte Entlassungen. Es bildet somit den juristischen und gesellschaftlichen Rahmen für die weitere Analyse der Situation von Haftentlassenen.
5. Situation von Häftlingen: Dieses Kapitel beschreibt die Situation von Häftlingen während der Haft, fokussiert auf die Entmündigung, Deprivationen (Freiheitsverlust, Verlust materieller und immaterieller Güter, Verlust der Privatsphäre etc.) und das Gefängnis als totale Institution. Die Entlassungssituation wird als kritischer Übergangspunkt herausgestellt.
6. Situation von Haftentlassenen: Das Kapitel analysiert die soziale und psychische Situation von Haftentlassenen. Es beleuchtet die Herausforderungen im Bereich der Ausbildung, der Schulden, der Wohnsituation, der sozialen Kompetenzen und des Aufbaus sozialer Netzwerke. Es betont die komplexen Wechselwirkungen zwischen sozialen und psychischen Faktoren.
7. Die Sozialarbeit mit Haftentlassenen in betreuten Wohnformen – Das Konzept der Caritaswohngemeinschaft Wege: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das Konzept der Caritaswohngemeinschaft "Wege" als Beispiel einer betreuten Wohnform für Haftentlassene. Es analysiert die Zielgruppe, das Aufnahmeverfahren, das Leistungsangebot, die Ausstattung, die Zielsetzungen und die Betreuungsgrundsätze. Es dient als Fallbeispiel für die praktische Umsetzung der Integration.
8. Möglichkeiten und Grenzen der Sozialarbeit in betreuten Wohnformen: Dieses Kapitel diskutiert die Möglichkeiten und Grenzen der Sozialarbeit in betreuten Wohnformen für Haftentlassene, sowohl im persönlichen als auch im gesellschaftlichen Bereich (Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung). Es wertet die Effektivität der Betreuung kritisch aus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Integration von Haftentlassenen in betreuten Wohnformen
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen der Integration von Haftentlassenen in betreuten Wohnformen. Sie analysiert die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren dieses Prozesses und beleuchtet das Konzept der Caritaswohngemeinschaft Wege als Beispiel.
Welche Begriffe werden definiert und wie werden sie unterschieden?
Die Arbeit definiert die Begriffe "Resozialisierung" und "Integration" und differenziert zwischen ihnen. Es werden verschiedene Perspektiven und theoretische Ansätze berücksichtigt.
Wie wird "gelungene soziale Integration" definiert und untersucht?
Der Begriff "gelungene soziale Integration" wird aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert, unter Einbezug von Definitionen verschiedener Institutionen (Bundesministerium für Justiz, Verein Neustart, Caritaswohngemeinschaft Wege), einem Beispiel für gelungene Integration und der Perspektive der Betroffenen selbst.
Welche Aspekte des Strafvollzugs werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet den Sinn der Strafe aus verschiedenen Gerechtigkeitstheorien, die negativen Aspekte des Strafvollzugs, das Strafvollzugsgesetz und alternative Strafformen wie Diversion und bedingte Entlassungen.
Welche Schwierigkeiten erleben Häftlinge während und nach der Haft?
Die Arbeit beschreibt die Situation von Häftlingen während der Haft, einschließlich Entmündigung, Deprivationen (Freiheitsverlust, Verlust materieller und immaterieller Güter, Verlust der Privatsphäre etc.) und das Gefängnis als totale Institution. Die Entlassungssituation wird als kritischer Übergangspunkt betrachtet. Die Herausforderungen für Haftentlassene nach der Haft betreffen die soziale und psychische Dimension, einschließlich Ausbildung, Schulden, Wohnsituation, soziale Kompetenzen und den Aufbau sozialer Netzwerke.
Was ist das Konzept der Caritaswohngemeinschaft Wege?
Die Arbeit beschreibt detailliert das Konzept der Caritaswohngemeinschaft "Wege" als Beispiel einer betreuten Wohnform für Haftentlassene. Es werden die Zielgruppe, das Aufnahmeverfahren, das Leistungsangebot, die Ausstattung, die Zielsetzungen und die Betreuungsgrundsätze analysiert.
Welche Möglichkeiten und Grenzen hat die Sozialarbeit in betreuten Wohnformen?
Die Arbeit diskutiert die Möglichkeiten und Grenzen der Sozialarbeit in betreuten Wohnformen für Haftentlassene, sowohl im persönlichen (soziale und psychische Stabilisierung) als auch im gesellschaftlichen Bereich (Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung).
Welche Erfolgsfaktoren für gelungene Integration werden identifiziert?
Die Arbeit analysiert implizit die Erfolgsfaktoren für gelungene Integration durch die detaillierte Beschreibung der Herausforderungen und der Maßnahmen der Caritaswohngemeinschaft Wege. Die explizite Zusammenfassung der Erfolgsfaktoren findet sich im Fazit der Arbeit.
- Arbeit zitieren
- Franz Xaver Mayr (Autor:in), 2004, Integration von Haftentlassenen. Möglichkeiten und Grenzen im Rahmen betreuter Wohnformen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28372