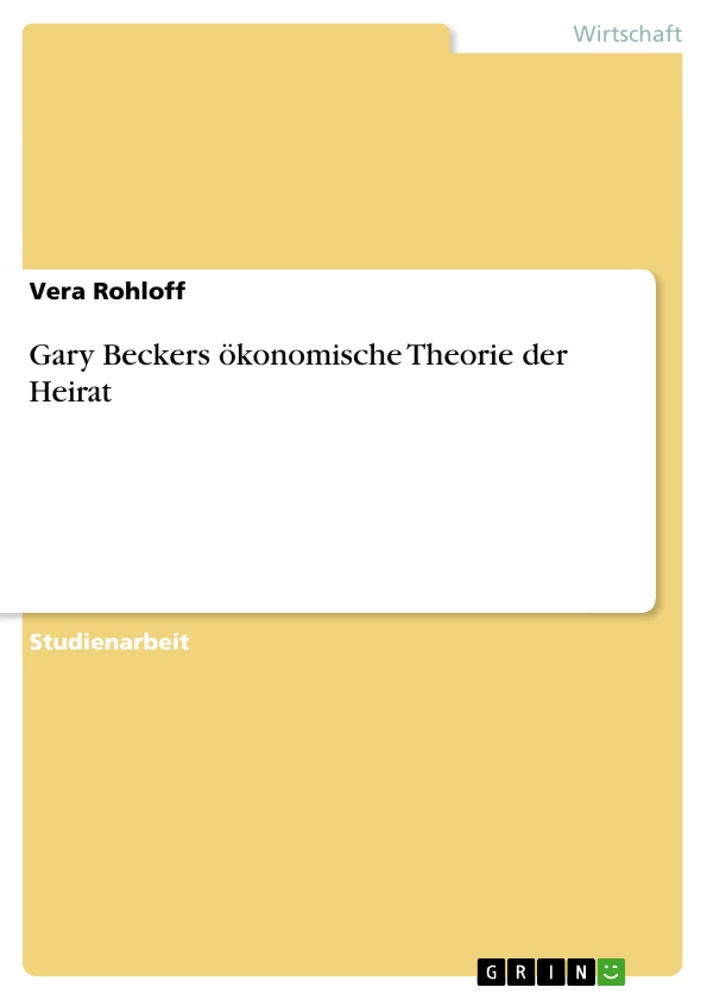Einleitung
Empirische Untersuchungen zeigen, dass die Zahl der Eheschließungen zurückgeht, das Heiratsalter ansteigt, die Kinderzahl sinkt und die Zahl der Scheidungen zunimmt. So kamen im Jahre 1950 in Deutschland auf 1000 Einwohner 11 Eheschließungen, während es im Jahre 2001 nur noch 4,7 Eheschließungen waren. Das Heiratsalter lediger Personen stieg allein in den Jahren 1985 bis 2001 um 5 Jahre an. Die Anzahl nichtehelicher Lebensgemeinschaften belief sich im Jahre 1999 bereits auf 2,05 Mio. Diese Tendenzen sind so stark ausgeprägt, dass
in absehbarer Zeit nicht mit einem Ende der Entwicklung gerechnet werden kann.
Dieser vielzitierte Wandel der Familie ist es, der zunehmend auch das Interesse der Wirtschaftswissenschaften auf sich gezogen hat. Als Begründer der ökonomischen Theorie in diesem Bereich gilt Gary S. Becker, der 1973 seine „Theorie der Heirat“ veröffentlichte und
damit nicht nur Begeisterung auslöste. Die Ausweitung der ökonomischen Betrachtungsweise auf Bereiche, die von Gefühlen, Emotionen und Liebe geprägt sind, verursachte Befürchtungen
auf „Entzauberung“ des familialen Bereichs und brachte Becker die Bezeichnung eines „ökonomischen Imperialisten“ (vgl. Pies (1998) S. 2) ein. Dennoch ist die Ehe der ökonomischen Analyse zugänglich, da knappe Ressourcen – vor allem die Zeit – Verwendung finden, mit denen im Hinblick auf eine Nutzenmaximierung gehaushaltet werden muss. Darauf aufbauend haben sich eine Vielzahl von Wissenschaftlern mit der Haushalts- und Familienökonomik beschäftigt und sie entsprechend den fortschreitenden gesellschaftlichen Veränderungen weiterentwickelt.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht eine ökonomische Betrachtung des Heiratsverhaltens. Es soll zunächst gezeigt werden, dass der Anreiz von Männern und Frauen als rationale Individuen darin besteht, ihren Ehenutzen zu maximieren. Dazu werden der mögliche Ertrag aus Haushaltsproduktion und Konsum den Kosten gegenüber gestellt. Schließlich werden Liebe und Fürsorge in die Betrachtung einbezogen. Erläuterungen zur Wirkungsweise des Heiratsmarktes sowie der spezifischen Partnerzuordnung nach bestimmten Eigenschaften
bilden den Abschluss des ersten Teils.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ökonomische Theorie der Heirat
- Erträge aus Haushaltsproduktion und Konsum
- Kosten der Ehe
- Bedeutung der Liebe
- Heiratsmarkt und Partnerzuordnung
- Der familiale Wandel
- Einfluss der Bildungsexpansion auf die Ehebereitschaft von Frauen
- Einfluss der Frauenerwerbstätigkeit auf den Ehegewinn
- Risiken der traditionellen Rollenverteilung
- Die Ehe als Auslaufmodell?
- Fazit und wirtschaftspolitische Erwägungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der ökonomischen Theorie der Heirat und analysiert die Entscheidungen, die bezüglich des Eingehens, des Erhaltens oder auch des Beendens zwischenmenschlicher Beziehungen gefällt werden. Sie untersucht den Wandel der Familie im Laufe der letzten Jahrzehnte und versucht, wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen zu ziehen.
- Ökonomische Analyse des Heiratsverhaltens
- Nutzenmaximierung in Ehen
- Einfluss der Bildungsexpansion und Frauenerwerbstätigkeit auf die Ehebereitschaft
- Veränderungen der traditionellen Rollenverteilung
- Alternative Lebensformen und die Zukunft der Ehe
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel stellt die zunehmende Veränderung der familialen Strukturen und die steigende Bedeutung der ökonomischen Betrachtungsweise in diesem Bereich dar. Es wird auf Gary S. Beckers „Theorie der Heirat“ und die Diskussion um die „Entzauberung“ des familialen Bereichs eingegangen.
- Ökonomische Theorie der Heirat: Dieses Kapitel erläutert die ökonomischen Grundlagen des Heiratsverhaltens, indem es den Nutzen aus Haushaltsproduktion und Konsum den Kosten der Ehe gegenüberstellt. Es wird die Rolle der Liebe und der Funktionsweise des Heiratsmarktes inklusive der Partnerzuordnung beleuchtet.
- Der familiale Wandel: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der Bildungsexpansion und der steigenden Frauenerwerbstätigkeit auf die Ehebereitschaft von Frauen sowie die Veränderungen der traditionellen Rollenverteilung. Es wird untersucht, ob die heutige Gestaltung von Partnerschaften aus ökonomischer Sicht suboptimal ist.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind die ökonomische Theorie der Heirat, der familiale Wandel, die Nutzenmaximierung in Ehen, die Bedeutung der Liebe, der Heiratsmarkt, die Partnerzuordnung, die Bildungsexpansion, die Frauenerwerbstätigkeit, die Veränderungen der traditionellen Rollenverteilung, alternative Lebensformen und die Zukunft der Ehe.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der ökonomischen Theorie der Heirat von Gary Becker?
Die Theorie betrachtet die Ehe als eine Entscheidung rationaler Individuen, die versuchen, ihren Nutzen aus Haushaltsproduktion und Konsum unter Einsatz knapper Ressourcen (Zeit) zu maximieren.
Wie hat sich das Heiratsverhalten in Deutschland statistisch verändert?
Die Zahl der Eheschließungen sank von 11 pro 1000 Einwohner (1950) auf 4,7 (2001), während das Heiratsalter stieg und alternative Lebensformen zunahmen.
Welchen Einfluss hat die Bildungsexpansion auf die Ehebereitschaft?
Höhere Bildung und steigende Frauenerwerbstätigkeit verändern den potenziellen „Ehegewinn“ und führen oft zu einem Aufschub oder Verzicht auf die Heirat.
Können Liebe und Gefühle ökonomisch analysiert werden?
Ja, Becker bezieht Liebe und Fürsorge in seine Betrachtung ein, was ihm jedoch auch Kritik als „ökonomischer Imperialist“ einbrachte.
Was versteht man unter dem Heiratsmarkt?
Der Heiratsmarkt beschreibt den Prozess der Partnerzuordnung nach bestimmten Eigenschaften, bei dem Individuen versuchen, den bestmöglichen Partner für eine Nutzenmaximierung zu finden.
- Arbeit zitieren
- Vera Rohloff (Autor:in), 2003, Gary Beckers ökonomische Theorie der Heirat, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28375