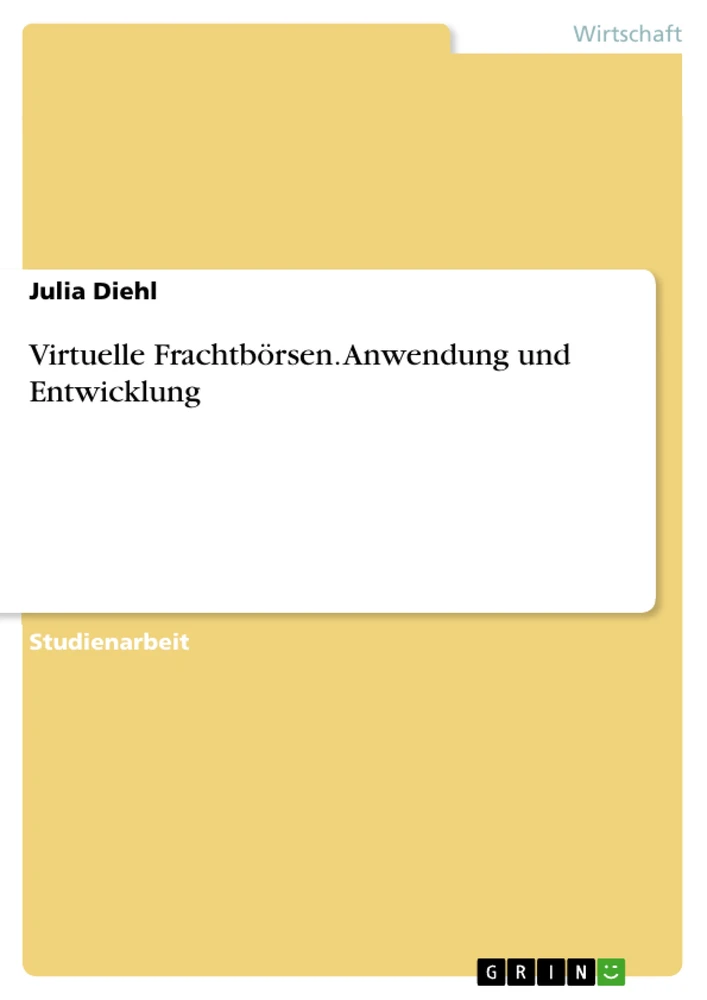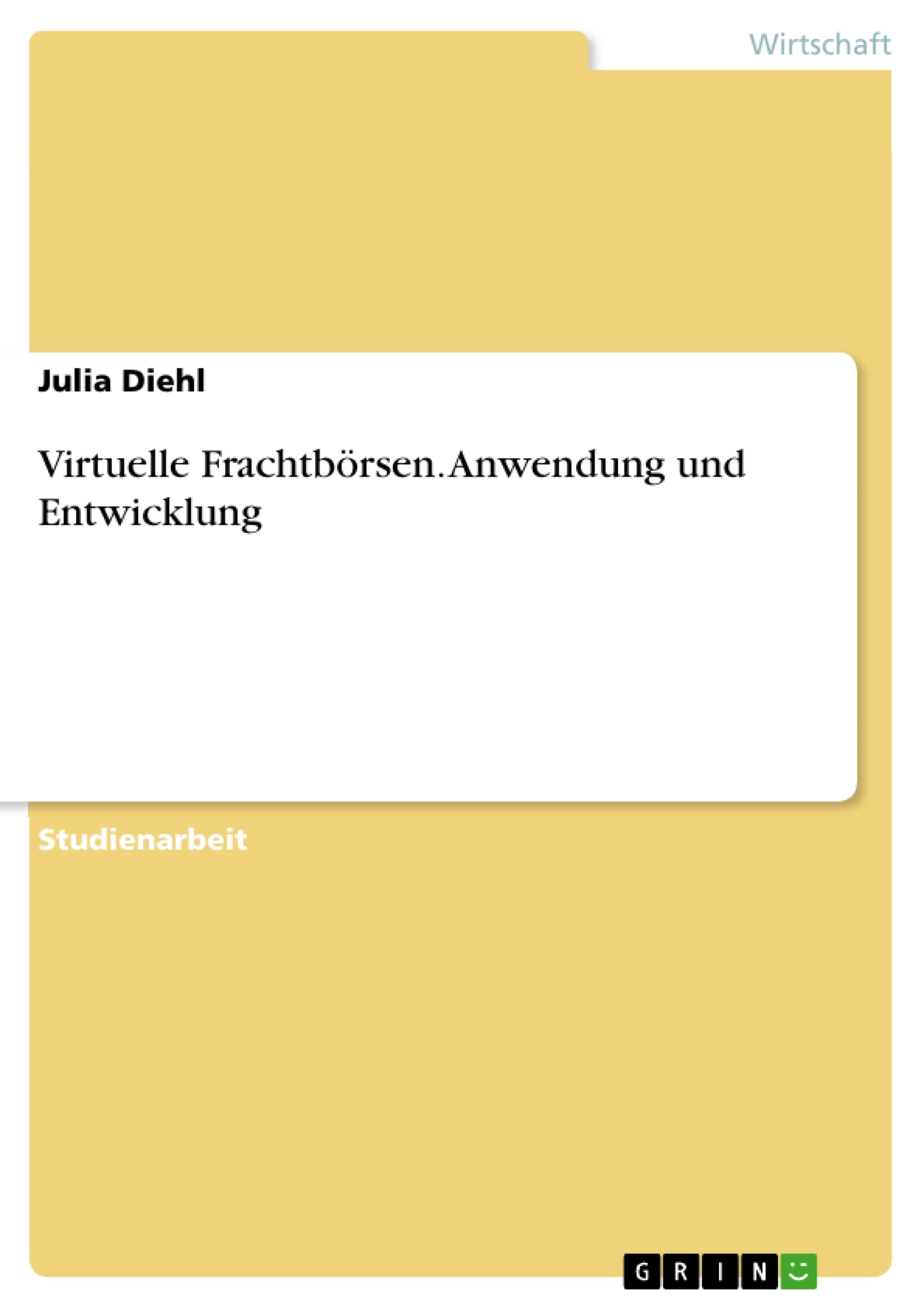Diese Arbeit setzt sich mit der Vielzahl an Anwendungsbereichen und die Entstehung von virtuellen Frachtbörsen auseinander. Hauptsächlich konzentriert sich diese Hausarbeit allerdings mit der Frage des Gütertransportes auf der Straße und der Schiene. Die Schifffahrt und der Luftverkehr werden hier weitestgehend ausgegrenzt. Es soll aufgezeigt werden welche Voraussetzungen bereits existieren und welche Tatsachen wichtig für Anbieter und Nachfrager erscheinen. Aufgrund der Tatsache, dass viele Online-Frachtbörsen nur nach einer Registrierung nutzbar und einsehbar sind, ergeben sich hieraus Einschränkungen für die Ausarbeitung dieser Arbeit. Vorteile zur Nutzung von virtuellen Frachtbörsen und Umsetzung von Möglichkeiten sollen aufgezeigt werden, sowie die Entwicklungsmöglichkeiten in der Zukunft auch im Hinblick auf die Grüne Logistik.
Heutzutage stellt sich für eine Vielzahl von Unternehmen die Frage nach geeigneten Transportmöglichkeiten für ihre Güter oder Frachten, sowie auch die Frage nach einer optimalen Auslastung der Kapazitäten von Frachtraum. Mit zunehmender Globalisierung und Öffnung der Märkte Ost-Europas kommen viele Anbieter hinzu, die qualitative Güter zu niedrigen Preisen auf dem Weltmarkt verkaufen. Der Wettbewerbs- und Preisdruck zwingt Unternehmen zu immer besseren und günstigeren Alternativen, die einen schnellen und vor allem sicheren Transport gewährleisten. Hierfür muss auch meistens kurzfristig eine Fracht oder ein Laderaum organisiert werden, welches nicht immer sehr einfach erscheint.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anwendung
- Was sind Frachtbörsen
- Anbieter von Frachtbörsen
- Nutzer von Frachtbörsen
- Formen von elektronischen Fracht- und Laderaumbörsen
- Preisfindung
- Differenzierung von Frachtvermittlungen
- Unterschiedliche Marktphasen einer virtuellen Frachtbörse
- Informationsphase
- Vereinbarungsphase
- Abwicklungsphase
- Vorteile der Nutzung einer Frachtbörse
- Entwicklung
- Historie der Frachtenbörsen
- Verkehrsträger
- Sicherheit
- Entwicklung der Verkehrsleistung
- Umweltschutz und Zukunftsentwicklung
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht virtuelle Frachtbörsen, beleuchtet deren Anwendung und Entwicklung und analysiert die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen. Der Fokus liegt auf der Funktionsweise, den verschiedenen Akteuren und den Vorteilen dieser Systeme im Gütertransport.
- Funktionsweise virtueller Frachtbörsen
- Marktteilnehmer und deren Rollen
- Preisfindungsmechanismen
- Sicherheitsaspekte im Kontext virtueller Frachtbörsen
- Zukunftsperspektiven und Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der virtuellen Frachtbörsen ein und beschreibt die Relevanz des Themas im Kontext des modernen Güterverkehrs. Sie skizziert die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit, welche darin besteht, die Anwendung und Entwicklung virtueller Frachtbörsen zu untersuchen. Die Einleitung dient als Grundlage für das Verständnis der folgenden Kapitel und stellt den Rahmen für die gesamte Arbeit dar.
Anwendung: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit der Anwendung virtueller Frachtbörsen. Es erklärt zunächst das grundlegende Konzept von Frachtbörsen und beschreibt die verschiedenen Anbieter und Nutzer. Ausführlich werden die verschiedenen Formen elektronischer Fracht- und Laderaumbörsen, die Preisfindungsmechanismen sowie die Differenzierung von Frachtvermittlungen erläutert. Ein wichtiger Aspekt ist die Beschreibung der verschiedenen Marktphasen (Informationsphase, Vereinbarungsphase, Abwicklungsphase) und die damit verbundenen Prozesse. Schließlich werden die Vorteile der Nutzung einer Frachtbörse detailliert dargestellt und analysiert.
Entwicklung: Das Kapitel "Entwicklung" beleuchtet die historische Entwicklung der Frachtenbörsen und deren Einfluss auf den Gütertransport. Es analysiert die Rolle verschiedener Verkehrsträger und deren Bedeutung im Kontext der virtuellen Frachtbörsen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Betrachtung der Sicherheitsaspekte, insbesondere im Hinblick auf den Schutz vor Ladungsdiebstahl. Die Entwicklung der Verkehrsleistung wird im Kontext der virtuellen Frachtbörsen analysiert und es wird ein Ausblick auf den Umweltschutz und die Zukunftsentwicklung gegeben, einschließlich einer kritischen Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und Chancen dieser Technologie.
Schlüsselwörter
Virtuelle Frachtbörsen, Gütertransport, Logistik, elektronischer Handel, Preisfindung, Marktphasen, Sicherheit, Verkehrsträger, Umweltschutz, Zukunftsentwicklung.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Virtuelle Frachtbörsen
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit bietet einen umfassenden Überblick über virtuelle Frachtbörsen. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter. Die Arbeit untersucht die Anwendung und Entwicklung virtueller Frachtbörsen, analysiert die Funktionsweise, die verschiedenen Akteure und die Vorteile dieser Systeme im Gütertransport.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit deckt folgende Themen ab: Funktionsweise virtueller Frachtbörsen, Marktteilnehmer und deren Rollen, Preisfindungsmechanismen, Sicherheitsaspekte, Zukunftsperspektiven und Herausforderungen, Historie der Frachtbörsen, verschiedene Verkehrsträger, Entwicklung der Verkehrsleistung und Umweltschutz im Kontext virtueller Frachtbörsen.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in drei Hauptkapitel gegliedert: Einleitung, Anwendung und Entwicklung. Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Zielsetzung. Das Kapitel "Anwendung" befasst sich mit dem grundlegenden Konzept, Anbietern, Nutzern, Formen elektronischer Frachtbörsen, Preisfindung und den Vorteilen der Nutzung. Das Kapitel "Entwicklung" beleuchtet die historische Entwicklung, die Rolle verschiedener Verkehrsträger, Sicherheitsaspekte, die Entwicklung der Verkehrsleistung und den Umweltschutz.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Hausarbeit enthält detaillierte Zusammenfassungen für jedes Kapitel: Einleitung (Einführung in die Thematik und Zielsetzung), Anwendung (umfassende Darstellung der Funktionsweise und Vorteile virtueller Frachtbörsen), und Entwicklung (historische Entwicklung, Sicherheitsaspekte, Verkehrsträger, Umweltschutz und Zukunftsperspektiven).
Welche Schlüsselwörter beschreibt die Hausarbeit?
Die Schlüsselwörter der Hausarbeit umfassen: Virtuelle Frachtbörsen, Gütertransport, Logistik, elektronischer Handel, Preisfindung, Marktphasen, Sicherheit, Verkehrsträger, Umweltschutz, Zukunftsentwicklung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht virtuelle Frachtbörsen, beleuchtet deren Anwendung und Entwicklung und analysiert die damit verbundenen Herausforderungen und Chancen. Der Fokus liegt auf der Funktionsweise, den verschiedenen Akteuren und den Vorteilen dieser Systeme im Gütertransport.
Welche Arten von Frachtbörsen werden behandelt?
Die Hausarbeit behandelt verschiedene Formen elektronischer Fracht- und Laderaumbörsen und erläutert die Unterschiede zu herkömmlichen Frachtvermittlungen.
Welche Marktphasen werden bei virtuellen Frachtbörsen unterschieden?
Die Hausarbeit unterscheidet die Marktphasen Informationsphase, Vereinbarungsphase und Abwicklungsphase bei virtuellen Frachtbörsen.
Welche Sicherheitsaspekte werden in der Hausarbeit betrachtet?
Die Hausarbeit betrachtet Sicherheitsaspekte im Kontext virtueller Frachtbörsen, insbesondere im Hinblick auf den Schutz vor Ladungsdiebstahl.
Wie sieht die Zukunftsentwicklung der virtuellen Frachtbörsen aus?
Die Hausarbeit bietet einen Ausblick auf die Zukunftsentwicklung der virtuellen Frachtbörsen, einschließlich einer kritischen Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und Chancen dieser Technologie, mit besonderem Fokus auf Umweltschutz.
- Arbeit zitieren
- Julia Diehl (Autor:in), 2013, Virtuelle Frachtbörsen. Anwendung und Entwicklung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283807