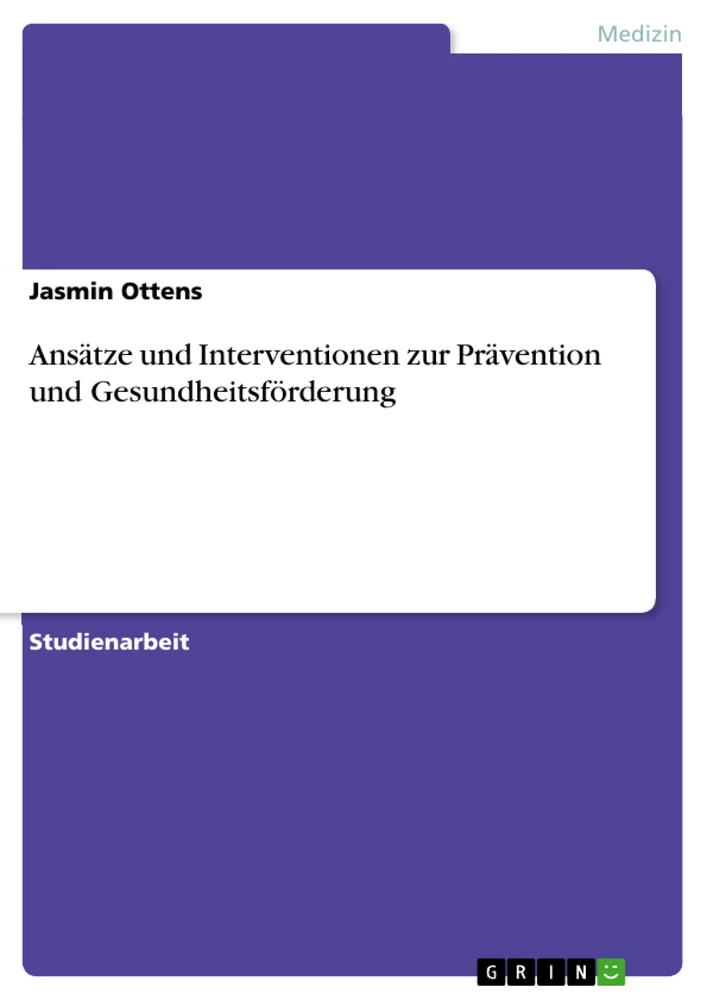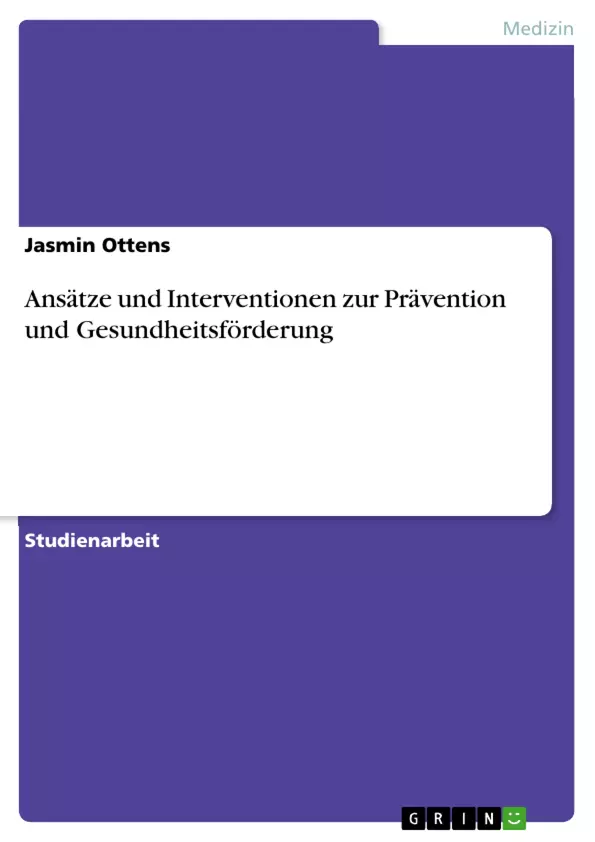Jeder Mensch hat es selbst in der Hand seine Gesundheit zu erhalten und zu fördern. Aus meinen Recherchen wird ersichtlich, dass das Bewusstsein auf diesem Gebiet kontinuierlich erweitert werden muss, denn Gesundheitsförderung und Prävention sind unentbehrliche Grundpfeiler für die Förderung, oder auch Verbesserung der Gesundheit und Langlebigkeit. Sie tragen dazu bei, dass Individuen sich wohler fühlen und ihre Lebensqualität ansteigt. Krankheiten mit hoher Prävalenz, welche nicht ansteckend und häufig von chronischer Art sind, wie beispielsweise Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems oder des Muskel-Skelett-Systems, sowie diverse bösartige Neubildungen etc., werden in ihrer Entwicklung durch bestimmte Risikofaktoren beeinflusst. Durch diese gegebenen Faktoren, die jeder Mensch im Laufe seines Lebens entwickelt bzw. vorfindet, wird es zu einem Zwang diesen Risiken vorzubeugen, sie zu verdrängen und gesundheitsbezogene, ressourcenorientierte Intervention in allen Altersgruppen und Bevölkerungsschichten zu betreiben. Insbesondere der vorherrschende demographische Wandel erfordert eine verstärkte Anstrengung, die gesundheitlichen Potenziale der Bevölkerung bis ins hohe Alter zu erhalten und ihnen die Sicherheit zu geben, ein möglichst langes und selbstbestimmtes Leben führen zu können. Im Laufe dieser Arbeit werde ich mich zuerst mit den Begrifflichkeiten zum Thema „Gesundheitsförderung und Prävention“ beschäftigen. Anschließend setze ich mich mit den Methoden zur Planung und Organisation der Gesundheitsförderung auseinander. Des Weiteren werde ich zentrale Ansätze der Gesundheitsförderung vorstellen. Letzteres werde ich aufzeigen, welche Möglichkeiten es bzgl. der Gesundheitsförderung für ältere Menschen gibt und wie man diese gestaltet und durchführt. Vor allem soll klar verdeutlicht werden, wie wichtig es ist, über die gesamte Lebensspanne gesundheitsbewusst zu leben, wie das realisiert werden kann und inwieweit sich dies gesellschaftlich integrieren lässt. Insbesondere möchte ich aufzeigen, wieso besonders die ältere Altersgruppe auf die Gesundheitsförderung und Prävention zurückgreifen sollte. Natürlich gibt es zur „Gesundheitsförderung und Prävention“ weitaus mehr wissenschaftliche Erkenntnisse, doch ich beschränke mich aus Platzgründen auf das Wichtigste, um in die Thematik einzuführen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begrifflichkeiten
- 2.1. Gesundheit
- 2.1.1 Determinanten der Gesundheit
- 2.2 Gesundheitsförderung
- 2.3 Prävention
- 2.3.1 Formen der Prävention
- 3. Planung und Organisation
- 3.1 Das „PRECEDE“-Planungsmodell nach Green und Kreuter
- 3.2 Klientenzentriertes Planungsmodell nach Ewless und Simnett
- 4. Zentrale Ansätze gesundheitsförderlicher Maßnahmen
- 4.1 Empowermentansatz
- 4.2 Der Settingansatz
- 5. Interventionen zur Gesundheitsförderung in Bezug auf Senioren und ältere Menschen
- 5.1 Das Alter
- 5.2 Ziele und Bereiche der Interventionen in der zweiten Lebenshälfte
- 5.3 Erfolgreiches Altern als gesundheitsfördernde Handlungsstrategie
- 5.4 Ein Praxisbeispiel: Sturzprophylaxe
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung von Gesundheitsförderung und Prävention im Kontext des demografischen Wandels. Sie beleuchtet verschiedene Definitionen von Gesundheit, Planungsmodelle für gesundheitsfördernde Maßnahmen und zentrale Ansätze wie den Empowerment- und Settingansatz. Ein besonderer Fokus liegt auf der Anwendung von Gesundheitsförderung und Prävention bei älteren Menschen.
- Definitionen von Gesundheit, Gesundheitsförderung und Prävention
- Planung und Organisation gesundheitsfördernder Maßnahmen
- Zentrale Ansätze der Gesundheitsförderung (Empowerment, Setting-Ansatz)
- Gesundheitsförderung und Prävention im Alter
- Praxisbeispiel Sturzprophylaxe
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Wichtigkeit von Prävention und Gesundheitsförderung, ausgehend von einem Zitat von Herbert Spencer. Sie verdeutlicht den Bedarf an einem erweiterten Bewusstsein für diese Themen und hebt die Rolle chronischer Krankheiten und Risikofaktoren hervor. Der demografische Wandel und die Notwendigkeit, die Gesundheit im hohen Alter zu erhalten, werden als zentrale Herausforderungen genannt. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Ziele der folgenden Kapitel.
2. Begrifflichkeiten: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von Gesundheit, Gesundheitsförderung und Prävention. Die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung von Prävention und Gesundheitsförderung werden angesprochen, wobei die unterschiedlichen Definitionen in der Literatur hervorgehoben werden. Die Definition der WHO von Gesundheit wird als Ausgangspunkt genommen, jedoch auch kritisch betrachtet. Die Bedeutung von Determinanten der Gesundheit wird eingeleitet, um den komplexen Einflussfaktoren auf die Gesundheit Rechnung zu tragen.
3. Planung und Organisation: Hier werden Methoden zur Planung und Organisation von Gesundheitsförderung vorgestellt. Es werden das „PRECEDE“-Planungsmodell nach Green und Kreuter sowie ein klientenzentriertes Planungsmodell nach Ewless und Simnett erläutert. Die Kapitel beschreiben wahrscheinlich die verschiedenen Schritte und Überlegungen, die bei der Entwicklung und Umsetzung von Gesundheitsförderungsprogrammen notwendig sind, und beleuchten die Unterschiede und Vorteile der jeweiligen Modelle.
4. Zentrale Ansätze gesundheitsförderlicher Maßnahmen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf zentrale Ansätze der Gesundheitsförderung, insbesondere den Empowermentansatz und den Settingansatz. Der Empowermentansatz betont die Stärkung der Selbstwirksamkeit und die Beteiligung der Betroffenen an der Gestaltung ihrer Gesundheit. Der Settingansatz fokussiert auf die Gestaltung der Umwelt, um gesundheitsfördernde Bedingungen zu schaffen. Die Kapitel beschreiben vermutlich die Prinzipien, Stärken und Schwächen beider Ansätze sowie deren praktische Anwendung.
5. Interventionen zur Gesundheitsförderung in Bezug auf Senioren und ältere Menschen: Dieses Kapitel befasst sich speziell mit Interventionen zur Gesundheitsförderung im Alter. Es behandelt verschiedene Ziele und Bereiche von Interventionen in der zweiten Lebenshälfte, betrachtet erfolgreiches Altern als gesundheitsfördernde Strategie und präsentiert ein Praxisbeispiel, vermutlich die Sturzprophylaxe. Der Fokus liegt auf den besonderen Herausforderungen und Möglichkeiten der Gesundheitsförderung für ältere Menschen.
Schlüsselwörter
Gesundheitsförderung, Prävention, Gesundheit, Determinanten der Gesundheit, demografischer Wandel, ältere Menschen, Empowerment, Settingansatz, Planungsmodelle, Interventionen, Sturzprophylaxe.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Gesundheitsförderung und Prävention im Alter
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über Gesundheitsförderung und Prävention, insbesondere im Kontext des demografischen Wandels und im Hinblick auf ältere Menschen. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffe. Der Fokus liegt auf der Definition von Gesundheit, Gesundheitsförderung und Prävention, der Planung und Organisation gesundheitsfördernder Maßnahmen, zentralen Ansätzen wie Empowerment und Setting-Ansatz sowie konkreten Interventionen für Senioren, einschließlich eines Praxisbeispiels zur Sturzprophylaxe.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen im Detail: Definitionen von Gesundheit, Gesundheitsförderung und Prävention; Planungsmodelle für gesundheitsfördernde Maßnahmen (PRECEDE-Modell, klientenzentriertes Modell); zentrale Ansätze der Gesundheitsförderung (Empowerment, Setting-Ansatz); Gesundheitsförderung und Prävention im Alter (Ziele, Bereiche, erfolgreiches Altern); und ein Praxisbeispiel zur Sturzprophylaxe bei Senioren.
Welche Planungsmodelle werden vorgestellt?
Das Dokument beschreibt das „PRECEDE“-Planungsmodell nach Green und Kreuter und ein klientenzentriertes Planungsmodell nach Ewless und Simnett. Es erläutert wahrscheinlich die jeweiligen Schritte, Überlegungen und Unterschiede dieser Modelle bei der Entwicklung und Umsetzung von Gesundheitsförderungsprogrammen.
Welche zentralen Ansätze der Gesundheitsförderung werden diskutiert?
Die zentralen Ansätze, die im Dokument behandelt werden, sind der Empowermentansatz (Stärkung der Selbstwirksamkeit und Beteiligung der Betroffenen) und der Settingansatz (Gestaltung der Umwelt für gesundheitsfördernde Bedingungen). Die Prinzipien, Stärken und Schwächen beider Ansätze und deren praktische Anwendung werden vermutlich beschrieben.
Wie wird das Thema "Gesundheitsförderung im Alter" behandelt?
Der Abschnitt über Gesundheitsförderung im Alter konzentriert sich auf die Ziele und Bereiche von Interventionen in der zweiten Lebenshälfte. Er betrachtet erfolgreiches Altern als gesundheitsfördernde Strategie und präsentiert ein Praxisbeispiel, nämlich die Sturzprophylaxe. Die besonderen Herausforderungen und Möglichkeiten der Gesundheitsförderung für ältere Menschen stehen im Mittelpunkt.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Dokument relevant?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Gesundheitsförderung, Prävention, Gesundheit, Determinanten der Gesundheit, demografischer Wandel, ältere Menschen, Empowerment, Settingansatz, Planungsmodelle, Interventionen und Sturzprophylaxe.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für alle, die sich mit Gesundheitsförderung und Prävention, insbesondere im Kontext des Alterns und des demografischen Wandels, auseinandersetzen. Dies beinhaltet beispielsweise Fachkräfte im Gesundheitswesen, Wissenschaftler, Studenten und Personen, die sich für die Verbesserung der Gesundheit älterer Menschen interessieren.
Wo finde ich weitere Informationen zu den genannten Planungsmodellen und Ansätzen?
Das Dokument nennt die Autoren der vorgestellten Planungsmodelle (Green und Kreuter, Ewless und Simnett). Weitere Informationen zu diesen Modellen und Ansätzen können durch die Suche nach diesen Autoren und den genannten Begriffen in wissenschaftlichen Datenbanken und Fachliteratur gefunden werden.
- Quote paper
- Jasmin Ottens (Author), 2014, Ansätze und Interventionen zur Prävention und Gesundheitsförderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283845