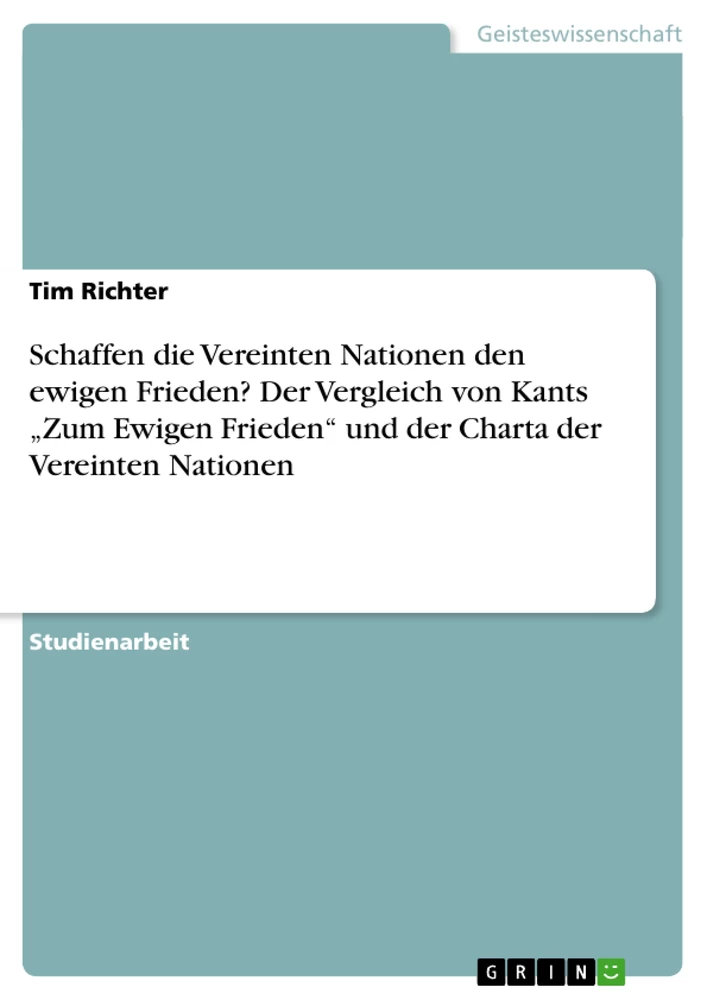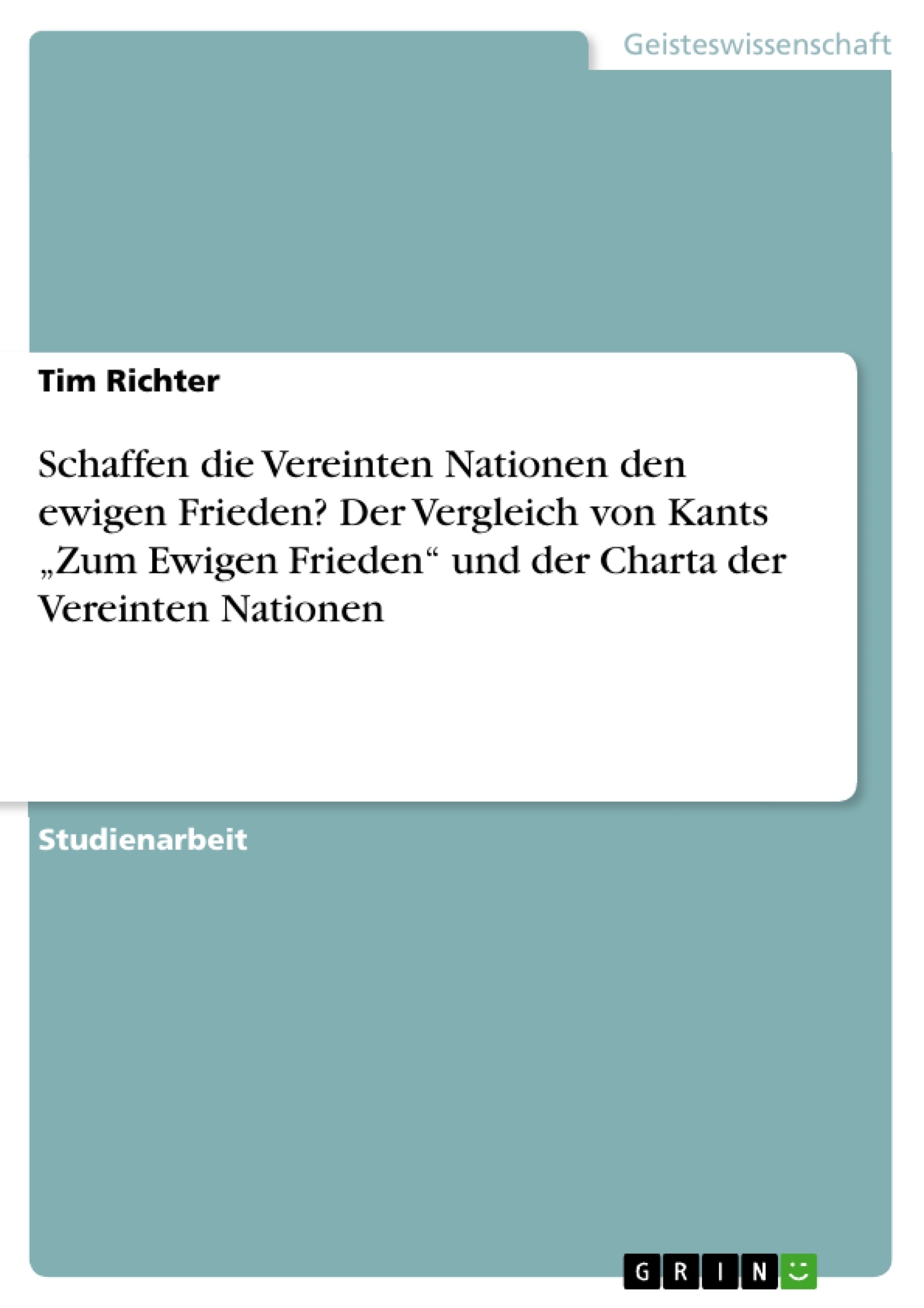Was wäre es für eine Welt, in der alle Kriegsgründe eliminiert und Frieden nicht nur die Ruhe zwischen zwei Stürmen sei, sondern ewiger Zustand ist? Ein Ideal, das erstmals vom französischen Abbé St. Pierre formuliert wurde, angesichts dessen, „daß das Verhältnis der europäischen Mächte untereinander eigentlich ein Kriegszustand ist“ . Und da ein Friedenszustand ein Ordnungszustand sein müsse, entwarf der Abt für die europäischen Staaten fünf Grundartikel. Diese Grundartikel fassen das Ideal eines dauerhaften Friedenszustandes in einem durch Rechtssetzung im Staat und zwischen den Völkern getragenen Bund.
Im Rahmen dieser Debatte erhebt Immanuel Kant seine Stimme und ergänzt das Staatsbürgerrecht und Völkerrecht um ein überstaatliches, kosmopolitisches Recht, damit der Frieden als weltbürgerliches Ideal realisiert ist: „Die Idee einer mit dem natürlichen Rechte des Menschen zusammenstimmenden Konstitution: daß nämlich die dem Gesetz Gehorchenden auch zugleich, vereinigt, gesetzgebend sein sollen, liegt bei allen Staatsformen zugrunde, und das gemeine Wesen, welches ihr gemäß [...] ein platonisches Ideal heißt, ist nicht ein leeres Hirngespinst, sondern die ewige Norm für alle bürgerliche Verfassung überhaupt, und entfernet allen Krieg.“
Könnte eine solche auf Normen aufgebaute Friedensordnung heute nicht durch die Charta der Vereinten Nationen realisiert sein - sowohl in Idee als auch in Struktur? Schaffen die Vereinten Nationen den ewigen Frieden?
Eine Frage, die durch einen Vergleich der Prämissen, Argumente und Konzepte aus der Friedensschrift mit dem Gründungsdokument der Vereinten Nationen, der Charta, beantwortet wird. Nach einer (natürlich die „Schlaglichter“ fokussierenden) historischen Kontextuierung der Friedensschrift wird auf Konzepte und Begrifflichkeiten aus dem Werk Kants eingegangen werden. Da die Friedensschrift in ein Gesamtwerk eingebettet ist und insofern Bezüge zu anderen Texten nicht ausbleiben, werden diejenigen Begriffe und Definitionen vorgestellt, ohne die ein Verständnis der Friedensschrift nur schwerlich zu erlangen ist.
In einem zweiten Schritt werden die Konzepte und Begriffe der UN-Charta vorgestellt, um sie in den rechtlichen Rahmen des Systems der Vereinten Nationen zu setzen und im dritten und letzten Schritt dieser Arbeit mit den weltbürgerrechtlichen, völkerrechtlichen und staatsbürgerlichen Denkweisen aus der Friedensschrift in Verbindung zu setzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Friedensbegriff
- Vorgehen und Struktur der Arbeit
- Historischer Kontext der Friedensschrift
- Kontext und Text der Friedensschrift
- Relevante Begrifflichkeiten
- Widerstandsrecht
- Staat als Rechtsinstitution zweiter Ordnung
- Vorrechtliche Naturzustand
- Staatsaufbau
- Kriegsdefinition und -gründe
- Ein Friedensbund
- Friedensschaffung durch Verrechtlichung
- Drei rechtsrelevante Dimensionen
- ius civitatis
- leges latae
- ius gentium
- leges strictae
- ius cosmopoliticum
- Die Charta der Vereinten Nationen
- Historische Kontextuierung
- Der Text der Charta
- Frieden und Sicherheit
- Menschenrechte & Wirtschaft und Entwicklung
- Schutz der Menschenrechte
- Soziale und wirtschaftliche Sicherung
- Streitschlichtung und Völkerrechtsentwicklung
- Frieden durch Internationalisierung als Rechtsfortschritt
- Die Friedensbegriffe
- Frieden durch Sicherheit
- Souveränitätsgarantie
- Grundsatz der Nichteinmischung
- Auflösung stehender Heere
- Frieden durch Recht
- Föderalismus freier Staaten
- Entwicklung von Völkerrecht
- Schaffung eines Rechtssprechungsorgans
- Rechtskompatibilität
- Setzung von Kriegsrecht
- Friedensvertraglichkeit
- Recht der allgemeinen Hospitalität
- Sicherheit durch Wohlstand
- Idealismus vs. Realismus
- Die Philosophie der Friedensschrift in den Vereinten Nationen
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Frage, ob die Vereinten Nationen den ewigen Frieden schaffen können. Sie vergleicht dazu die Prämissen, Argumente und Konzepte aus Immanuel Kants Friedensschrift „Zum Ewigen Frieden“ mit der Charta der Vereinten Nationen. Die Arbeit analysiert, inwiefern die Charta der Vereinten Nationen die in der Friedensschrift dargelegte Idee eines ewigen Friedens durch Rechtsetzung in drei Dimensionen (ius civitatis, ius gentium, ius cosmopoliticum) verwirklichen kann.
- Der Friedensbegriff bei Kant und in der Charta der Vereinten Nationen
- Die Rolle des Rechts in der Friedensschaffung
- Die drei Dimensionen des Rechts (ius civitatis, ius gentium, ius cosmopoliticum)
- Die historische Entwicklung des Friedensgedankens
- Die Herausforderungen der Friedensschaffung im 21. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Friedensschaffung ein und stellt den Friedensbegriff im Kontext der Arbeit dar. Sie erläutert das Vorgehen und die Struktur der Arbeit sowie den historischen Kontext der Friedensschrift.
Das zweite Kapitel analysiert die Friedensschrift von Immanuel Kant. Es werden relevante Begrifflichkeiten wie Widerstandsrecht, Staat als Rechtsinstitution zweiter Ordnung, Vorrechtliche Naturzustand, Staatsaufbau, Kriegsdefinition und -gründe sowie der Friedensbund vorgestellt. Die Friedensschaffung durch Verrechtlichung und die drei rechtsrelevanten Dimensionen (ius civitatis, ius gentium, ius cosmopoliticum) werden im Detail erläutert.
Das dritte Kapitel widmet sich der Charta der Vereinten Nationen. Es werden die historische Kontextuierung, der Text der Charta und die darin enthaltenen Konzepte zu Frieden und Sicherheit, Menschenrechten sowie Wirtschaft und Entwicklung vorgestellt. Die Streitschlichtung und die Entwicklung des Völkerrechts im Rahmen der Vereinten Nationen werden ebenfalls beleuchtet.
Das vierte Kapitel untersucht die Frage, inwiefern die Internationalisierung durch die Vereinten Nationen einen Rechtsfortschritt darstellt und zum Frieden beitragen kann. Es werden die verschiedenen Friedensbegriffe, die in der Charta der Vereinten Nationen zum Ausdruck kommen, analysiert. Die Kapitel beleuchtet die Themen Sicherheit durch Recht und Sicherheit durch Wohlstand sowie die Herausforderungen des Idealismus und Realismus in der internationalen Politik.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den ewigen Frieden, Immanuel Kant, die Vereinten Nationen, die Charta der Vereinten Nationen, das Völkerrecht, das Staatsbürgerrecht, das Weltbürgerrecht, die Friedensschaffung, die Rechtssetzung, die Internationalisierung, der Idealismus, der Realismus und die Herausforderungen der Friedensschaffung im 21. Jahrhundert.
- Quote paper
- Tim Richter (Author), 2013, Schaffen die Vereinten Nationen den ewigen Frieden? Der Vergleich von Kants „Zum Ewigen Frieden“ und der Charta der Vereinten Nationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283928