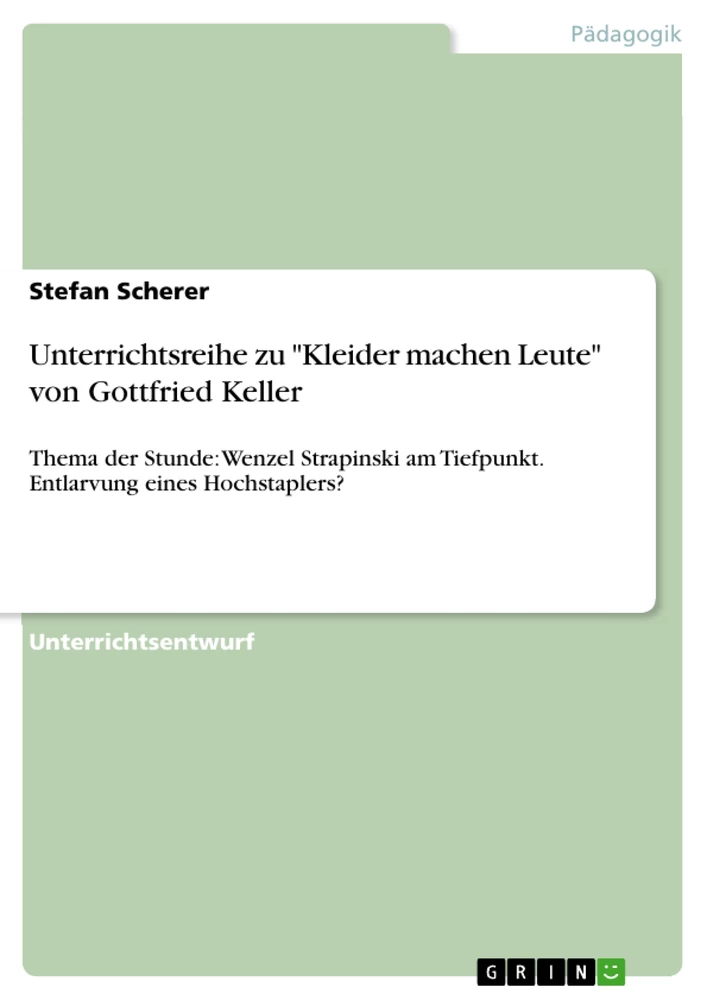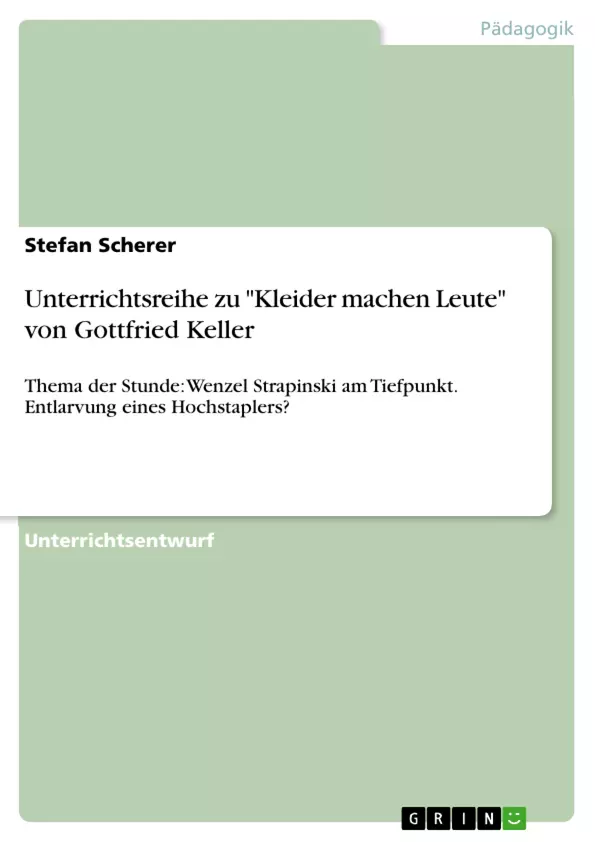Unterrichtsstunde zum Thema "Wenzel Strapinski am Tiefpunkt: Entlarvung eines Hochstaplers?" im Deutschunterricht in der 8. Klasse eines Gymnasiums.
Inhaltsverzeichnis
- Bedingungsfelder
- Lehrplanbezug
- Einbettung in die Reihe
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse
- Lernziele
- Verlaufsplan
- Methodische Analyse
- Geplantes Tafelbild
- Literatur
- Anhang
- Textgrundlage (S. 30 – 37, Schöningh- Textausgabe)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit stellt einen Entwurf zur zweiten Examenslehrprobe im Fach Deutsch dar. Die Unterrichtsreihe widmet sich der Novelle „Kleider machen Leute“ von Gottfried Keller und zielt darauf ab, die Schüler mit der Thematik der sozialen Mobilität und der Bedeutung von Schein und Sein auseinanderzusetzen. Die Stunde, die hier im Detail analysiert wird, fokussiert auf die Entlarvung des Hochstaplers Wenzel Strapinski und die damit verbundenen Folgen für seine soziale Position.
- Soziale Mobilität und Schein vs. Sein
- Charakterisierung der Figuren Wenzel Strapinski und Melcher Böhni
- Analyse der literarischen Mittel und der Erzähltechnik
- Aktualitätsbezug der Novelle
- Entwicklung der Figuren und deren Handlungsmotivation
Zusammenfassung der Kapitel
Die erste Stunde der Reihe startete mit einem kreativen Einstieg, bei dem die Schüler Collagen zur Thematik „Kleider machen Leute“ erstellten. Dies sollte die Motivation der Schüler wecken und gleichzeitig die Gegenwartsbedeutung des Themas verdeutlichen. In der zweiten Stunde wurde die Entstehung des Bildes des Grafen und die Beschreibung der Hauptfigur Wenzel Strapinski im Vordergrund. Die dritte Stunde thematisierte die Verwechslung Wenzels mit einem polnischen Grafen im Gasthaus „Zur Waage“ und schloss mit einer Charakterisierung Wenzels ab. Die vierte Stunde beleuchtete die Integration Wenzels in die Goldacher Gesellschaft und analysierte die wichtigsten Personen der Goldacher Gesellschaft. Die fünfte Stunde widmete sich der Analyse von Melcher Böhni als Gegenspieler Wenzels. Die sechste Stunde untersuchte die drei Fluchtversuche Wenzels, die seine Entwicklung zum Hochstapler forcierten. Die siebte und achte Stunde befassten sich mit der Liebesgeschichte Wenzels und seiner Beziehung zu Nettchen, wobei eine Charakterisierung Nettchens im Zentrum stand. Die neunte Stunde, die hier im Detail analysiert wird, fokussiert auf die Demaskierung Wenzels auf dem Verlobungsfest. Die weiteren Stunden der Reihe sollen sich mit Nettchens Rolle als Retterin, der Vergangenheitsbewältigung Wenzels, der Schuldfrage und der Erzähltechnik der Novelle befassen. Die Reihe kann beispielsweise mit der Arbeit an Vergleichstexten, der Umsetzung ausgewählter Textstellen im szenischen Spiel oder mit dem Vergleich der filmischen Umsetzung von 1940 abgeschlossen werden.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Novelle „Kleider machen Leute“ von Gottfried Keller, die soziale Mobilität, Schein und Sein, die Charakterisierung der Figuren Wenzel Strapinski und Melcher Böhni, die Analyse der literarischen Mittel und der Erzähltechnik, den Aktualitätsbezug der Novelle sowie die Entwicklung der Figuren und deren Handlungsmotivation. Die Arbeit befasst sich mit der Entlarvung des Hochstaplers Wenzel Strapinski und den damit verbundenen Folgen für seine soziale Position.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das zentrale Thema der Novelle „Kleider machen Leute“?
Das zentrale Thema ist das Spannungsverhältnis zwischen Schein und Sein sowie die Frage der sozialen Mobilität durch äußere Erscheinung.
Wer ist Wenzel Strapinski?
Er ist ein armer Schneidergeselle, der aufgrund seiner edlen Kleidung und seines Auftretens fälschlicherweise für einen polnischen Grafen gehalten wird.
Welche Rolle spielt Melcher Böhni in der Erzählung?
Melcher Böhni fungiert als Gegenspieler (Antagonist) von Strapinski, der dessen Hochstapelei durchschaut und schließlich aufdeckt.
Wie reagiert Nettchen auf die Entlarvung Wenzels?
Die Arbeit analysiert Nettchens Rolle als „Retterin“, die trotz der Demaskierung zu Wenzel steht und ihm eine bürgerliche Existenz ermöglicht.
Welche didaktischen Ziele verfolgt die Unterrichtsreihe?
Schüler sollen literarische Analysekompetenzen erwerben und den Aktualitätsbezug der Thematik (z.B. Statussymbole heute) reflektieren.
- Quote paper
- Stefan Scherer (Author), 2009, Unterrichtsreihe zu "Kleider machen Leute" von Gottfried Keller, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/283944