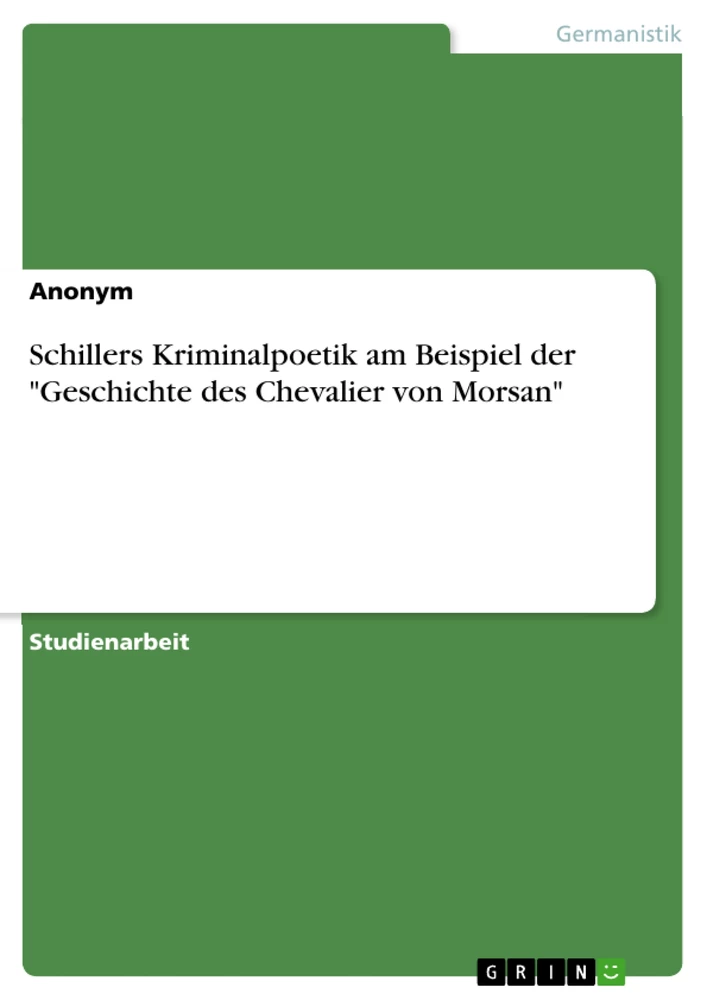Friedrich Schiller verfasste in seiner Zeit als Schriftsteller nicht nur Dramen und Gedichte, sondern pflegte auch das Interesse an Kriminalgeschichten. In seinen Werken spiegelt sich dieses Interesse wieder. Er arbeitete auch als Herausgeber an einer überarbeiteten Ausgabe von wahren Kriminalprozessen, die der französischen Juristen François Gayot de Pitaval aufgeschrieben hatte. Die Ausgabe Schillers enthält dieselben Geschichten, die so verarbeitet wurden, dass auch das einfache Volk sie lesen konnte. In der Ausgabe kommen verschiedene Elemente einer bestimmten Kriminalpoetik Schillers zum Ausdruck, die am Beispiel einer der Geschichte analysiert werden soll.
Um die Elemente der Poetik zu untersuchen, sollen aber zunächst im zweiten Kapitel anhand der Vorrede die einzelnen Merkmale der Poetik gesucht werden, die für Schiller wichtig waren. Anschließend sollen die fünf Klagen, die in der Geschichte des Chevaliers eine Rolle spielen aufgezeigt werden. Im vierten Punkt sollen Fakten der Geschichte zusammengetragen werden, die deutlich machen, dass der Fall nicht eindeutig zu klären ist beziehungsweise war. Schließlich werden narrative Verfahren, die eingesetzt werden, um Spannung zu erzeugen, untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zur Vorrede
- Die fünf Klagen in der Geschichte des Chevalier von Morsan
- Die Unmöglichkeit einer Auflösung des Falls
- Der Einsatz von Narrationsverfahren als Mittel zum Spannungsaufbau
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Kriminalpoetik Friedrich Schillers anhand der „Geschichte des Chevalier von Morsan“ aus der überarbeiteten Ausgabe von François Gayot de Pitavals „Merkwürdige Rechtsfälle“. Die Arbeit untersucht die Elemente der Kriminalpoetik, die Schiller in seiner Vorrede zur Ausgabe darlegt, und analysiert, wie diese Elemente in der Geschichte des Chevalier von Morsan zum Ausdruck kommen.
- Schillers Kriminalpoetik
- Die Rolle der Vorrede in Schillers Kriminalpoetik
- Die fünf Klagen in der Geschichte des Chevalier von Morsan
- Die Unmöglichkeit einer eindeutigen Auflösung des Falls
- Der Einsatz von Narrationsverfahren zur Spannungssteigerung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Bedeutung von Schillers Kriminalpoetik im Kontext seiner literarischen Werke dar. Sie erläutert den Hintergrund der überarbeiteten Pitaval-Ausgabe und die Rolle Schillers als Herausgeber. Die Einleitung legt den Fokus auf die Analyse der „Geschichte des Chevalier von Morsan“ als Beispiel für Schillers Kriminalpoetik.
Das Kapitel „Zur Vorrede“ analysiert die Vorrede zur überarbeiteten Pitaval-Ausgabe und identifiziert die wichtigsten Elemente von Schillers Kriminalpoetik. Es wird deutlich, dass Schiller eine literarische Aufklärung anstrebt, die durch unterhaltende Bücher, die Erkenntnisse verbreiten und den Leser zum Nachdenken anregen, erreicht werden soll. Die Vorrede betont die Bedeutung der Rechtsaufklärung und Moralisierung des Lesers durch eine möglichst objektive Darstellung der Fälle.
Das Kapitel „Die fünf Klagen in der Geschichte des Chevalier von Morsan“ stellt die verschiedenen Klagen dar, die in der Geschichte eine Rolle spielen. Es wird gezeigt, wie die Klagen die Komplexität des Falls und die unterschiedlichen Perspektiven der beteiligten Personen verdeutlichen. Die Analyse der Klagen beleuchtet die Rolle der Justiz und die Schwierigkeiten, die mit der Klärung des Falls verbunden sind.
Das Kapitel „Die Unmöglichkeit einer Auflösung des Falls“ untersucht die Fakten der Geschichte und zeigt, dass der Fall nicht eindeutig zu klären ist. Es wird deutlich, dass die Geschichte mehrere Interpretationen zulässt und die Wahrheit nicht eindeutig feststellbar ist. Die Analyse des Falls verdeutlicht die Grenzen der Rechtsprechung und die Ambivalenz der menschlichen Natur.
Das Kapitel „Der Einsatz von Narrationsverfahren als Mittel zum Spannungsaufbau“ analysiert die narrativen Verfahren, die Schiller in der Geschichte des Chevalier von Morsan einsetzt, um Spannung zu erzeugen. Es wird gezeigt, wie die Aussparung von Informationen und die gezielte Verwendung von Sprache den Leser in die Geschichte einbeziehen und die Spannung erhöhen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Friedrich Schillers Kriminalpoetik, die „Geschichte des Chevalier von Morsan“, die überarbeitete Ausgabe von François Gayot de Pitavals „Merkwürdige Rechtsfälle“, die Vorrede, die fünf Klagen, die Unmöglichkeit einer Auflösung des Falls, die narrativen Verfahren, die Spannungssteigerung, die Rechtsaufklärung und die Moralisierung des Lesers.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Schillers Kriminalpoetik?
Schillers Kriminalpoetik bezeichnet seine Theorie zur literarischen Aufbereitung wahrer Kriminalfälle, um den Leser moralisch zu bilden und rechtlich aufzuklären.
Welches Werk diente Schiller als Grundlage für seine Kriminalgeschichten?
Schiller bearbeitete die Sammlung "Merkwürdige Rechtsfälle" des französischen Juristen François Gayot de Pitaval.
Was ist das Besondere an der "Geschichte des Chevalier von Morsan"?
Die Geschichte dient als Beispiel für einen komplexen Fall, der durch fünf verschiedene Klagen geprägt ist und keine eindeutige Auflösung zulässt.
Welche Ziele verfolgte Schiller mit der Herausgabe dieser Rechtsfälle?
Er wollte durch unterhaltende, aber wahre Geschichten Erkenntnisse verbreiten, den Leser zum Nachdenken anregen und eine Moralisierung durch objektive Darstellung erreichen.
Wie erzeugt Schiller in seinen Kriminalgeschichten Spannung?
Er nutzt gezielte Narrationsverfahren, wie die Aussparung von Informationen und eine spezifische Sprache, um den Leser aktiv in den Erkenntnisprozess einzubeziehen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2012, Schillers Kriminalpoetik am Beispiel der "Geschichte des Chevalier von Morsan", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284026