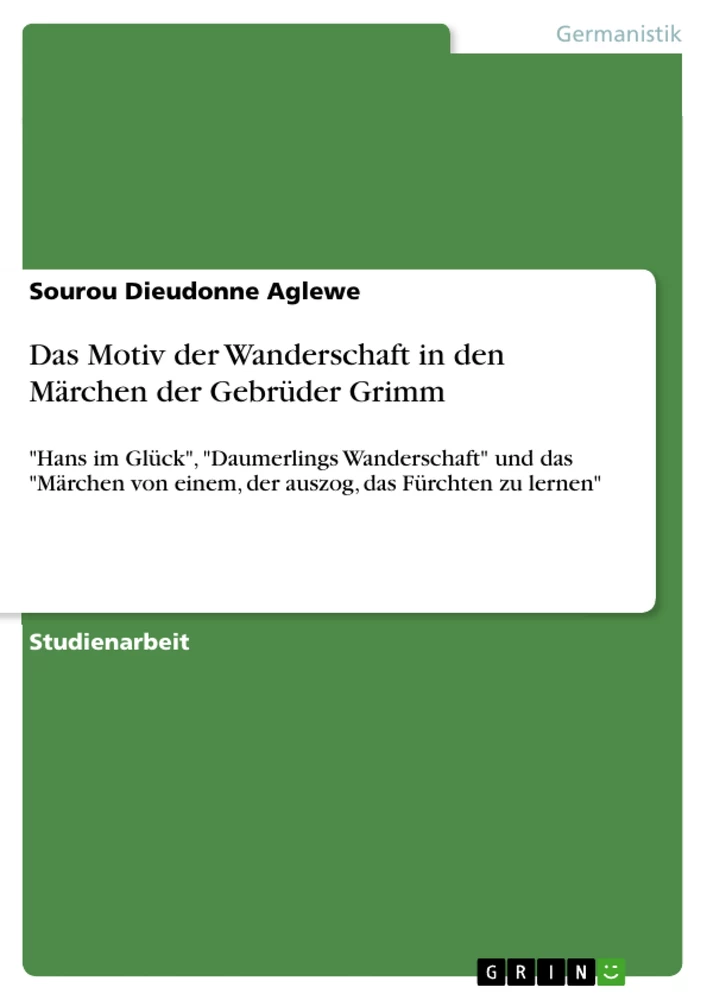Ein von den Grimmschen Märchen häufig aufgegriffenes Thema ist die Wanderschaft. In gewissem Maße sind die Märchen selbst wandernde Kulturgüter. Im romantischen Sinne könnte man sich es so vorstellen, dass die Märchen durch unzählige Länder gewandert sind, bevor sie eines Tages auf dem Schreibtisch der Brüder Grimm ankamen, und diese auf die wunderbare Idee kamen, sie in einem Buch zu fixieren. Doch lebt die märchenhafte Wanderschaft durch die in den Märchen aufgetretenden Figuren weiter, sei es in Form von Glücksuche, „Erfahrung“ oder noch Bewährungs-Wanderschaft.
Schwerpunkt dieser Seminararbeit ist die Auslegung der Problematik der Wanderschaft in romantischen Märchen am Beispiel von drei ausgewählten Grimmschen Märchen, die das Thema ansprechen, nämlich: “Hans im Glück”, ”Daumerlings Wanderschaft” und das “Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen”. Das Wörterbuch von Wahrig definiert die Wanderschaft als das Wandern oder noch die Zeit des Wanderns. Das Verb “wandern” definiert es wie folgt: “zu Fuß reisen, zu Fuß weit umhergehen”. Der Duden-Deutsches Universal-Wörterbuch definiert den Begriff als „Das Wandern, Umherziehen oder –reisen“, oder noch „das Nichtsesshaftsein“. Nach ihm bedeutet „wandern“: “(nicht sesshaft, ohne festen Aufenthaltsort) umherziehen, von Ort zu Ort, zu einem entfernten Ziel ziehen”. Also wer auf Wanderschaft geht, der muss seinen Wohnort verlassen. An dieser Stelle stellt sich u. a. die Frage, warum, wozu und wie geht der Märchenheld auf die Wanderschaft. Welche sprachlichen Signale zur Fortbewegung in den Märchen sind herauszufinden? Die Antwort auf diese Fragen rechtfertigt die vorliegende Seminararbeit. Eine flüchtige Übersicht der Märchen der Brüder Grimm vermittelt uns den Eindruck, dass verschiedene Gründe für eine Wanderschaft der jeweiligen Märchenhelden existieren. Unter allen möglichen Gründen und Endzielen beschränkt sich diese Arbeit auf die Glücksuche, die Er-fahrung und die Bewährung. Die Beschränkung des Textkorpus auf die Grimmsche Sammlung sowie auf die drei oben genannten Märchen liegt, neben dem Zeitfaktor, in der Vielfalt des Materials begründet und erlaubt mir außerdem, mich auf Märchen aus einem bestimmten Zeitraum zu beschränken.
Nach der Inhaltsangabe jedes betreffenden Märchens, werden wir die Funktionsweise der Wanderschaft im jeweiligen Märchen durch eine sprachliche sowie inhaltliche Analyse in Bezug auf den Handlungsverlauf, die Figuren und die aufgegriffenen Themen untersuchen.
Inhaltsverzeichnnis
1. Einleitung
1.1 Inhaltsangabe der zu untersuchenden Korpora
1.1.1 Inhaltsangabe des Märchens “Hans im Glück”
1.1.2 Inhaltsangabe des Märchens „Daumerlings Wanderschaft“
1.1.3 Inhaltsangabe des Märchens „Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen.“
2. Sprachliche Analyse der drei Märchenkorpora mit dem Fokus auf dem Begriff “Wanderschaft”
3. Inhaltliche Analyse der drei Märchenkorpora: Auslegung in Bezug auf den Handlungsverlauf, die Figuren und die angesprochenen Themen
3.1 Glücksuchewanderschaft im “Hans im Glück”
3.2 Erfahrungswanderschaft im :”Daumerlings Wanderschaft”
3.3 Bewährungswanderschaft im Märchen: “Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen.”
4. Schlusswort
5. Anhang
5.1 Märchen Nr.1: Hans im Glück
5.2 Märchen Nr.2: Daumerlings Wanderschaft
5.3 Märchen Nr.3: Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen
6. Literaturverzeichnis
-
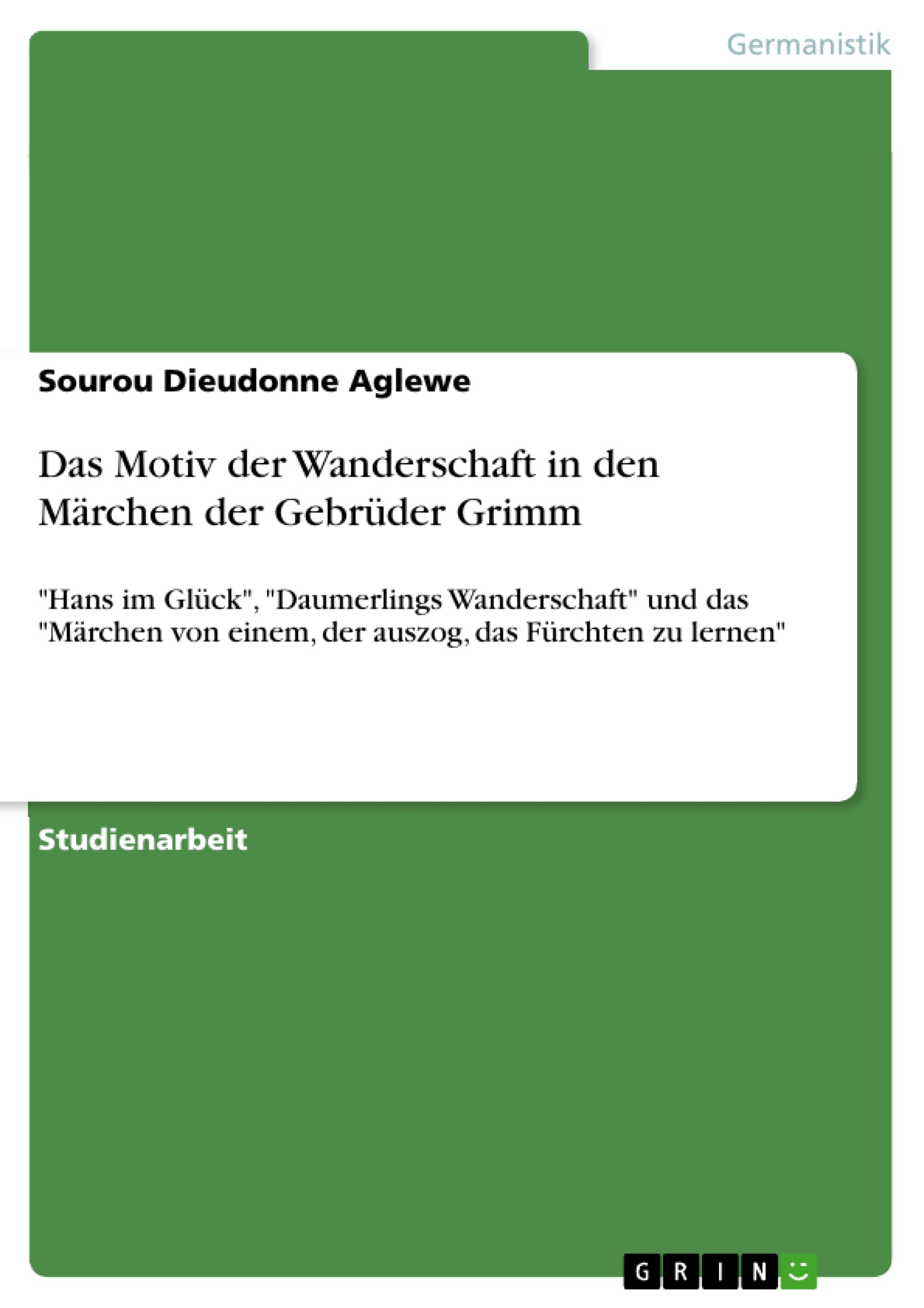
-

-

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X. -

-
Upload your own papers! Earn money and win an iPhone X.