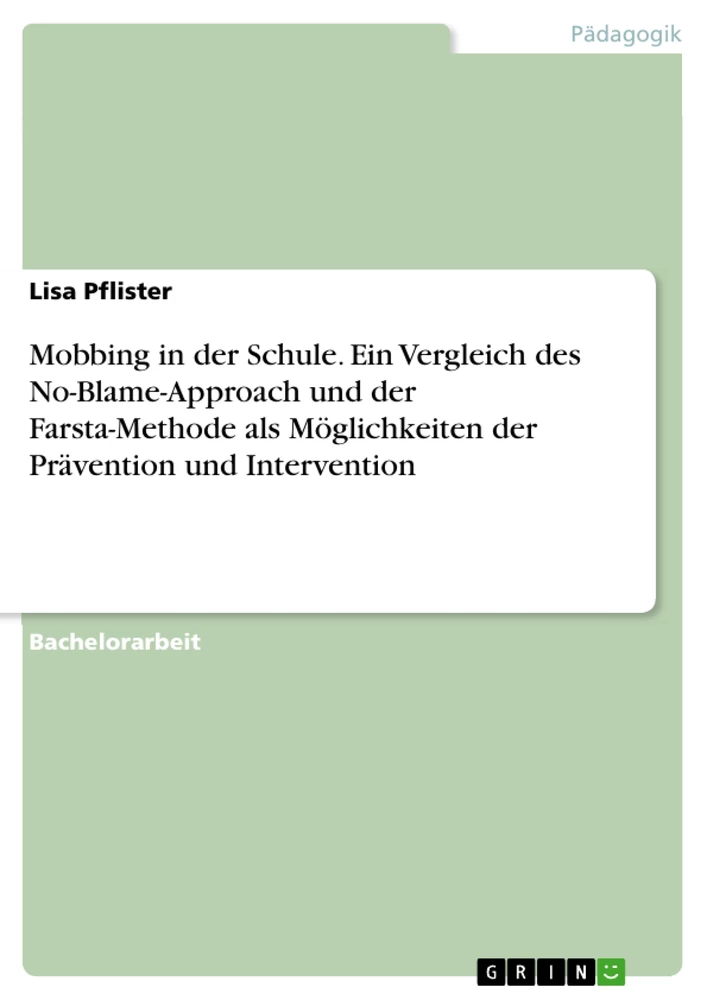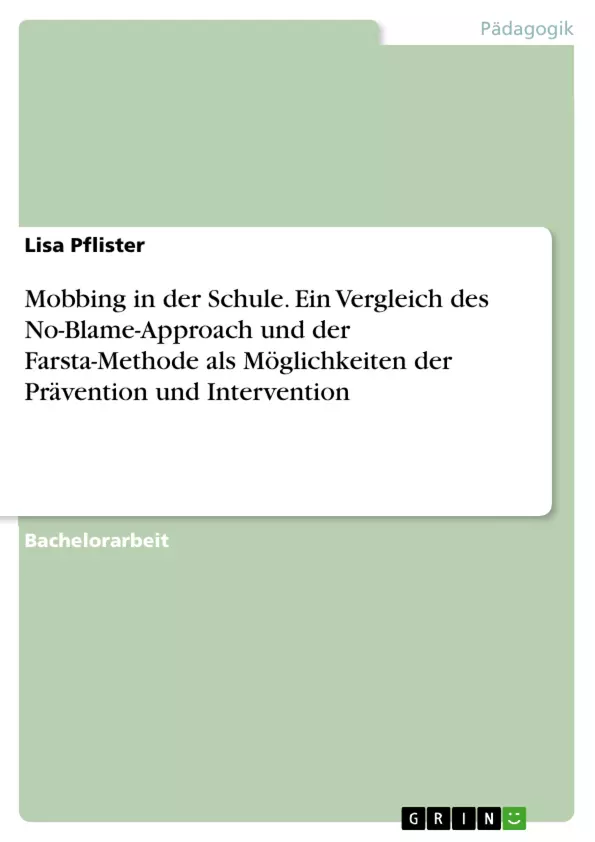Mobbing ist die am häufigsten praktizierte Gewalt an deutschen Schulen, es gehört regelrecht zum alltäglichen Schulleben dazu. Man geht davon aus, dass durchschnittlich ein bis drei Schüler in einer Klasse gemobbt werden. Gravierend sind vor allem die Folgen für alle Beteiligten, deren Leben enorm beeinträchtigt wird.
Gerade die extremen Folgen, wie zum Beispiel Selbstverletzungen oder gar Suizid, sorgen für eine steigende Präsenz des Themas in der Öffentlichkeit. Dennoch kennen sich viele Eltern, Lehrer und Betroffene nur sehr wenig mit diesem schwierigen Thema aus, weshalb sie sich häufig hilflos und überfordert fühlen, wenn sie mit Mobbing konfrontiert werden. Dabei ist es gerade für Lehrer wichtig, ausreichend informiert und handlungsfähig zu sein, um Mobbing in der Schule die Stirn bieten zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Mobbing - ein Überblick
- 2.1 Definition und Abgrenzung zum Konflikt
- 2.2 Die Akteure
- 2.3 Folgen von Mobbing
- 3. Überblick über Präventionsmaßnahmen
- 4. Interventionsmaßnahmen
- 4.1 Der No-Blame-Approach
- 4.2 Die Farsta-Methode
- 4.3 Fazit: Kritische Betrachtung und Vergleich der vorgestellten Programme
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Problem von Mobbing an Schulen, insbesondere in der Sekundarstufe I. Ziel ist es, die Thematik zu definieren, die Akteure zu beleuchten und die Folgen von Mobbing aufzuzeigen. Weiterhin werden Präventions- und Interventionsmaßnahmen vorgestellt und kritisch betrachtet.
- Definition und Abgrenzung von Mobbing zu Konflikten
- Analyse der Rollen von Tätern und Opfern
- Folgen von Mobbing für alle Beteiligten
- Präventionsmaßnahmen auf verschiedenen Ebenen
- Vergleich verschiedener Interventionsmethoden (No-Blame-Approach und Farsta-Methode)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung veranschaulicht die langjährige Problematik von Gewalt unter Jugendlichen anhand historischer Beispiele und betont die zunehmende öffentliche Wahrnehmung von Mobbing als unterschätzte Form von Gewalt an Schulen. Sie hebt die oft unzureichende Reaktion von Lehrkräften hervor und begründet die Notwendigkeit einer tiefergehenden Auseinandersetzung mit dem Thema. Der Fokus der Arbeit liegt auf Mobbing zwischen Schülern der Sekundarstufe I, wobei Mobbing in anderen Schulformen und Altersstufen nur am Rande thematisiert wird.
2. Mobbing - ein Überblick: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Definition von Mobbing, grenzt es von normalen Konflikten ab und beleuchtet die verschiedenen Rollen der beteiligten Akteure. Es werden aktuelle Erkenntnisse zu Opfer- und Tätertypologien vorgestellt. Obwohl verschiedene Arten von Mobbing (zwischen Schülern, Lehrern etc.) existieren, konzentriert sich die Arbeit aus Gründen des Umfangs auf Mobbing zwischen Schülern. Die gravierenden Folgen von Mobbing für Opfer, Täter und das Schulklima werden detailliert dargestellt, um die Dringlichkeit des Themas zu unterstreichen.
3. Überblick über Präventionsmaßnahmen: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung von Mobbing auf Schulebene, Klassenebene und individueller Ebene. Es legt dar, wie ein proaktives Vorgehen Mobbing verhindern und ein positives Schulklima fördern kann. Das Verständnis dieser Maßnahmen bildet die Grundlage für die spätere Beurteilung der Wirksamkeit von Interventionsprogrammen.
4. Interventionsmaßnahmen: Dieses Kapitel stellt zwei weit verbreitete Interventionsprogramme vor: den No-Blame-Approach und die Farsta-Methode. Für jedes Programm wird die Vorgehensweise detailliert dargestellt und erklärt. Ein abschließendes Fazit vergleicht beide Methoden kritisch und bewertet ihre jeweilige Eignung und Wirksamkeit. Die Darstellung der Programme soll Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften eine fundierte Entscheidungsgrundlage für den Umgang mit Mobbingfällen bieten.
Schlüsselwörter
Mobbing, Schule, Sekundarstufe I, Prävention, Intervention, No-Blame-Approach, Farsta-Methode, Täter, Opfer, Konflikt, Gewalt, Schulklima
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Präventions- und Interventionsmaßnahmen bei Mobbing an Schulen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Mobbing an Schulen, insbesondere in der Sekundarstufe I. Sie definiert Mobbing, analysiert die beteiligten Akteure (Täter und Opfer), untersucht die Folgen von Mobbing und stellt verschiedene Präventions- und Interventionsmaßnahmen vor. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Vergleich der Methoden "No-Blame-Approach" und "Farsta-Methode".
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Mobbing - ein Überblick, Überblick über Präventionsmaßnahmen, Interventionsmaßnahmen (inkl. No-Blame-Approach und Farsta-Methode) und Schlussfolgerung. Jedes Kapitel bietet detaillierte Informationen zu den jeweiligen Aspekten des Themas.
Wie wird Mobbing in dieser Arbeit definiert und von Konflikten abgegrenzt?
Die Arbeit liefert eine detaillierte Definition von Mobbing und grenzt es klar von normalen Konflikten ab. Dabei werden die charakteristischen Merkmale von Mobbing hervorgehoben, um eine eindeutige Unterscheidung zu ermöglichen. Diese Definition bildet die Grundlage für die gesamte Analyse.
Welche Folgen von Mobbing werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt die gravierenden Folgen von Mobbing für Opfer, Täter und das gesamte Schulklima. Es werden die Auswirkungen auf die psychische und soziale Entwicklung der Beteiligten ausführlich dargestellt, um die Dringlichkeit des Themas zu unterstreichen.
Welche Präventionsmaßnahmen werden vorgestellt?
Die Arbeit stellt verschiedene Präventionsmaßnahmen auf Schulebene, Klassenebene und individueller Ebene vor. Es wird erläutert, wie proaktive Maßnahmen Mobbing verhindern und ein positives Schulklima fördern können. Diese Maßnahmen bilden die Basis für das Verständnis der später vorgestellten Interventionsprogramme.
Welche Interventionsmethoden werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht zwei weit verbreitete Interventionsmethoden: den No-Blame-Approach und die Farsta-Methode. Für jede Methode wird die Vorgehensweise detailliert erklärt und ihre jeweilige Eignung und Wirksamkeit kritisch bewertet. Dieser Vergleich soll Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften eine fundierte Entscheidungsgrundlage bieten.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit hat zum Ziel, das Problem von Mobbing an Schulen zu definieren, die Akteure zu beleuchten, die Folgen von Mobbing aufzuzeigen und Präventions- sowie Interventionsmaßnahmen vorzustellen und kritisch zu betrachten. Sie soll ein umfassendes Verständnis des Themas vermitteln und Handlungsempfehlungen für den Umgang mit Mobbing geben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Mobbing, Schule, Sekundarstufe I, Prävention, Intervention, No-Blame-Approach, Farsta-Methode, Täter, Opfer, Konflikt, Gewalt, Schulklima.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehrkräfte, pädagogische Fachkräfte, Schulpsychologen, sowie alle, die sich mit dem Thema Mobbing an Schulen auseinandersetzen und nach effektiven Präventions- und Interventionsmaßnahmen suchen.
- Citation du texte
- Lisa Pflister (Auteur), 2013, Mobbing in der Schule. Ein Vergleich des No-Blame-Approach und der Farsta-Methode als Möglichkeiten der Prävention und Intervention, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284104