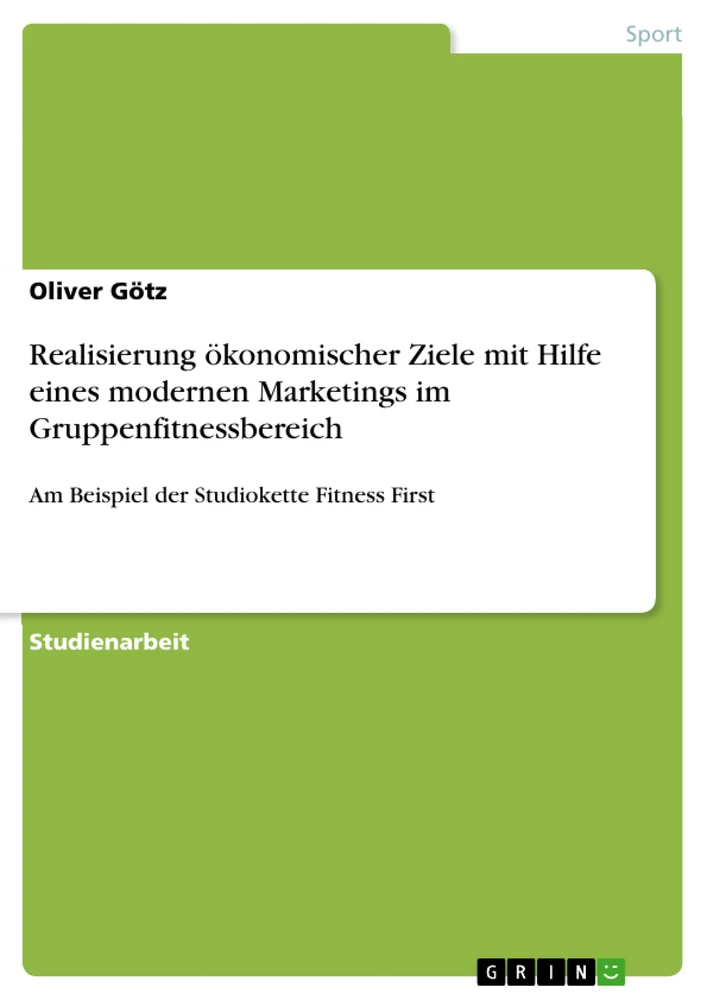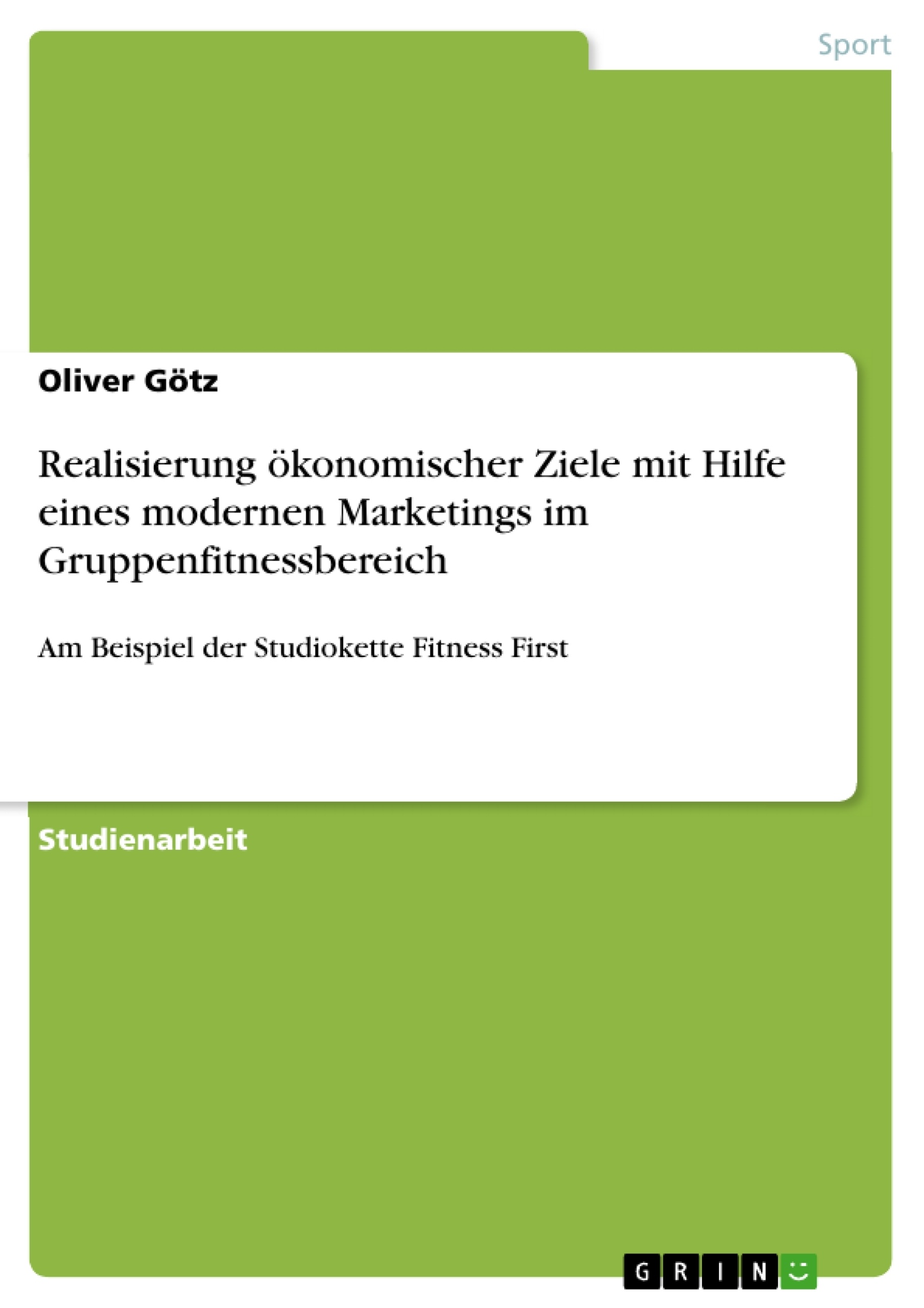Die Zahl der Fitnessanbieter hat sich in den letzten Jahren massiv erhöht. Ebenso der prozentuale Anteil der Gesamtbevölkerung in Deutschland, die in einer Fitnessanlage tätig sind. Eine Branchenstrukturanalyse spiegelt die gestiegene Wettbewerbsintensität wieder sowie den Kampf um Kunden, welcher hauptsächlich auf der Ebene des Preisniveaus ausgetragen wird.
Neben der Grundleistung von Fitnesseinrichtungen gewinnen die Gruppenfitnesskurse vermehrt an Bedeutung. Die dadurch realisierbare Kundenbindung ermöglicht die Erzielung von höheren Deckungsbeiträgen. Darüber hinaus nimmt die Qualität der Dienstleistung einen wichtigen Standpunkt ein. Da lediglich nach bzw. während der Konsumtion eine Beurteilung gefällt werden kann, hat sie somit ausschlaggebenden Einfluss auf die zukünftige Nutzung des Angebots durch den Kunden. In unmittelbarem Zusammenhang damit steht die ökonomische Dimension. Gruppenfitnesskurse besitzen ökonomische Potenziale, die identifziert und umgesetzt werden müssen.
Dazu zählen unter anderem die Erfüllung von Rentabilitätsvorgaben und finanzieller Ziele, die mittels spezifischer Marktfeld- und Wettbewerbsvorteilstrategien erreicht werden. Fitness First, eine der führenden Fitnessketten, bietet aggregiert über 470 Kurse wöchentlich in Köln an. Lediglich 22% aller Veranstaltungen können in die Kategorie Gesundheit bzw. Prävention eingeordnet werden. Da der Gesundheitsmarkt ein stetiges und rasantes Wachstum verzeichnet, bietet es sich an, das Kursangebot an dieses Phänomen anzupassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Einordnung der Gruppenfitnesskurse
- Besonderheiten von Dienstleistungen
- Konzeptionelle Basis
- Methode
- Marktuntersuchungen als Informationsgrundlage
- Branchenstrukturanalyse der Fitnessindustrie nach Porter
- Kursstruktur und -angebot bei Fitness First
- Unternehmerische Strategien hinsichtlich Groupfitnesskurse
- Produkt-Markt-Matrix nach Ansoff
- Realisierbare Wettbewerbsvorteilsstrategien
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Realisierung ökonomischer Ziele im Gruppenfitnessbereich am Beispiel von Fitness First. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie modernes Marketing zur Erreichung von Rentabilitätsvorgaben und finanziellen Zielen beitragen kann. Die Arbeit analysiert die spezifischen Herausforderungen und Chancen im Kontext des wachsenden Wettbewerbs auf dem Fitnessmarkt.
- Analyse der Branchenstruktur der Fitnessindustrie
- Untersuchung der Besonderheiten von Dienstleistungen im Fitnessbereich
- Bewertung des Kursangebots von Fitness First und dessen Potenziale
- Entwicklung von marketingbasierten Strategien zur Steigerung der Rentabilität
- Zusammenhang zwischen Kundenbindung und ökonomischem Erfolg
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt das stetige Wachstum des deutschen Fitnessmarktes und die damit verbundene zunehmende Wettbewerbsintensität. Sie hebt die Bedeutung von Kundenbindung und die besondere Rolle von Gruppenfitnesskursen hervor, die bisher nur marginal in der Forschung betrachtet wurden. Die Arbeit fokussiert sich auf die ökonomischen Potenziale dieser Kurse und deren Realisierung durch effektives Marketing.
Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Untersuchung dar. Es ordnet Gruppenfitnesskurse im Kontext der Fitnessbranche ein, analysiert die Besonderheiten von Dienstleistungen und präsentiert eine konzeptionelle Basis für die weitere Analyse. Es werden wichtige Konzepte wie Kundenbindung und die ökonomische Dimension von Dienstleistungen erläutert.
Marktuntersuchungen als Informationsgrundlage: Dieses Kapitel präsentiert eine Branchenstrukturanalyse der Fitnessindustrie nach Porter, um die Wettbewerbslandschaft zu beleuchten. Es analysiert die Kursstruktur und das Kursangebot von Fitness First in Köln, um die Ausgangslage für die Entwicklung von Marketingstrategien zu verstehen. Die Analyse identifiziert beispielsweise die geringe Anzahl an Präventionskursen im Vergleich zum Gesamtangebot.
Unternehmerische Strategien hinsichtlich Groupfitnesskurse: Dieses Kapitel entwickelt unternehmerische Strategien zur Verbesserung der Rentabilität von Gruppenfitnesskursen bei Fitness First. Es nutzt die Produkt-Markt-Matrix nach Ansoff und identifiziert realisierbare Wettbewerbsvorteilsstrategien, die auf den Erkenntnissen der vorherigen Kapitel aufbauen. Die Strategien sollen zur Verbesserung der Kundenbindung und zur Steigerung der Profitabilität beitragen.
Schlüsselwörter
Gruppenfitnesskurse, Fitnessindustrie, Dienstleistungsmarketing, Wettbewerbsstrategie, Kundenbindung, Rentabilität, Branchenstrukturanalyse, Marktforschung, Fitness First, ökonomische Ziele.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Ökonomische Potenziale von Gruppenfitnesskursen bei Fitness First
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die ökonomischen Potenziale von Gruppenfitnesskursen bei Fitness First und wie modernes Marketing zur Erreichung von Rentabilitätsvorgaben und finanziellen Zielen beitragen kann. Der Fokus liegt auf der Analyse der spezifischen Herausforderungen und Chancen im Kontext des wachsenden Wettbewerbs auf dem Fitnessmarkt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Analyse der Branchenstruktur der Fitnessindustrie, Untersuchung der Besonderheiten von Dienstleistungen im Fitnessbereich, Bewertung des Kursangebots von Fitness First und dessen Potenziale, Entwicklung von marketingbasierten Strategien zur Steigerung der Rentabilität und den Zusammenhang zwischen Kundenbindung und ökonomischem Erfolg. Es werden dabei theoretische Grundlagen gelegt und empirische Marktuntersuchungen durchgeführt.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit nutzt verschiedene Methoden, darunter eine Branchenstrukturanalyse der Fitnessindustrie nach Porter, die Analyse der Kursstruktur und des Angebots von Fitness First, die Anwendung der Produkt-Markt-Matrix nach Ansoff zur Entwicklung von Strategien und die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Kundenbindung und Rentabilität. Die Arbeit basiert auf theoretischen Grundlagen und empirischen Daten.
Welche Ergebnisse werden in der Arbeit präsentiert?
Die Arbeit präsentiert eine Analyse der Wettbewerbslandschaft der Fitnessindustrie, eine Bewertung des Kursangebots von Fitness First, und entwickelt konkrete marketingbasierte Strategien zur Steigerung der Rentabilität von Gruppenfitnesskursen. Es wird der Zusammenhang zwischen Kundenbindung und ökonomischem Erfolg aufgezeigt und Handlungsempfehlungen für Fitness First abgeleitet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind: Gruppenfitnesskurse, Fitnessindustrie, Dienstleistungsmarketing, Wettbewerbsstrategie, Kundenbindung, Rentabilität, Branchenstrukturanalyse, Marktforschung, Fitness First, ökonomische Ziele.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Abschnitt zu den theoretischen Grundlagen, einen Abschnitt zu den Marktuntersuchungen, einen Abschnitt zu den unternehmerischen Strategien und einen Schlussabschnitt mit Fazit und Ausblick. Die Einleitung beschreibt das Wachstum des Fitnessmarktes und die Bedeutung von Kundenbindung. Die theoretischen Grundlagen legen die Basis für die Analyse. Die Marktuntersuchungen liefern Daten zur Wettbewerbslandschaft und zum Kursangebot von Fitness First. Die unternehmerischen Strategien zielen auf die Steigerung der Rentabilität ab.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Wirtschaftswissenschaften, des Sportmanagements und des Marketings, sowie für Unternehmen der Fitnessbranche, die sich mit der Optimierung ihrer Geschäftsmodelle und der Steigerung ihrer Rentabilität beschäftigen. Sie bietet wertvolle Einblicke in die Besonderheiten des Dienstleistungsmarketings im Fitnessbereich und in die Entwicklung von wettbewerbsfähigen Strategien.
- Citar trabajo
- Oliver Götz (Autor), 2013, Realisierung ökonomischer Ziele mit Hilfe eines modernen Marketings im Gruppenfitnessbereich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284129