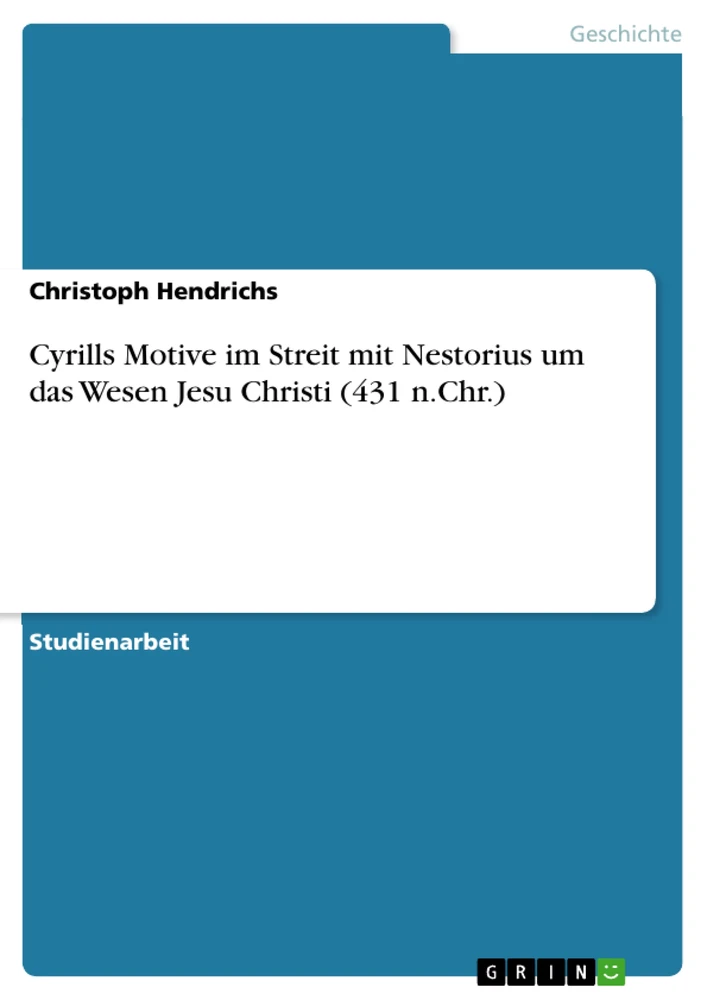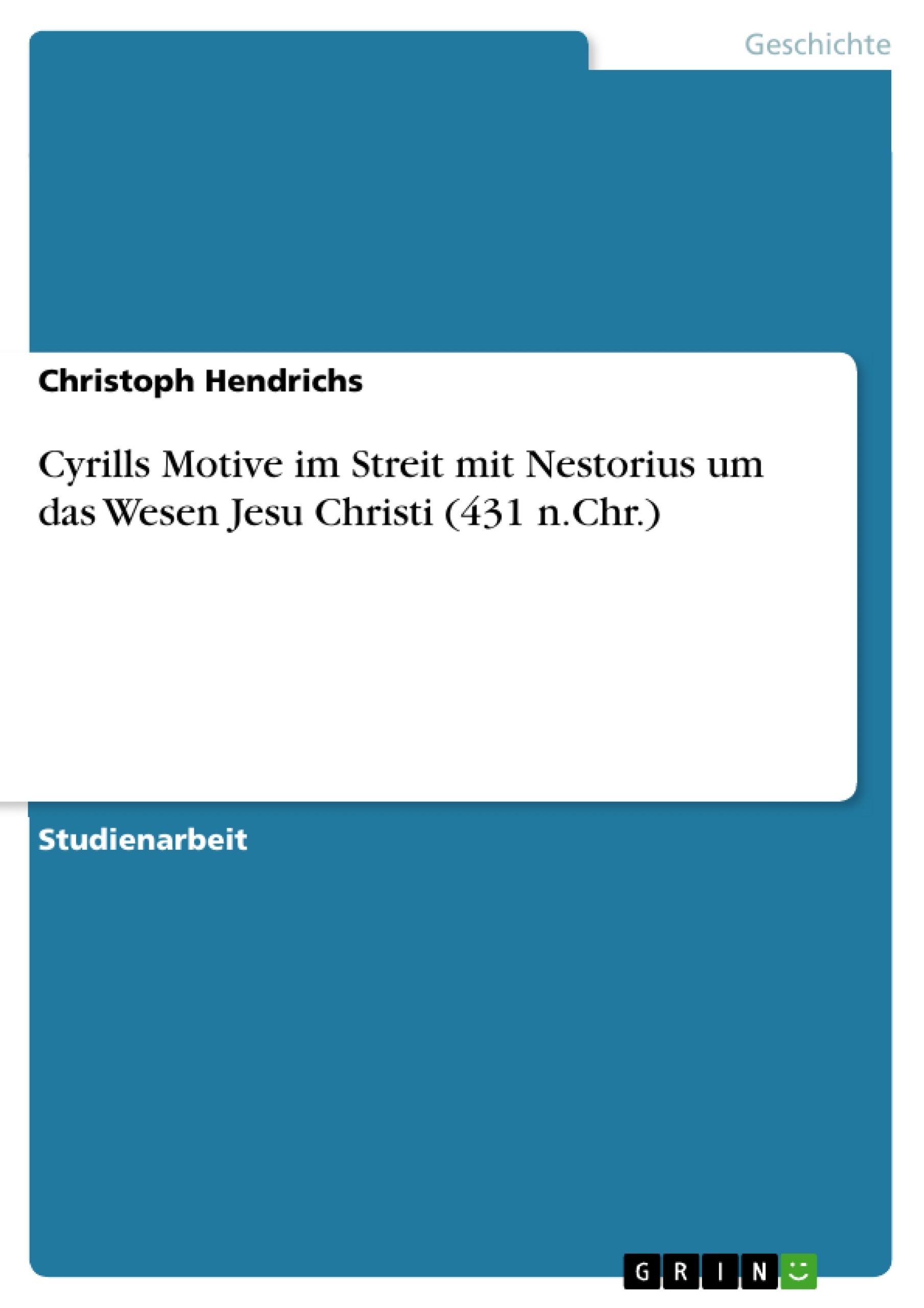Das Konzil von Ephesus aus dem Jahre 431 festigte die Auffassung der katholischen Überlieferung zur Frage nach der Menschwerdung Jesu Christi und beeinflusste die Position der Kirche zu dieser Frage nachhaltig. Ausschlaggebend hierfür waren die Ausführungen des konzilsleitenden Bischofs Cyrill von Alexandrien, der sich bereits im Vorfeld des Konzils mit Nestorius, dem Patriarchen von Konstantinopel, per Briefwechsel darüber stritt, ob die heilige Jungfrau Maria als „theotokos“ (zu deutsch: „Gottesgebärerin“) oder lediglich als „christotokos“ (zu deutsch: „Christusgebärerin“) bezeichnet werden durfte.
Während dieser Auseinandersetzungen agierte Cyrill heftig gegen Nestorius, indem er nicht nur ihm, sondern auch dem Bischof von Rom, anderen hohen Kirchenvertretern und weltlichen Herrschern Briefe schrieb, in denen er um Unterstützung gegen Nestorius bat. Zudem verfasste er fünf Bücher „Gegen die Gotteslästerungen des Nestorius“. Das Konzil, das von Kaiser Theodosius II. einberufen wurde, um diese Streitigkeiten beizulegen, war durch Ungerechtigkeiten gegenüber Nestorius gekennzeichnet. So eröffnete Cyrill das Konzil vorzeitig und noch bevor die Bischöfe Antiochiens eintrafen, die sich wohl auf Nestorius' Seite gestellt hätten. Auf diese Weise erreichte er schließlich eine Mehrheit an Stimmen, die sich für eine Absetzung des Nestorius' einsetzten.
Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse wirft sich die Frage auf, warum Cyrill bei den Streitigkeiten um die Menschwerdung Jesu Christi derart übereilt und ungerecht handelte. In der vorliegenden Arbeit soll diskutiert werden, ob persönliche und kirchenpolitische Motive sein Handeln beeinflusst haben könnten oder ob sein Handeln mit aufrichtigem Eifer für den Glauben zu erklären ist. Dies wird zum einen auf Grundlage des Werkes „liber heraclidis“ von Nestorius geschehen, in dem er Cyrill aus dem Exil heraus unaufrichtige und inhaltsferne Motive bezüglich der Streitigkeiten unterstellte.
Da dieses Werk als Verteidigungsschrift aus Sicht des verurteilten Nestorius verfasst wurde, werden diese Anklagen anhand anderer Quellen auf ihren Gehalt hin geprüft. Zum anderen stützt sich die Arbeit auf den Briefwechsel, der zwischen Nestorius und Cyrill stattfand, und der Aufschluss über die Ansichten beider Parteien gibt. Es wird untersucht, ob aus den Inhalten des Streits Schlüsse gezogen werden können, die das übereifrige Handeln Cyrills erklären und einen Eifer für den Glauben als Motiv nachweisen können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Persönliche und kirchenpolitische Motive
- Behauptung gegen das „nea roma“ Konstantinopel
- Ablenkmanöver gegen eigene Anklagen
- Eifer für den Glauben
- Der Gegensatz zwischen Nestorius und Cyrill
- Cyrills christologische Theologie und sein Heilsverständnis
- Der Gegensatz der alexandrinischen und der antiochenischen Schule
- Cyrills christozentrisches Heilsverständnis
- Schluss
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Motive von Cyrill von Alexandrien im Streit mit Nestorius um das Wesen Jesu Christi. Sie hinterfragt, ob persönliche und kirchenpolitische Interessen oder aufrichtiger Eifer für den Glauben Cyrills Handeln im Vorfeld und während des Konzils von Ephesus beeinflussten. Die Analyse basiert auf dem Briefwechsel zwischen Cyrill und Nestorius sowie auf Nestorius' Schrift „Liber Heraclidis“, welche Cyrills Motive in Frage stellt.
- Analyse der kirchenpolitischen Machtstrukturen zwischen Alexandria und Konstantinopel
- Bewertung der Anschuldigungen Nestorius' gegen Cyrill bezüglich persönlicher Motive
- Untersuchung von Cyrills christologischer Theologie und deren Rolle im Streit
- Evaluierung des Einflusses von Cyrills Eifer für den Glauben auf sein Handeln
- Prüfung der Chronologie der Ereignisse um die Objektivität der Vorwürfe zu beurteilen.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Hintergrund des Konflikts zwischen Cyrill von Alexandrien und Nestorius von Konstantinopel um die Bezeichnung Marias als „Theotokos“. Sie umreißt die Bedeutung des Konzils von Ephesus und die kontroversen Methoden Cyrills. Die Arbeit kündigt die Untersuchung persönlicher und kirchenpolitischer Motive sowie des Eifers für den Glauben als mögliche Erklärungen für Cyrills Handeln an. Die Methodik, die auf dem Briefwechsel und Nestorius' „Liber Heraclidis“ basiert, wird ebenfalls erläutert.
Persönliche und kirchenpolitische Motive: Dieses Kapitel untersucht die Hypothese, dass Cyrill aus machtpolitischen Gründen gegen Nestorius vorging, um den Dominanzanspruch Konstantinopels zu brechen. Es diskutiert die lange bestehende Rivalität zwischen Alexandria und Konstantinopel und die Rolle von Cyrills Vorgänger Theophilus in ähnlichen Konflikten. Die These, Cyrill habe den Streit initiiert um Nestorius zu stürzen, wird anhand der Chronologie der Ereignisse widerlegt. Obwohl Cyrill von der schwierigen Lage Nestorius' profitiert haben mag, wird die Behauptung seiner manipulativen Handlungsweise zurückgewiesen.
Eifer für den Glauben: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die christologischen Differenzen zwischen Cyrill und Nestorius. Es erklärt die gegensätzlichen Positionen der alexandrinischen und antiochenischen Schule und beschreibt Cyrills christozentrisches Heilsverständnis. Durch die detaillierte Auslegung der theologischen Argumente wird der Eifer Cyrills für seine Glaubensauffassung beleuchtet, der sein Handeln möglicherweise mitbestimmt hat. Die Zusammenfassung verdeutlicht die Komplexität des theologischen Diskurses und die Bedeutung der verschiedenen Interpretationen des Wesens Christi.
Schlüsselwörter
Cyrill von Alexandrien, Nestorius, Konzil von Ephesus, Theotokos, Christologie, Kirchenpolitik, Alexandria, Konstantinopel, „Liber Heraclidis“, Heilsverständnis, christologische Schulen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Motive Cyrills von Alexandrien im Streit mit Nestorius"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Motive von Cyrill von Alexandrien im Streit mit Nestorius von Konstantinopel um das Wesen Jesu Christi. Sie analysiert, ob persönliche und kirchenpolitische Interessen oder echter Eifer für den Glauben Cyrills Handeln beeinflusst haben.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Analyse basiert auf dem Briefwechsel zwischen Cyrill und Nestorius sowie auf Nestorius' Schrift „Liber Heraclidis“, welche Cyrills Motive in Frage stellt.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die kirchenpolitischen Machtstrukturen zwischen Alexandria und Konstantinopel, bewertet die Anschuldigungen Nestorius' gegen Cyrill, untersucht Cyrills christologische Theologie und deren Rolle im Streit, evaluiert den Einfluss von Cyrills Glauben und prüft die Chronologie der Ereignisse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu persönlichen und kirchenpolitischen Motiven, ein Kapitel zum Eifer für den Glauben, einen Schluss und ein Quellen- und Literaturverzeichnis.
Was wird in der Einleitung beschrieben?
Die Einleitung beschreibt den Hintergrund des Konflikts, die Bedeutung des Konzils von Ephesus und Cyrills kontroverse Methoden. Sie kündigt die Untersuchung der Motive und die verwendete Methodik an.
Was wird im Kapitel "Persönliche und kirchenpolitische Motive" untersucht?
Dieses Kapitel untersucht die Hypothese, dass Cyrill aus machtpolitischen Gründen gegen Nestorius vorging. Es diskutiert die Rivalität zwischen Alexandria und Konstantinopel und widerlegt die These, Cyrill habe den Streit manipulativ initiiert.
Worum geht es im Kapitel "Eifer für den Glauben"?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die christologischen Differenzen zwischen Cyrill und Nestorius. Es erklärt die gegensätzlichen Positionen der alexandrinischen und antiochenischen Schule und beschreibt Cyrills christozentrisches Heilsverständnis.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Cyrill von Alexandrien, Nestorius, Konzil von Ephesus, Theotokos, Christologie, Kirchenpolitik, Alexandria, Konstantinopel, „Liber Heraclidis“, Heilsverständnis und christologische Schulen.
Welche Methode wird angewendet?
Die Methodik basiert auf der Analyse des Briefwechsels zwischen Cyrill und Nestorius und Nestorius' „Liber Heraclidis“. Die Chronologie der Ereignisse wird geprüft, um die Objektivität der Vorwürfe zu beurteilen.
Welche Schlussfolgerung wird gezogen? (Hinweis: Die detaillierte Schlussfolgerung ist nicht in der Zusammenfassung enthalten.)
Die detaillierte Schlussfolgerung wird in der vollständigen Arbeit dargestellt. Die Zusammenfassung deutet jedoch an, dass die Arbeit die komplexen Motive Cyrills von Alexandrien im Streit mit Nestorius untersucht, wobei sowohl kirchenpolitische Aspekte als auch theologische Überzeugungen berücksichtigt werden.
- Arbeit zitieren
- B.Ed. Christoph Hendrichs (Autor:in), 2012, Cyrills Motive im Streit mit Nestorius um das Wesen Jesu Christi (431 n.Chr.), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284181