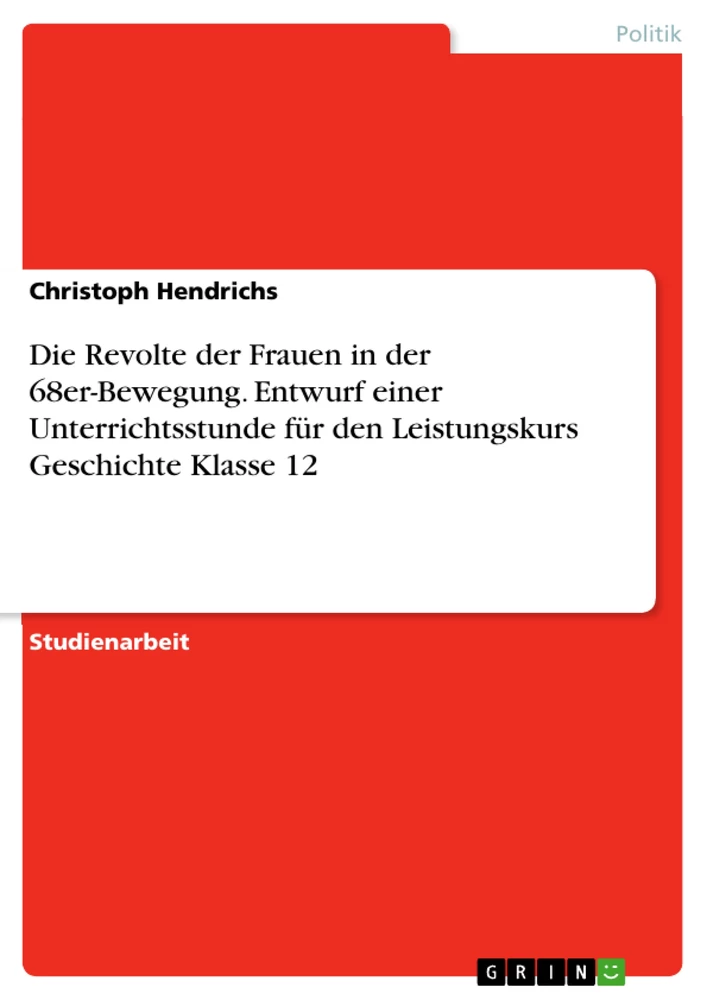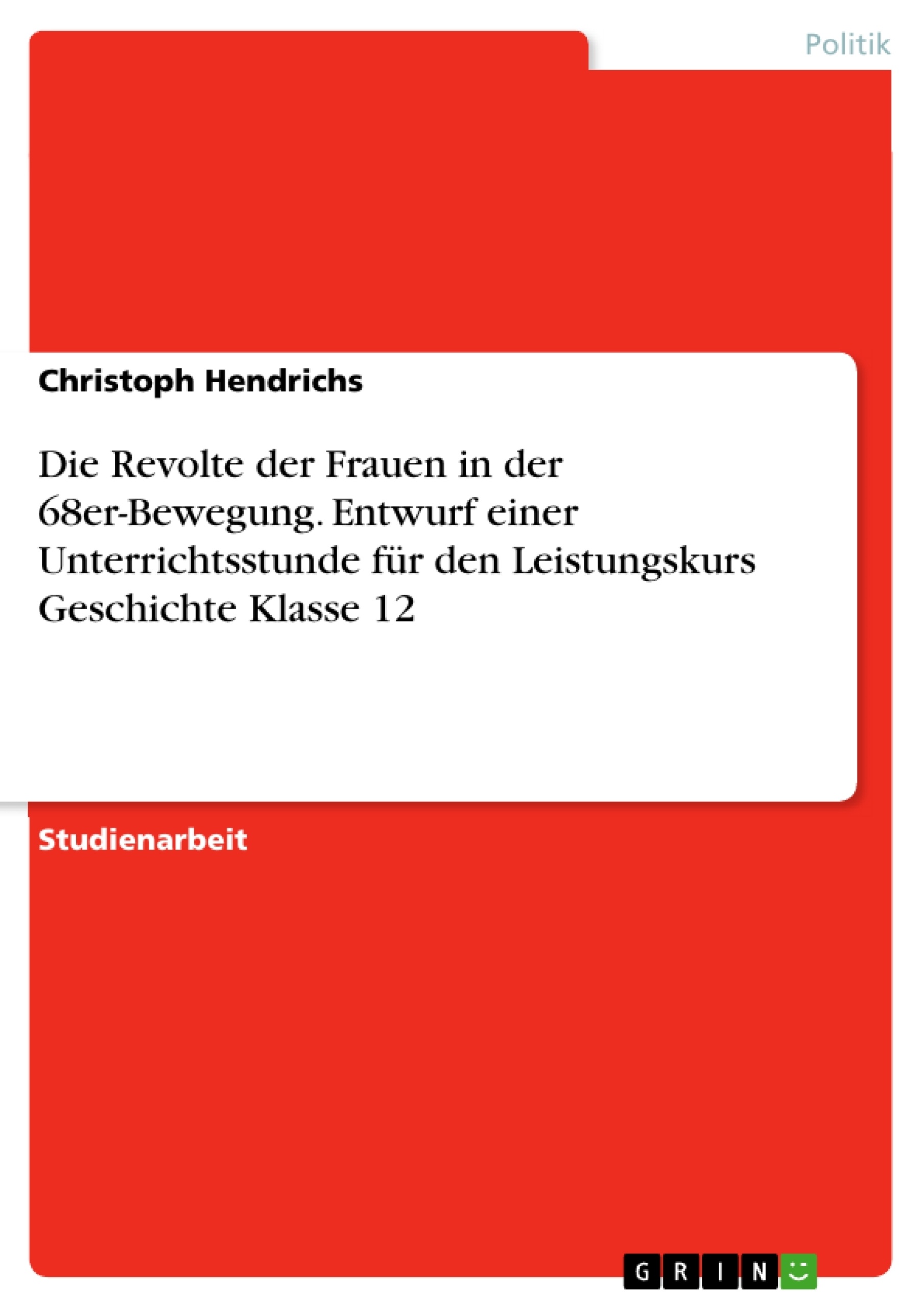Der Unterrichtsentwurf enthält Ideen zu einer Unterrichtsstunde für den Leistungskurs Geschichte, die sich mit dem Thema "Die Revolte der Frauen in der 68er-Bewegung" beschäftigt.
Der Unterrichtsentwurf beschreibt konkret eine mögliche Unterrichtsstunde und außerdem lassen sich im Entwurf angestrebte Arbeitsergebnisse, ein tabellarischer Unterrichtsverlauf, Bemerkungen zu einer fiktiven Lerngruppe sowie didaktische und methodische Reflexionen finden.
Inhaltsverzeichnis
- Arbeitsergebnisse
- Tabellarischer Unterrichtsverlauf
- Bemerkungen zur Lerngruppe
- Didaktische Reflexion
- Methodische Reflexion
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Unterrichtsstunde zielt darauf ab, die Schüler mit der Revolte der Frauen in der 68er-Bewegung vertraut zu machen und sie dazu anzuregen, die Bedeutung der Gleichstellung von Mann und Frau für eine lebendige Demokratie zu reflektieren. Die Stunde soll den Schülern helfen, die unterschiedlichen Positionen innerhalb der 68er-Bewegung zum Thema Frauenrechte zu verstehen und die Bedeutung der Frauenbewegung für die gesellschaftliche Entwicklung zu erkennen.
- Die gesellschaftliche Benachteiligung von Frauen in den 1960er Jahren trotz des Gleichheitsgrundsatzes im Grundgesetz
- Die Abspaltung von Frauen innerhalb der 68er-Bewegung und die Organisation eigener Proteste
- Die unterschiedlichen Ziele und Positionen des Aktionsrats zur Befreiung der Frau und des SDS
- Die Bedeutung der Frauenbewegung für die Entwicklung der Demokratie
- Die Aktualität des Themas Gleichstellung von Mann und Frau
Zusammenfassung der Kapitel
Die Unterrichtsstunde beginnt mit einem Einstieg, der die Schüler mit der Aussage „Wir brauchen die Befreiung der Frauen nicht mehr! Wir sind schon bei der Befreiung des Menschen!“ konfrontiert, die die Sichtweise vieler Männer aus der 68er-Bewegung auf die selbstständige Organisation der Frauen widerspiegelt. Die Schüler sollen diese Aussage deuten und bewerten.
Im Anschluss daran werden die Schüler in zwei Gruppen aufgeteilt, um sich mit zwei Quellen auseinanderzusetzen. Die erste Quelle (M1) stellt die Ziele des Aktionsrats zur Befreiung der Frau dar, während die zweite Quelle (M2) die Position des SDS zum Thema Frauenrechte beleuchtet. Die Schüler sollen die Quellen analysieren und die jeweiligen Positionen der Organisationen zusammenfassen.
In der Ergebnissicherung werden die Ergebnisse der Gruppenarbeit präsentiert und die wesentlichen Anliegen des Aktionsrats zur Befreiung der Frau und des SDS in einem Tafelbild gegenübergestellt.
Im letzten Teil der Stunde werden die Schüler dazu aufgefordert, die Bedeutung der Frauenbewegung für die Demokratie zu reflektieren. Sie sollen sich mit der Frage auseinandersetzen, ob das Thema „Gleichstellung“ ein wichtiger Beitrag zur Demokratie ist.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die 68er-Bewegung, die Revolte der Frauen, die Gleichstellung von Mann und Frau, die Demokratie, der Aktionsrat zur Befreiung der Frau, der SDS, die gesellschaftliche Benachteiligung von Frauen, die politische Agitation und die Bedeutung der Frauenbewegung für die gesellschaftliche Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Worum ging es bei der Revolte der Frauen in der 68er-Bewegung?
Frauen innerhalb der 68er-Bewegung wehrten sich gegen ihre Benachteiligung und spalteten sich ab, um eigene Proteste für Gleichberechtigung zu organisieren.
Was war der Aktionsrat zur Befreiung der Frau?
Eine Organisation, die sich für die Rechte der Frauen einsetzte und sich kritisch gegenüber den männlich dominierten Strukturen des SDS positionierte.
Wie war die rechtliche Situation von Frauen in den 1960ern?
Trotz des Gleichheitsgrundsatzes im Grundgesetz herrschte in der Praxis eine starke gesellschaftliche Benachteiligung der Frauen vor.
Welche Ziele verfolgt der Unterrichtsentwurf?
Schüler sollen die Bedeutung der Gleichstellung für die Demokratie reflektieren und die historischen Positionen von Aktionsrat und SDS analysieren.
Für welche Klassenstufe ist dieser Entwurf geeignet?
Der Entwurf ist speziell für einen Leistungskurs Geschichte der 12. Klasse konzipiert.
- Quote paper
- B.Ed. Christoph Hendrichs (Author), 2014, Die Revolte der Frauen in der 68er-Bewegung. Entwurf einer Unterrichtsstunde für den Leistungskurs Geschichte Klasse 12, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284182