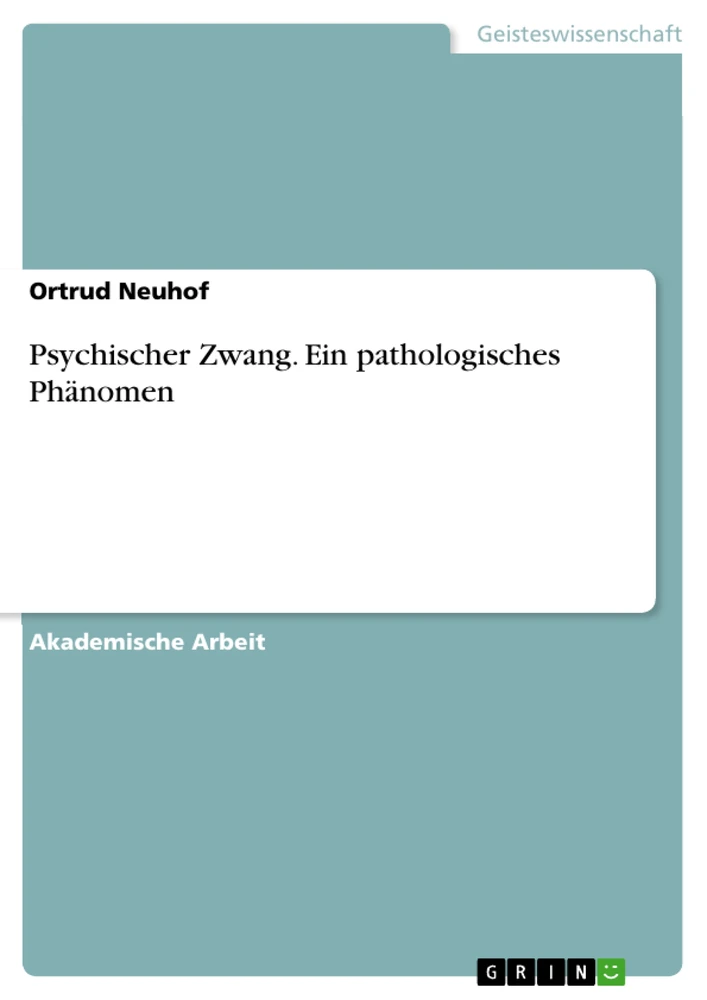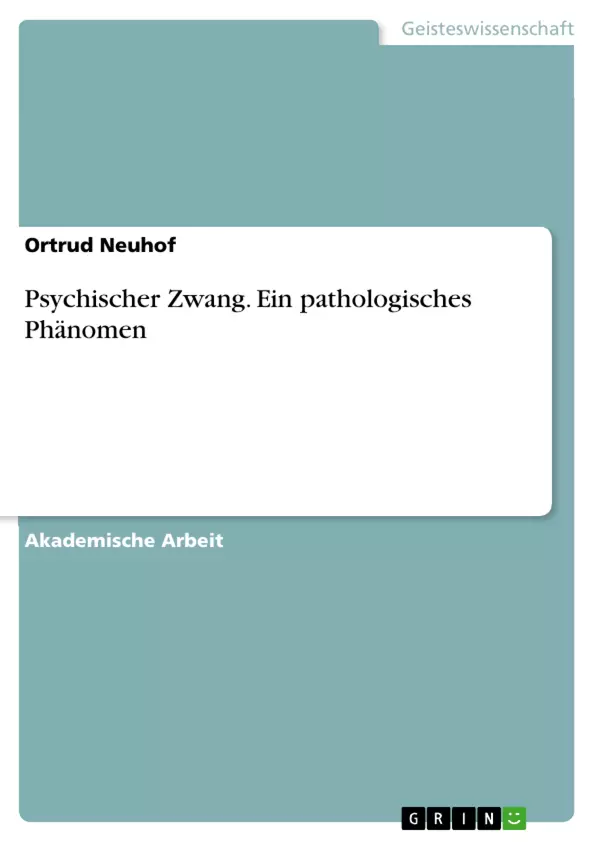Zwangserscheinungen als psychopathologische Phänomene wurden in der psychiatrischen Literatur seit dem 19. Jahrhundert vielfach beschrieben. Knölker setzt den Begriff <ungewöhnliche Faszination> ein, wenn er schildert, in welcher Form diese Krankheitserscheinungen Ärzte, Psychologen und Philosophen beschäftigt hat. Adams (1973) ist „vorwissenschaftlichen“ Beschreibungen von Zwangserscheinungen nachgegangen. So hatte bereits Ignatius von Loyola (1533) einen zwangskranken Zögling beschrieben und mächtige Begierden, „obsessio“, animalischer Natur konstatiert; Richard Flecknoe (1658) in seinen „Enigmaticall characters“ eine Person vorgestellt, die mit dem Nachdenken nicht aufhören kann; Samuel Johnsson, (1759) selbst anankastisch, in seinem Roman „Rasselas“ einen Zwangskranken beschrieben; Immanuel Kant (1824) die Störung als „Grillenkrankheit“ bezeichnet, Jean Pierre Falret (1850), die Bezeichnung „Maladie du doute“ (=Krankheit des Zweifels) für sie geprägt und Novalis von einem „Wahnsinn nach Regeln und mit vollem Bewusstsein“ gesprochen.
Pathologische Zwangsphänomene werden als Zwänge, Zwangsstörungen und Zwangsneurosen bezeichnet. Häufig wird der Begriff Zwangssyndrom oder anankastisches Syndrom eingesetzt und im Zusammenhang mit ich-strukturellen Störungen neuerdings die Bezeichnung <früher Anankasmus>.
Aus dem Inhalt:
- Epidemiologie, Prävalenz und transkultureller Vergleich
- Ätiologiemodelle
- Zwangsspektrumsstörungen und Komorbiditäten
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Epidemiologie, Prävalenz und transkultureller Vergleich
- Inzidenz und Verlauf
- Ätiologieforschung
- Psychosoziale und soziokulturelle Faktoren
- Zwangsspektrumsstörungen und Komorbiditäten
- Ätiologiemodelle
- Neurobiologische Erklärung
- Lerntheoretische Erklärung
- Die neobiologistische Wende in der Psychiatrie und ihre Folgen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text zielt darauf ab, das psychopathologische Phänomen des psychischen Zwangs umfassend zu beleuchten. Dabei werden sowohl epidemiologische Aspekte, der Verlauf der Erkrankung, als auch verschiedene Erklärungsmodelle für die Entstehung von Zwangsstörungen berücksichtigt. Besonderes Augenmerk liegt auf der Rolle von psychosozialen und soziokulturellen Faktoren.
- Epidemiologie und Prävalenz von Zwangsstörungen
- Transkulturelle Vergleiche und der Einfluss kultureller Faktoren auf Zwangssymptome
- Ätiologiemodelle: Neurobiologische, Lerntheoretische und psychoanalytische Ansätze
- Rolle familiärer Faktoren und Erziehungsstile bei der Entstehung von Zwangssymptomen
- Die neobiologistische Wende in der Psychiatrie und ihre Auswirkungen auf die Forschung zu Zwangserkrankungen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung stellt Zwangserscheinungen als psychopathologische Phänomene vor, die in der psychiatrischen Literatur seit dem 19. Jahrhundert beschrieben werden. Der Autor beleuchtet die verschiedenen Bezeichnungen für Zwänge und beleuchtet die Schwierigkeit der Behandlung.
Kapitel 2: Epidemiologie, Prävalenz und transkultureller Vergleich geht auf die Prävalenz von Zwangsstörungen ein, die sich in den letzten Jahrzehnten deutlich erhöht hat. Es werden Studien vorgestellt, die zeigen, dass die Erkrankung nicht mehr als selten betrachtet werden kann. Der Autor analysiert auch die Rolle kultureller Einflüsse auf das Auftreten von Zwangssymptomen.
Kapitel 3: Inzidenz und Verlauf beschreibt die Inzidenz von Zwangserkrankungen und zeigt, dass der Krankheitsbeginn häufig in der Adoleszenz oder im frühen Erwachsenenalter liegt. Es wird der Zusammenhang mit kritischen Lebensereignissen und die Bedeutung des familiären Umfeldes diskutiert.
Kapitel 4: Ätiologieforschung befasst sich mit den verschiedenen Erklärungsmodellen für die Entstehung von Zwangserkrankungen. Es werden das neurobiologische Modell, das lerntheoretische Modell und das psychoanalytische Modell vorgestellt.
Kapitel 4.1: Psychosoziale und soziokulturelle Faktoren analysiert den Einfluss von familiärem Erziehungsstil und familiärem Klima auf die Entstehung von Zwangssymptomen.
Kapitel 4.2: Zwangsspektrumsstörungen und Komorbiditäten befasst sich mit dem Zusammenhang von Zwangserkrankungen mit anderen psychiatrischen Störungen, wie zum Beispiel Essstörungen, körperdysmorpher Störung und Depression.
Kapitel 4.3: Ätiologiemodelle stellt verschiedene Erklärungsmodelle für Zwangsstörungen vor, darunter das neurobiologische Modell, das lerntheoretische Modell und das psychoanalytische Modell.
Kapitel 4.3.1: Neurobiologische Erklärung geht auf die neuroanatomischen und neurochemischen Aspekte der Zwangserkrankung ein.
Kapitel 4.3.2: Lerntheoretische Erklärung präsentiert das Zwei-Faktoren-Modell von Mowrer als Erklärungsmodell für die Entstehung und Aufrechterhaltung von Zwängen.
Kapitel 4.4: Die neobiologistische Wende in der Psychiatrie und ihre Folgen beleuchtet die kritische Diskussion über die Bedeutung neurobiologischer Befunde und die Folgen der neobiologistischen Wende in der Psychiatrie für die Forschung zu Zwangserkrankungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Kernthemen psychischer Zwang, Zwangsstörungen, Epidemiologie, Prävalenz, transkultureller Vergleich, Ätiologie, psychosoziale Faktoren, soziokulturelle Faktoren, familiäre Faktoren, Erziehungsstil, Zwangsspektrumsstörungen, Komorbiditäten, neurobiologische Erklärung, Lerntheoretische Erklärung, psychoanalytische Erklärung, neobiologistische Wende, Psychiatrie und gesellschaftliche Verhältnisse.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter pathologischem Zwang?
Pathologische Zwänge sind psychopathologische Phänomene (Zwangsstörungen), bei denen Betroffene gegen ihren Willen Impulse oder Gedanken erleben, die sie als quälend empfinden.
Welche historischen Beschreibungen von Zwängen gibt es?
Bereits Ignatius von Loyola (1533) beschrieb „obsessio“, Immanuel Kant nannte es „Grillenkrankheit“ und Falret prägte den Begriff „Krankheit des Zweifels“.
Welche Ätiologiemodelle erklären Zwangsstörungen?
Es gibt neurobiologische Erklärungen (Gehirnstruktur), lerntheoretische Modelle (Mowrers Zwei-Faktoren-Modell) und psychoanalytische Ansätze.
Welchen Einfluss hat der Erziehungsstil auf Zwänge?
Die Forschung untersucht, inwiefern ein überbehütender oder extrem leistungsorientierter Erziehungsstil die Entstehung von Zwangssymptomen begünstigen kann.
Was ist die „neobiologistische Wende“ in der Psychiatrie?
Es ist der Trend, psychische Störungen primär auf biologische und genetische Ursachen zurückzuführen, was in der Arbeit kritisch hinterfragt wird.
- Arbeit zitieren
- Ortrud Neuhof (Autor:in), 2004, Psychischer Zwang. Ein pathologisches Phänomen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284255