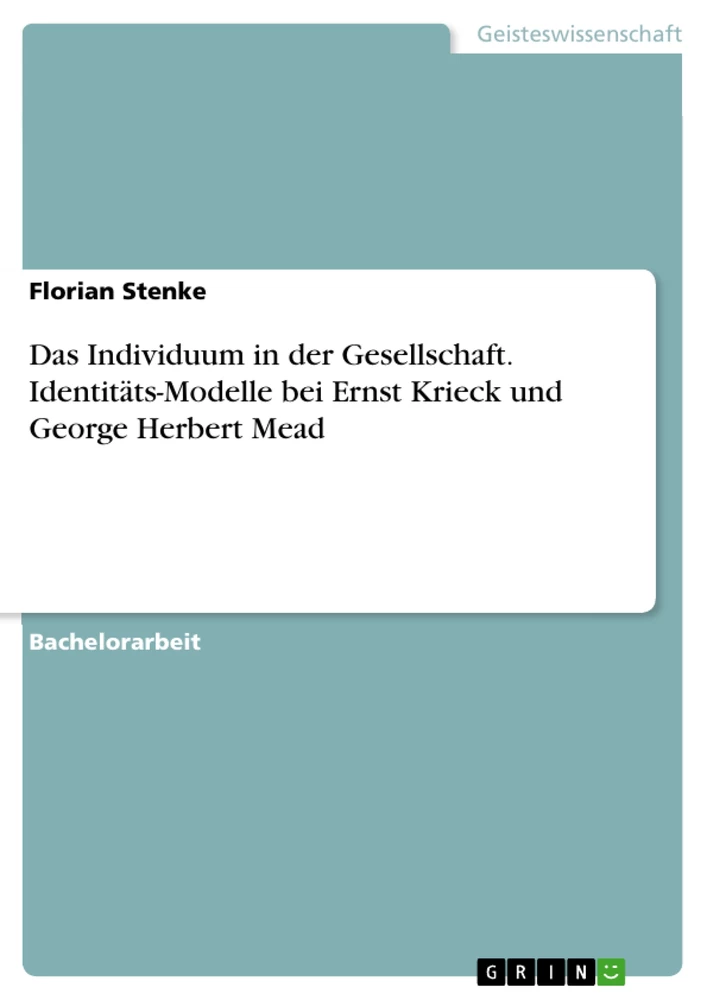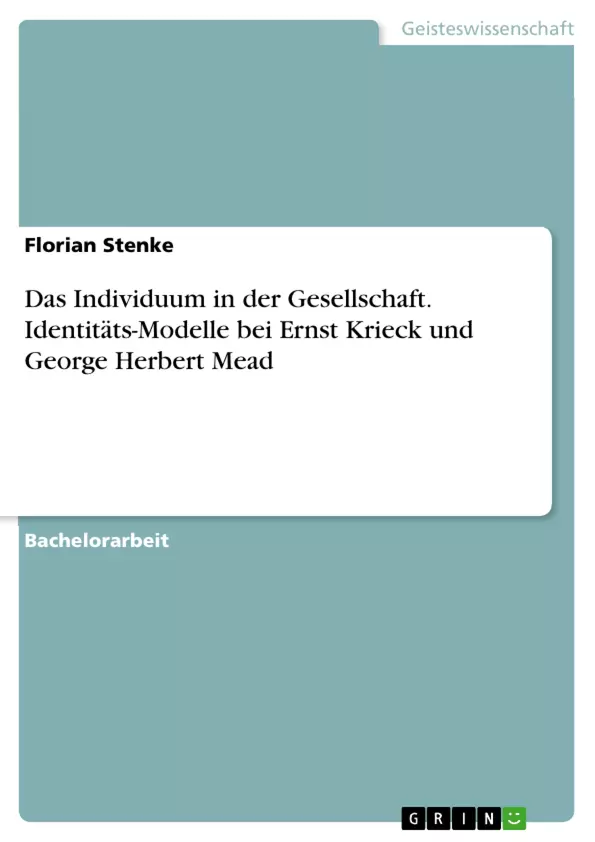Das Erkenntnisziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, die soziologisch wie philosophisch gleichermaßen grundlegende Frage nach dem Verständnis von Individuum und Gesellschaft vor dem Hintergrund der Beschreibung zweier theoretischer Modelle von Identität zu erhellen. Da jede soziologische Beschäftigung mit der menschlichen Identität von einer allgemeinen Analyse des Verhältnisses von Person und Sozialität ausgehen muss, wird der Sozialisationsprozess als Zusammenspiel von individuellen Anlagen und Vergesellschaftung beschrieben, um seine Auswirkungen auf die Identität der Person zu verdeutlichen.
Die ausgewählten Ansätze in George Herbert Meads 'Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus' und Ernst Kriecks 'Philosophie der Erziehung' werden auf ihre Grundannahmen zum Verständnis von Individuum und Gesellschaft und ihres jeweiligen Identitätskonzepts hin analysiert und einander gegenübergestellt. Mit dieser Betrachtung soll "der blinde Fleck" der Soziologie dechiffriert und darauf hingewiesen werden, dass Soziologen bei ihrer theoretischen Arbeit immer auch mit philosophischen Fragen der Begriffsbestimmung konfrontiert sind bzw. ausgesprochen oder unausgesprochen von je spezifischen nichtsoziologischen Prämissen, von bestimmten Menschen- und Weltbildern, ausgehen. Mit dem Anspruch, einen Beitrag zur soziologischen Lesart Kriecks zu leisten, wagt sich die Arbeit auf ein bislang kaum aus soziologischer Perspektive bearbeitetes Feld. Dabei legt sie den Fokus auf die die genuin philosophischen Fragen, mit denen die gewählten Autoren bei ihrer theoretischen Arbeit konfrontiert waren und betont dabei die moralphilosophischen Elemente beider Ansätze.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I.1 Das soziologische Werk Ernst Kriecks
- I.2 Das soziologische Werk George Herbert Meads
- II. Hauptteil
- II.1 George Herbert Mead
- II.1.1 Theoretische Voraussetzungen für Meads Werk
- II.1.2 Übersetzungsprobleme...
- II.1.3 Sprache als Grundlage (höher)entwickelter Gesellschaften_
- II.1.4 Die Universalität von Erfahrungen
- II.1.5 Play und Game: Zwei Stadien der Rollenübernahme
- II.1.6 Verallgemeinerter Anderer_
- II.1.7 Gesellschaft
- II.1.8 Das innere Gespräch: I und Me
- II.1.9 Meads Definition von Identität
- II.2 Ernst Krieck
- II.2.1 Krieck als Soziologe - Die reine Erziehungswissenschaft
- II.2.2 Das organische Weltbild Kriecks.
- II.2.3 Die Gesellschaft
- II.2.4 Das Individuum.
- II.2.5 Die drei Phasen der geistigen menschlichen Entwicklung.
- II.2.6 Kriecks Definition von Identität
- III. Schluss
- III.1 Kriecks und Meads Definitionen von Identität im Vergleich
- III.2 Krieck, Mead und der blinde Fleck der Soziologie
- III.3 Die Bedeutung der Philosophie für die Soziologie_
- IV. Quellen- und Literaturverzeichnis
- IV.1 Quellenverzeichnis
- IV.2 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der soziologischen Analyse von zwei unterschiedlichen theoretischen Modellen von Identität, die von Ernst Krieck und George Herbert Mead entwickelt wurden. Ziel ist es, die jeweiligen Konzepte von Gesellschaft, Individuum und Identität in den Werken der beiden Soziologen zu beleuchten und in einen Vergleich zu stellen. Dabei soll insbesondere der „blinde Fleck“ der Soziologie, das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, in den Fokus gerückt werden.
- Die soziologischen Werke von Ernst Krieck und George Herbert Mead
- Die Definitionen von Gesellschaft und Individuum bei Krieck und Mead
- Die Entwicklung von Identität im Sozialisationsprozess
- Der „blinde Fleck“ der Soziologie: Das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft
- Der Vergleich der Identitätskonzepte von Krieck und Mead
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Problematik der Begriffe Individuum, Gesellschaft und Identität in der Soziologie und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: Wie definieren Ernst Krieck und George Herbert Mead das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft und wie wirkt sich dies auf ihre jeweiligen Identitätskonzepte aus?
Der Hauptteil widmet sich zunächst dem Werk von George Herbert Mead. Es werden die theoretischen Voraussetzungen für Meads Werk, die Bedeutung von Sprache und die Stadien der Rollenübernahme (Play und Game) erläutert. Anschließend wird Meads Definition von Gesellschaft und Identität im Detail dargestellt. Im zweiten Teil des Hauptteils wird das Werk von Ernst Krieck beleuchtet. Hier werden Kriecks Definitionen von Gesellschaft, Individuum und Identität im Kontext seiner erziehungswissenschaftlichen Theorie vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die soziologische Analyse von Identität, die Werke von Ernst Krieck und George Herbert Mead, die Definitionen von Gesellschaft und Individuum, der „blinde Fleck“ der Soziologie, der Sozialisationsprozess und der Vergleich von Identitätskonzepten.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterscheiden sich die Identitätsmodelle von Mead und Krieck?
Mead vertritt einen Sozialbehaviorismus, bei dem Identität durch soziale Interaktion entsteht, während Krieck ein organisches Weltbild vertritt, das stärker auf Erziehung und völkische Gemeinschaft setzt.
Was versteht George Herbert Mead unter "Play" und "Game"?
"Play" ist das Stadium des einfachen Rollenspiels (z. B. Mutter-Kind), während "Game" das organisierte Spiel ist, bei dem das Kind die Rollen aller anderen Beteiligten ("der verallgemeinerte Andere") verstehen muss.
Was meint Mead mit "I" und "Me"?
Das "I" ist die impulsive, kreative Seite des Ichs, während das "Me" die internalisierten sozialen Erwartungen und Normen repräsentiert. Identität entsteht im Dialog zwischen beiden.
Welches Menschenbild verfolgte Ernst Krieck?
Krieck sah den Menschen als Teil eines organischen Ganzen und betonte die Erziehung als Werkzeug zur Einbindung des Individuums in die Gesellschaft.
Was ist der "blinde Fleck" der Soziologie in diesem Kontext?
Es beschreibt das Problem, dass soziologische Theorien oft auf unhinterfragten philosophischen Prämissen über den Menschen und sein Verhältnis zur Sozialität basieren.
- Citar trabajo
- Florian Stenke (Autor), 2013, Das Individuum in der Gesellschaft. Identitäts-Modelle bei Ernst Krieck und George Herbert Mead, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284348