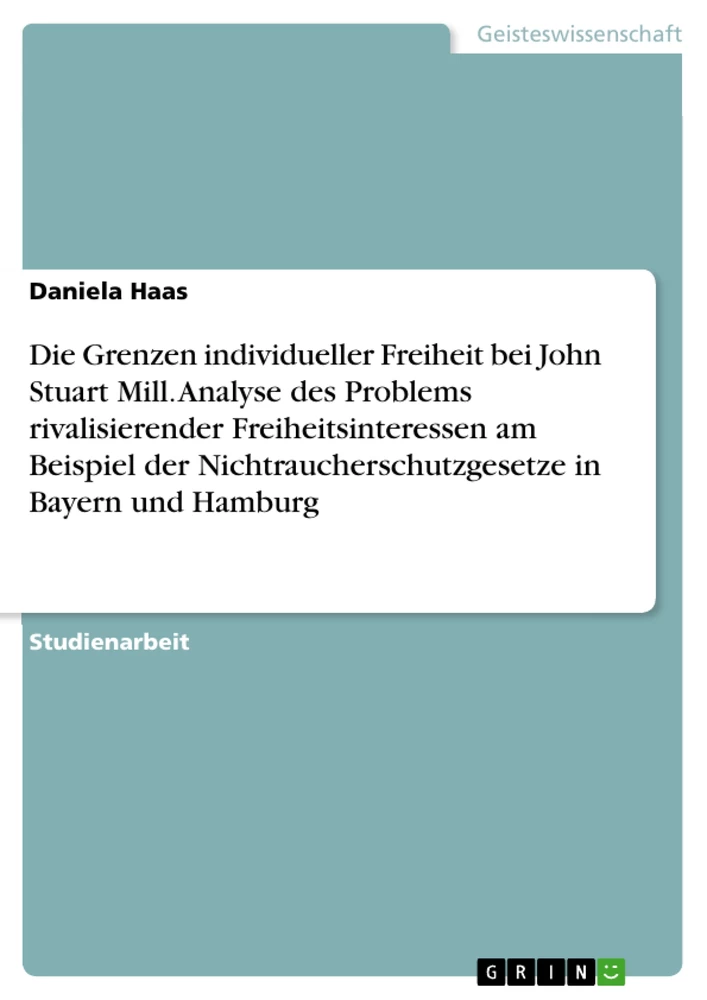Das Verfügen eines jeden Menschen über umfassende Rechte zur Sicherung der existenziellen und persönlichen Bedürfnisse steht heute, speziell in den sogenannten „westlichen Gesellschaften“, kaum noch zur Debatte. So sind etwa Freiheiten im Bezug auf Meinungsbildung bzw. -äußerung, Berufswahl, Vereinigung und Entfaltung der Persönlichkeit in Deutschland zu Grundrechten geworden, deren Gültigkeit gemeinhin nicht hinterfragt wird. Es scheint dabei als Konsens zu gelten, dass es jedermann erlaubt sein sollte, die Verwirklichung der eigenen Wünsche anzustreben, sofern sie nicht darauf zielen, anderen Menschen Leid zuzufügen. Doch auch legitime Interessen können in Gegensatz zueinander stehen und zu Auseinandersetzungen führen. So ist zum Beispiel das Tabakrauchen in öffentlichen Gaststätten Gegenstand kontroverser Diskussionen. Während Raucher hierin ein Ausüben ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit sehen, befürchten viele Nichtraucher durch das Passivrauchen, etwa in Restaurants und Kneipen, eine Gefährdung ihrer Gesundheit, der sie nur durch Fernbleiben jener Orte entgehen können. Dies wird zuweilen als Beschränkung der Freiheit angesehen, ebenso wie Raucher öffentliche Gaststätten besuchen zu können, ohne damit ein ungewolltes Gesundheitsrisiko einzugehen. Die Vertretung beider Positionen scheint zunächst berechtigt. Wie ist nun ein solcher Konflikt zu lösen? Ist einem der Freiheitsrechte der Vorrang einzuräumen, und falls ja, aus welchem Grund? Der Beantwortung dieser Fragen soll in der vorliegenden Hausarbeit nachgegangen werden. Hierbei geht es weniger um eine Darstellung der Rechtsprechung, sondern vielmehr um eine Argumentation aus der Perspektive der politischen Theorie. Grundlage für die Untersuchung ist die im Jahr 1859 veröffentlichte Schrift „Über die Freiheit“ des englischen Philosophen und Ökonomen John Stuart Mill, der heute als einer der herausragendsten Denker des Liberalismus gilt . Mill erläutert hier die enorme Bedeutung von individueller Freiheit und Entfaltung als Quelle persönlichen Glücks und gesamtgesellschaftlichen Fortschritts , und setzt sich ebenso im Hinblick auf die sozialen Verpflichtungen des Einzelnen mit den möglichen und notwendigen Einschränkungen jener Freiheit auseinander. Einige der von ihm geforderten gesellschaftlichen Veränderungen, zum Beispiel die Gleichberechtigung von Männern und Frauen , gelten im England des 19. Jahrhunderts als ungewöhnlich, finden sich heute jedoch weitgehend verwirklicht. (...)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bedeutung individueller Freiheit
- Interventionsmöglichkeiten von Gesellschaft und Staat
- Die Gesetze zum Schutz der Nichtraucher in Bayern und Hamburg – legitime Beschränkungen der individuellen Freiheit?
- Die Rechtslage in Bayern und Hamburg
- Das Problem rivalisierender Freiheitsinteressen von Rauchern und Nichtrauchern
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert das Problem rivalisierender Freiheitsinteressen am Beispiel der Nichtraucherschutzgesetze in Bayern und Hamburg. Sie untersucht, inwiefern die Einschränkungen der individuellen Freiheit durch diese Gesetze mit der Philosophie von John Stuart Mill vereinbar sind. Die Arbeit befasst sich mit Mills Verständnis von individueller Freiheit, den Grenzen dieser Freiheit und den möglichen Interventionsmöglichkeiten von Gesellschaft und Staat.
- Die Bedeutung individueller Freiheit nach John Stuart Mill
- Die Grenzen individueller Freiheit und die Rolle des Staates
- Das Problem rivalisierender Freiheitsinteressen
- Die Nichtraucherschutzgesetze in Bayern und Hamburg
- Die Vereinbarkeit der Gesetze mit Mills Konzeption der Freiheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Problem rivalisierender Freiheitsinteressen am Beispiel des Tabakrauchens in öffentlichen Gaststätten vor und erläutert die Relevanz von John Stuart Mills Werk „Über die Freiheit“ für die Analyse dieses Konflikts. Kapitel 2 beleuchtet Mills Verständnis von individueller Freiheit und die Bedeutung der individuellen Entfaltung für den Einzelnen und die Gesellschaft. Kapitel 3 erörtert die Interventionsmöglichkeiten von Gesellschaft und Staat in die individuelle Freiheit und die Frage, wie das Problem rivalisierender Freiheitsinteressen gelöst werden kann. Kapitel 4 analysiert die Rechtslage zum Nichtraucherschutz in Bayern und Hamburg und untersucht, inwiefern die Gesetze mit Mills Konzeption der Freiheit vereinbar sind.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die individuelle Freiheit, die Grenzen der Freiheit, die Interventionsmöglichkeiten von Gesellschaft und Staat, das Problem rivalisierender Freiheitsinteressen, die Nichtraucherschutzgesetze in Bayern und Hamburg, John Stuart Mill, „Über die Freiheit“, Liberalismus, Passivrauchen, Gesundheitsrisiken, Gastronomie, Rechtslage, politische Theorie.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt John Stuart Mills Freiheitsbegriff?
Mill argumentiert, dass jeder Mensch das Recht auf individuelle Entfaltung hat, solange er anderen damit keinen Schaden zufügt (Schadensprinzip).
Wie bewertet Mill die Einschränkung der Freiheit durch den Staat?
Staatliche Eingriffe sind nur dann legitim, wenn sie notwendig sind, um Schaden von Dritten abzuwenden; rein paternalistische Verbote lehnt Mill ab.
Sind Nichtraucherschutzgesetze laut Mill gerechtfertigt?
Die Arbeit analysiert, ob Passivrauchen eine Schädigung Dritter darstellt, die ein Verbot des Rauchens in öffentlichen Räumen nach Mills Kriterien rechtfertigt.
Was ist das Problem rivalisierender Freiheitsinteressen?
Es beschreibt den Konflikt, bei dem das Freiheitsrecht des einen (z.B. Rauchen) das Recht des anderen auf Gesundheit oder den Besuch öffentlicher Orte einschränkt.
Welche Unterschiede bestanden zwischen den Gesetzen in Bayern und Hamburg?
Die Arbeit vergleicht die unterschiedliche Ausgestaltung der Nichtraucherschutzgesetze und deren Auswirkungen auf die individuelle Handlungsfreiheit in der Gastronomie.
- Quote paper
- Daniela Haas (Author), 2014, Die Grenzen individueller Freiheit bei John Stuart Mill. Analyse des Problems rivalisierender Freiheitsinteressen am Beispiel der Nichtraucherschutzgesetze in Bayern und Hamburg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284430