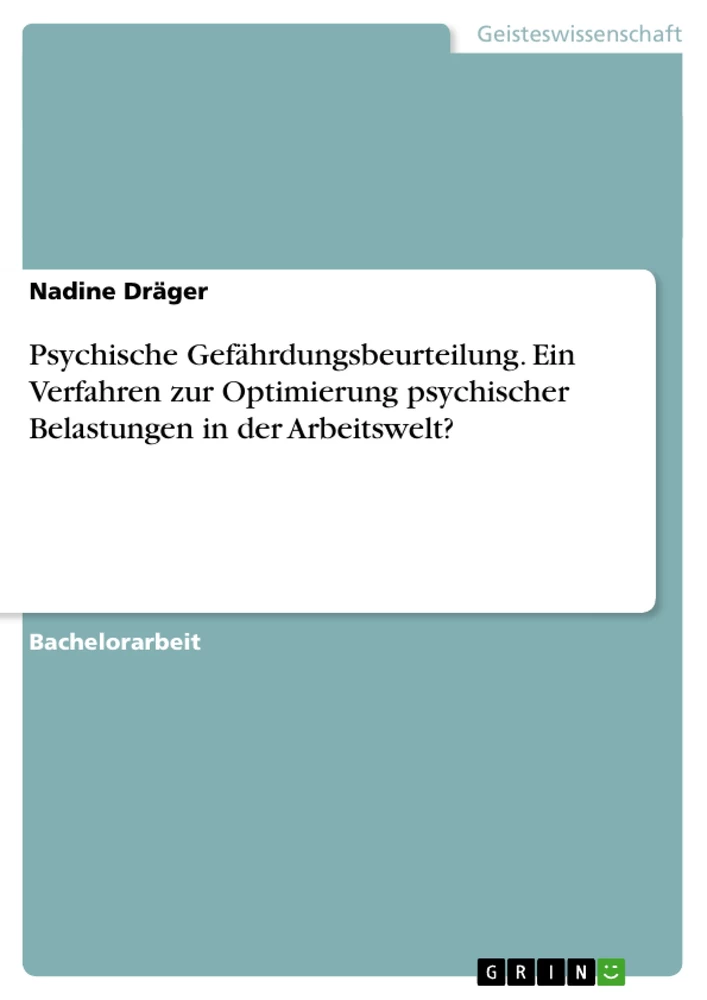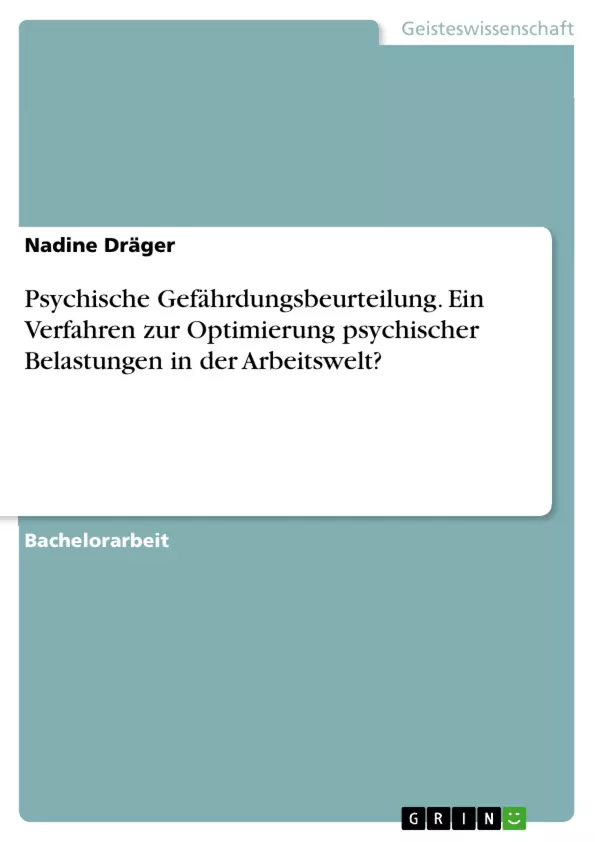Schlagzeilen, wie „Psychische Belastung wirkt sich auf die Enkel aus“, „Immer mehr psychische Belastungen“, „Wie sich Arbeitnehmer gegen psychische Belastungen wehren“ lassen sich in Medien vorfinden. Vermehrt wird von den verschiedensten Akteuren in Politik, Medizin und Arbeitswissenschaft berichtet und diskutiert, dass Menschen
dem alltäglichen Stress unserer modernen und hoch technologisierten Welt kaum noch standhalten können. Viele von ihnen fühlen sich physisch als auch psychisch belastet.
Diese Aussagen sowie vor allem die Berücksichtigung der Thematik im Koalitionsvertrag der Bundesregierung verschärfen das Bewusstsein in der Bevölkerung, dass Themen zur psychischen Belastung und die daraus resultierenden Gefährdungen für jede Person relevant sind. Allein die Suche bei Google nach „Psychische Gefährdungsbeurteilung“ liefert ca. 225.000 Ergebnisse. Die Eingabe bei Amazon in der Kategorie Bücher mit diesem Stichwort fast 75 Treffer. Diese Zahlen verdeutlichen zudem die Prägnanz der psychischen Gefährdungsbeurteilung in der Öffentlichkeit.
Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz gewinnt zunehmend an Bedeutung. 53 Millionen Krankheitstage entfielen im Jahr 2012 auf psychische Störungen. Für mehr als 40 Prozent sind psychische Erkrankungen die Ursache von Frühberentungen der zu diesem Zeitpunkt durchschnittlich 48 Jahre alten Beschäftigten. Volkswirtschaftlich ergeben sich jährliche finanzielle Einbußen von über 20 Milliarden Euro. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Psychische Belastungen in der Arbeitswelt
- Zentrale Begriffe und deren Zusammenhang
- Gefährdungsbeurteilung
- Psychische Belastungen
- Merkmale, Arten und Beispiele psychischer Belastungen
- Psychische Belastungs-/Einflussfaktoren
- Psychische Beanspruchungen
- Auswirkungen psychischer Beanspruchungen
- Beanspruchungsfolgen
- Psychische und psychosomatische Erkrankungen
- Zusammenhang zwischen Belastung, Beanspruchung und Umwelt
- Rechtsgrundlagen und geltende Normen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung
- Arbeitsschutzgesetz
- DIN-Normen
- Rechte und Pflichten der im Prozess integrierten Personen
- Prozess der psychischen Gefährdungsbeurteilung
- Vorbereitung und Vorgehensweise
- Festlegung von Tätigkeit und Bereich
- Ermittlung psychischer Gefährdungen
- Beobachtung/Beobachtungsinterviews
- Schriftliche Mitarbeiterbefragung
- Analyseworkshops
- Beurteilung psychischer Gefährdungen
- Maßnahmenentwicklung und -umsetzung
- Maßnahmen in Bezug auf die Arbeitstätigkeit
- Maßnahmen in Bezug auf die Arbeitsorganisation
- Maßnahmen in Bezug auf die sozialen Bedingungen
- Maßnahmen in Bezug auf psychische Beanspruchungsfolgen
- Maßnahmenüberprüfung
- Ergebnisdokumentation und Fortschreibung
- Kritische Betrachtung der Thematik der psychischen Gefährdungsbeurteilung
- Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung der psychischen Gefährdungsbeurteilung
- Chancen und Risiken bei dem Verfahren der psychischen Gefährdungsbeurteilung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelor-Thesis befasst sich mit der psychischen Gefährdungsbeurteilung als Verfahren zur Optimierung psychischer Belastungen in der Arbeitswelt. Ziel der Arbeit ist es, die Thematik der psychischen Gefährdungsbeurteilung umfassend zu beleuchten und die Relevanz dieses Verfahrens für die Arbeitswelt aufzuzeigen. Dabei werden die rechtlichen Grundlagen, die zentralen Begriffe und der Prozess der psychischen Gefährdungsbeurteilung detailliert analysiert.
- Rechtliche Grundlagen und Normen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung
- Zentrale Begriffe und deren Zusammenhang (z.B. Belastung, Beanspruchung, Gefährdung)
- Der Prozess der psychischen Gefährdungsbeurteilung: Vorbereitung, Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmenentwicklung und -umsetzung
- Kritische Betrachtung der Thematik: Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung, Chancen und Risiken
- Relevanz der psychischen Gefährdungsbeurteilung für die Arbeitswelt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der psychischen Gefährdungsbeurteilung ein und erläutert die Relevanz des Themas für die Arbeitswelt. Sie stellt die Zielsetzung der Arbeit dar und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Thema der psychischen Belastungen in der Arbeitswelt. Es werden verschiedene Arten von Belastungen und deren Auswirkungen auf die Gesundheit der Beschäftigten dargestellt.
Im dritten Kapitel werden die zentralen Begriffe der psychischen Gefährdungsbeurteilung definiert und in ihren Zusammenhang zueinander gesetzt. Dazu gehören die Begriffe Belastung, Beanspruchung, Gefährdung und psychische Erkrankungen.
Das vierte Kapitel behandelt die rechtlichen Grundlagen und geltenden Normen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung. Es werden das Arbeitsschutzgesetz, DIN-Normen und die Rechte und Pflichten der im Prozess integrierten Personen erläutert.
Das fünfte Kapitel beschreibt den Prozess der psychischen Gefährdungsbeurteilung im Detail. Es werden die einzelnen Schritte des Verfahrens von der Vorbereitung bis zur Ergebnisdokumentation und Fortschreibung dargestellt.
Das sechste Kapitel befasst sich mit einer kritischen Betrachtung der Thematik der psychischen Gefährdungsbeurteilung. Es werden Faktoren für eine erfolgreiche Umsetzung des Verfahrens sowie Chancen und Risiken bei der Anwendung der psychischen Gefährdungsbeurteilung analysiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die psychische Gefährdungsbeurteilung, psychische Belastungen, psychische Beanspruchungen, Arbeitswelt, Arbeitsschutz, Recht, Normen, Prozess, Maßnahmen, Chancen, Risiken, Gesundheit, Wohlbefinden, Arbeitsorganisation, soziale Bedingungen, Mitarbeiterbefragung, Analyseworkshops, Beobachtung, Ergebnisdokumentation, Fortschreibung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel einer psychischen Gefährdungsbeurteilung?
Das Ziel ist die umfassende Analyse und Optimierung psychischer Belastungen in der Arbeitswelt, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu fördern.
Welche gesetzliche Grundlage verpflichtet zur psychischen Gefährdungsbeurteilung?
Die wesentliche gesetzliche Grundlage ist das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sowie relevante DIN-Normen.
Wie läuft der Prozess einer Gefährdungsbeurteilung ab?
Der Prozess umfasst die Vorbereitung, die Ermittlung psychischer Gefährdungen (z. B. durch Mitarbeiterbefragungen oder Workshops), die Beurteilung, die Maßnahmenentwicklung sowie die Überprüfung und Dokumentation.
Welche Methoden werden zur Ermittlung psychischer Belastungen genutzt?
Zu den gängigen Methoden gehören Beobachtungsinterviews, schriftliche Mitarbeiterbefragungen und Analyseworkshops.
Welche wirtschaftlichen Folgen haben psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz?
Psychische Störungen führten im Jahr 2012 zu 53 Millionen Krankheitstagen und verursachen volkswirtschaftliche Einbußen von über 20 Milliarden Euro jährlich.
Was ist der Unterschied zwischen psychischer Belastung und Beanspruchung?
Belastung bezieht sich auf äußere Faktoren der Arbeit, während Beanspruchung die individuellen Auswirkungen dieser Faktoren auf den Menschen beschreibt.
- Arbeit zitieren
- Nadine Dräger (Autor:in), 2014, Psychische Gefährdungsbeurteilung. Ein Verfahren zur Optimierung psychischer Belastungen in der Arbeitswelt?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284472