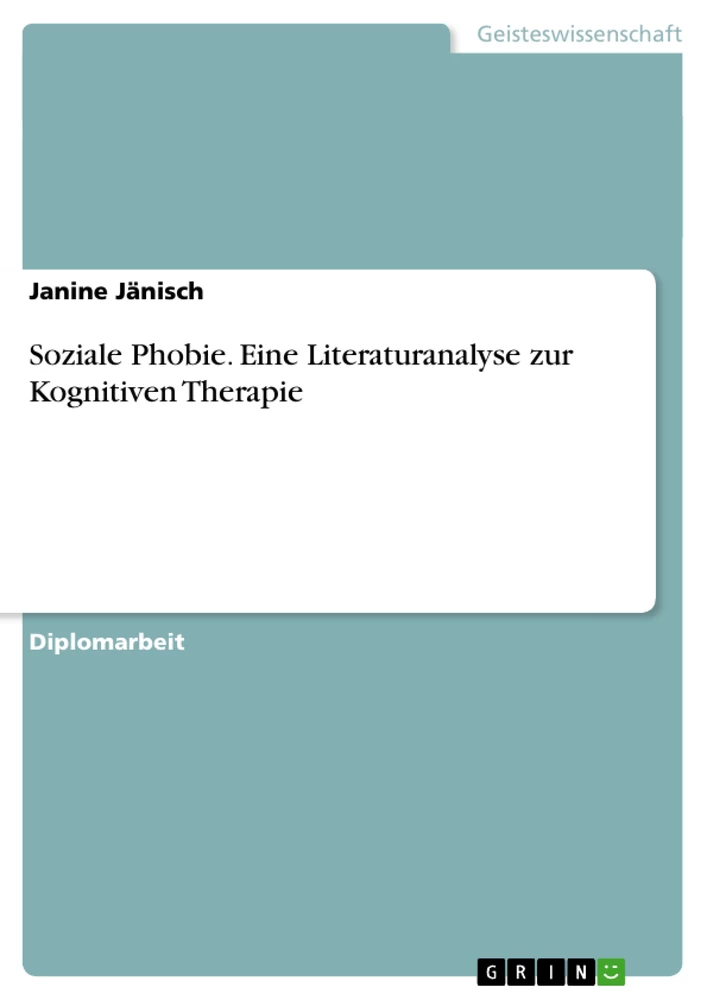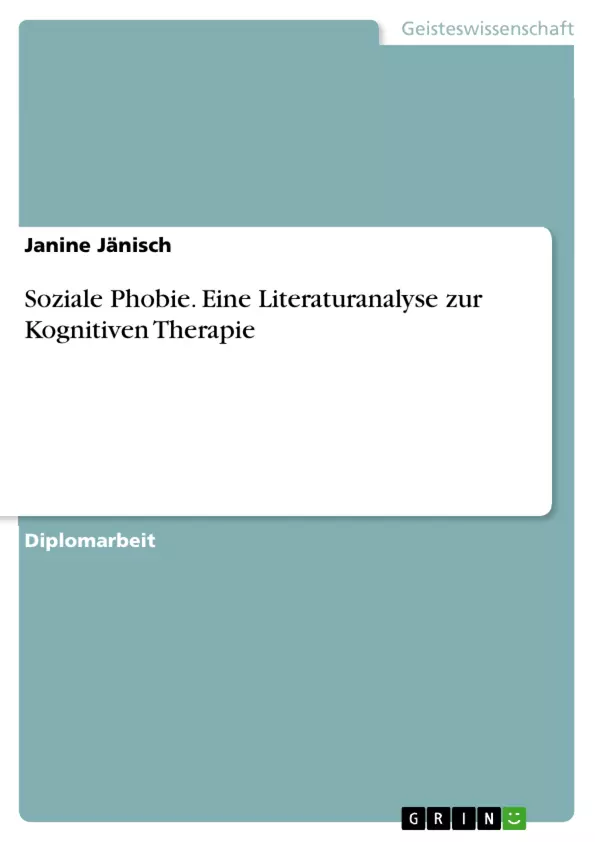„Was denken die anderen von mir?“
„Kann ich diese Erwartungen erfüllen?“
„Hoffentlich blamiere ich mich nicht!“
„Ich muss mich immer so verhalten, dass mich alle mögen!“
„In dieser feinen Gesellschaft werde ich bestimmt auffallen, falsch gekleidet sein, mich danebenbenehmen…!“
„Lieber sage ich nichts, bevor ich etwas Falsches sage!“
„Wenn ich jetzt diesen Raum betrete, werden mich gleich alle anstarren, und ich werde in den Boden versinken!“
„Ich muss immer das tun, was von mir erwartet wird, damit andere nicht schlecht über mich reden!“ und so weiter… (Görlitz, 1998, S. 355)
Wer kennt sie nicht, die Stimmen im Hinterkopf? Diese oder ähnlich klingende Sätze sind jedem Menschen vertraut und sie können dazu führen, dass Ängste, sich vor peinlich anderen zu verhalten, entwickelt werden. Die Ängste können sich so steigern, dass die betroffene Person an einer psychischen Störung erkrankt. In der klinischen Psychologie wird bei dieser Form der Erkrankung von einer Angststörung gesprochen, die mit einer Lebenszeitprävalenz von 14-16% zu der häufigsten psychischen Störung zählt (Hand, 2005; Volz, 2006). Hierbei unterteilt sich die Störung in verschiedene Erscheinungsformen, wie z.B. Panikstörung, Generalisierte Angststörung oder Spezifische Phobie.
Dem ungeachtet, was bedeutet eigentlich Angst? Der Begriff Angst stammt ursprünglich vom lateinischen Wort „angustia“ ab und heißt übersetzt „enge in der Brust“. Der Zustand, dass sich buchstäblich die Kehle zusammenzieht, die Brust beklemmend wirkt und die Atemluft ausbleibt, gehört normalerweise zu unseren Grundemotionen, wie Zorn, Wut, Freude oder Trauer (Zaudig & Trautmann, 2006). Die „normale“ Angst ist für den Menschen eine selbstverständliche und natürliche Reaktion des Organismus, um auf ein bedrohliches Erlebnis schnell und adäquat zu reagieren. Hierbei wird ein schnelles Handeln des Körpers durch eine gesteigerte Aufmerksamkeit und körperliche Aktivität ermöglicht, wie z.B. eine erhöhte Herztätigkeit und Atmung. Ebenfalls steigt die intellektuelle und motorische Leistungsbereitschaft. Dies führt dazu, dass beispielsweise beim Überqueren des Fußgängerüberweges ermöglicht wird, vor einem nicht bremsenden Auto auszuweichen (Vriends & Margraf, 2005a; Bassler, 2006). [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Krankheitsbild der Sozialen Phobie
- Historische Entwicklung
- Klinisches Erscheinungsbild
- Klassifikation
- DSM-IV-TR
- ICD-10
- Vergleich der Kriterien der Klassifikationssysteme
- Diagnostik
- Abgrenzung der Sozialen Phobie von anderen Störungen
- Erfassung der individuellen Symptomatik
- Subtypen der Sozialen Phobie
- Generalisierter vs. Nicht-generalisierter Subtyp
- Leistungssituation vs. Interaktionssituation
- Soziale Kompetenz vs. Soziale Kompetenzdefizite
- Ängstlich-vermeidende Persönlichkeitsstörung
- Epidemiologie, Verlauf und Prognose
- Störungsbeginn, Verlauf und Prognose
- Komorbidität
- Kulturunterschiede
- Soziodemographische Merkmale
- Die Kognitiv-behavioralen Erklärungsmodelle
- Bedingungen zur Entstehung der Sozialen Phobie
- Begünstigende (prädisponierende) Bedingungen
- Genetische Faktoren
- Neurobiologische Faktoren
- Psychologische Faktoren
- Auslösende Bedingungen
- Aufrechterhaltende Bedingungen
- Begünstigende (prädisponierende) Bedingungen
- Das Modell der kognitiven Vulnerabilität von Beck, Emery und Greenberg (1985)
- Das Kognitive Modell von Clark und Wells (1995)
- Erster Teil: Angst während der gefürchteten Situation
- Zweiter Teil: Angst vor und nach der gefürchteten Situation
- Bedingungen zur Entstehung der Sozialen Phobie
- Die Kognitive Therapie zur Sozialen Phobie
- Grundlagen der Kognitiven Therapie
- Ablauf der Behandlungssitzungen
- Die therapeutische Beziehung
- Erstgespräch und Eingangsdiagnostik
- Phase 1: Ableitung eines individuellen Störungsmodells
- Phase 2: Vorbereitung auf Verhaltensexperimente
- Phase 3: In-vivo-Verhaltensexperimente
- Phase 4: Kognitive Umstrukturierung
- Phase 5: Therapieabschluss und Rückfallprophylaxe
- Effektivität der Kognitiven Therapie
- Kognitive Therapie vs. Expositionstherapie
- Einzeltherapie vs. Gruppentherapie
- Kognitive Therapie vs. Pharmakotherapie
- Ambulante vs. Stationäre Behandlung
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Soziale Phobie und die kognitive Therapie als Behandlungsansatz. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis des Krankheitsbildes, der zugrundeliegenden kognitiven Modelle und der Effektivität der kognitiven Therapie zu vermitteln.
- Das Krankheitsbild der Sozialen Phobie: Klinische Merkmale, Klassifikation und Epidemiologie.
- Kognitiv-behaviorale Erklärungsmodelle: Die Rolle von Kognitionen und Verhalten bei der Entstehung und Aufrechterhaltung der Störung.
- Kognitive Therapie: Methoden, Ablauf und therapeutische Beziehung.
- Effektivität der Kognitiven Therapie: Vergleich mit anderen Therapieformen.
- Zusammenfassende Betrachtung der Ergebnisse und Ausblick.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Sozialen Phobie ein und beschreibt die Bedeutung von Angst im Kontext psychischer Störungen. Sie betont die hohe Prävalenz der Sozialen Phobie und hebt die Notwendigkeit einer effektiven Behandlung hervor. Die Arbeit fokussiert auf die kognitive Therapie als einen vielversprechenden Ansatz und skizziert den aktuellen Forschungsstand. Die Einleitung veranschaulicht die alltäglichen Ängste, die zu einer Sozialen Phobie führen können, und hebt die Bedeutung des Unterschieds zwischen normaler und pathologischer Angst hervor.
Das Krankheitsbild der Sozialen Phobie: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung der Sozialen Phobie, beginnend mit ihrer historischen Entwicklung und den klinischen Erscheinungsbildern. Es werden die Klassifikationssysteme DSM-IV-TR und ICD-10 detailliert erläutert und verglichen. Die Diagnostik, inklusive der Abgrenzung von anderen Störungen und der Erfassung individueller Symptomatik, wird ebenso behandelt wie verschiedene Subtypen der Sozialen Phobie. Schließlich werden epidemiologische Aspekte wie Prävalenz, Verlauf, Komorbidität, kulturelle Einflüsse und soziodemografische Merkmale diskutiert.
Die Kognitiv-behavioralen Erklärungsmodelle: Dieses Kapitel befasst sich mit den kognitiv-behavioralen Modellen, die die Entstehung und Aufrechterhaltung der Sozialen Phobie erklären. Es werden prädisponierende, auslösende und aufrechterhaltende Bedingungen untersucht, wobei genetische, neurobiologische und psychologische Faktoren berücksichtigt werden. Besonders werden die Modelle der kognitiven Vulnerabilität nach Beck, Emery und Greenberg (1985) und das kognitive Modell von Clark und Wells (1995) im Detail analysiert. Die Kapitelteile beleuchten die komplexen Interaktionen zwischen kognitiven, emotionalen und verhaltensbezogenen Faktoren im Kontext der Sozialen Phobie.
Die Kognitive Therapie zur Sozialen Phobie: Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen der kognitiven Therapie bei Sozialer Phobie. Es erläutert den Ablauf der Behandlungssitzungen, die Rolle der therapeutischen Beziehung und die Durchführung der Eingangsdiagnostik. Die fünf Phasen der kognitiven Therapie werden detailliert dargestellt: von der Ableitung eines individuellen Störungsmodells über die Vorbereitung auf Verhaltensexperimente und deren Durchführung bis hin zur kognitiven Umstrukturierung und der Rückfallprophylaxe. Das Kapitel unterstreicht die praktische Anwendung der kognitiven Prinzipien bei der Behandlung der Sozialen Phobie.
Effektivität der Kognitiven Therapie: In diesem Kapitel wird die Effektivität der kognitiven Therapie für Soziale Phobie untersucht und mit anderen Therapieformen (Expositionstherapie, Pharmakotherapie) verglichen. Die Effekte von Einzel- und Gruppentherapie sowie ambulanten und stationären Behandlungen werden ebenfalls diskutiert. Das Kapitel liefert eine wissenschaftliche Bewertung der Wirksamkeit der kognitiven Therapie im Vergleich zu alternativen Behandlungsansätzen.
Schlüsselwörter
Soziale Phobie, Kognitive Therapie, Angststörung, DSM-IV-TR, ICD-10, Kognitiv-behaviorale Modelle, Kognitive Umstrukturierung, Verhaltensexperimente, Effektivität, Therapievergleich.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Kognitive Therapie bei Sozialer Phobie
Was ist der Inhalt dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Soziale Phobie und die kognitive Therapie als Behandlungsansatz. Sie behandelt das Krankheitsbild der Sozialen Phobie, die zugrundeliegenden kognitiv-behavioralen Erklärungsmodelle, den Ablauf der kognitiven Therapie und deren Effektivität im Vergleich zu anderen Therapieformen. Die Arbeit beinhaltet Einleitung, Inhaltsverzeichnis, Kapitelzusammenfassungen, Zielsetzung und Schlüsselwörter.
Welche Aspekte der Sozialen Phobie werden behandelt?
Die Arbeit beschreibt die historische Entwicklung, das klinische Erscheinungsbild, die Klassifikation (DSM-IV-TR und ICD-10), die Diagnostik, Subtypen (generalisiert vs. nicht-generalisiert, Leistungssituation vs. Interaktionssituation, soziale Kompetenz), Epidemiologie (Störungsbeginn, Verlauf, Prognose, Komorbidität, kulturelle Einflüsse, soziodemografische Merkmale).
Welche kognitiv-behavioralen Erklärungsmodelle werden diskutiert?
Die Arbeit analysiert prädisponierende, auslösende und aufrechterhaltende Bedingungen für die Entstehung und Aufrechterhaltung der Sozialen Phobie. Im Detail werden die Modelle der kognitiven Vulnerabilität nach Beck, Emery und Greenberg (1985) und das kognitive Modell von Clark und Wells (1995) untersucht. Genetische, neurobiologische und psychologische Faktoren werden berücksichtigt.
Wie wird die Kognitive Therapie bei Sozialer Phobie beschrieben?
Die Arbeit erläutert die Grundlagen der kognitiven Therapie, den Ablauf der Behandlungssitzungen (Erstgespräch, Eingangsdiagnostik, fünf Phasen der Therapie: Störungsmodell, Vorbereitung auf Verhaltensexperimente, In-vivo-Verhaltensexperimente, kognitive Umstrukturierung, Therapieabschluss und Rückfallprophylaxe), die Rolle der therapeutischen Beziehung und die praktische Anwendung kognitiver Prinzipien.
Wie wird die Effektivität der Kognitiven Therapie bewertet?
Die Effektivität der kognitiven Therapie wird im Vergleich zu anderen Therapieformen (Expositionstherapie, Pharmakotherapie), Einzel- und Gruppentherapie sowie ambulanten und stationären Behandlungen untersucht. Die Arbeit liefert eine wissenschaftliche Bewertung der Wirksamkeit im Vergleich zu alternativen Ansätzen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Soziale Phobie, Kognitive Therapie, Angststörung, DSM-IV-TR, ICD-10, Kognitiv-behaviorale Modelle, Kognitive Umstrukturierung, Verhaltensexperimente, Effektivität, Therapievergleich.
Welche Zielsetzung verfolgt die Diplomarbeit?
Ziel der Arbeit ist es, ein umfassendes Verständnis des Krankheitsbildes der Sozialen Phobie, der zugrundeliegenden kognitiven Modelle und der Effektivität der kognitiven Therapie zu vermitteln.
- Arbeit zitieren
- Janine Jänisch (Autor:in), 2008, Soziale Phobie. Eine Literaturanalyse zur Kognitiven Therapie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284475